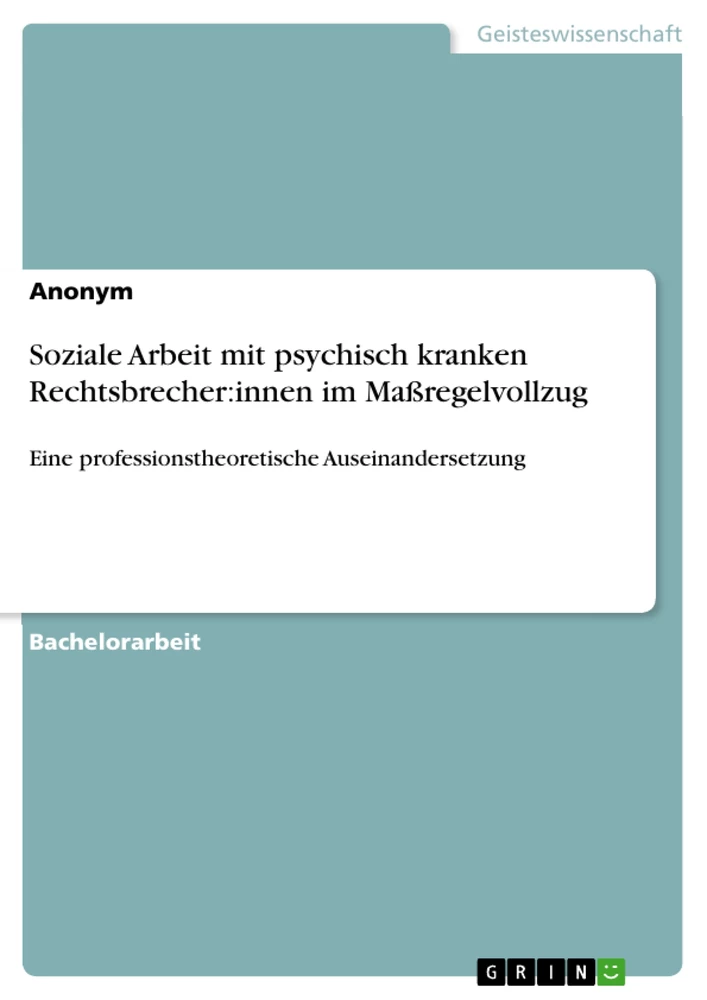Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie. Die Soziale Arbeit hat erst vor einigen Jahren ein Tätigkeitsfeld in der forensischen Psychiatrie etabliert. Daraus resultiert, dass sie zu einem neueren und wenig erforschten Handlungsfeld der Sozialen Arbeit gehört. Ziel dieser Arbeit, ist es anhand herausgearbeiteter Professionalisierungskriterien eine mögliche Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie aufzuzeigen.
Zu Beginn dieser Arbeit wird deshalb eine Professionstheoretische Auseinandersetzung durchgeführt. Anhand ausgewählter Professionstheorien werden die Merkmale einer professionellen Sozialen Arbeit formuliert und aufgezeigt. Darauf folgt im zweiten Teil dieser Arbeit eine Allgemeine Ausarbeitung von Informationen über die forensische Psychiatrie. Im letzten Teil dieser Arbeit wird dann in Bezug auf die vorherigen Kapitel, die aktuelle sozialarbeiterische Tätigkeit im Maßregelvollzug erläutert und dargestellt. Unter Berücksichtigung der vorher erarbeiteten Merkmale einer professionellen Sozialen Arbeit werden die spezifischen Professionalisierungskriterien für die Soziale Arbeit in der forensischen Psychiatrie herausgearbeitet und anhand der forensischen Fachsozialarbeit eine mögliche Perspektive aufgezeigt
Inhaltsverzeichnis
- Erklärung
- Danksagung
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Die Soziale Arbeit als Profession
- 2.1. Profession - eine Begriffserklärung
- 2.2. Der professionstheoretische Diskurs
- 2.2.1. Der Strukturtheoretische Ansatz nach Oevermann
- 2.2.2. Der Machttheoretische Ansatz nach Abbott
- 2.3. Strukturmerkmale der professionellen Sozialen Arbeit
- 2.3.1. Diffuse Allzuständigkeiten
- 2.3.2. Doppelte Loyalitätsverpflichtung
- 2.3.3. Geringe Standardisierbarkeit des professionellen Handelns
- 2.3.4. Arbeitsbeziehung-Koproduktion
- 2.3.5. Die eigene Person als Arbeitsinstrument
- 2.3.6. Ethische Grundlagen
- 2.4. Kritisches Fazit der professionstheoretischen Auseinandersetzung
- 3. Die forensische Psychiatrie
- 3.1. Die forensische Psychiatrie - eine Begriffserklärung
- 3.2. Historische Entwicklung des Maßregelvollzuges
- 3.3. Rechtliche Grundlagen im föderalen System
- 3.3.1. Kranke gefährliche Täter:innen - Die psychiatrische Maßregel, § 63 StGB
- 3.3.2. Suchtmittelmissbrauch – Die Entziehungsmaßregel, § 64 StGB
- 3.3.3. Einstweilige Unterbringung - § 126a StPO
- 3.4. Voraussetzungen für die Einweisung in eine forensische Psychiatrie
- 3.5. Behandlungsziele
- 4. Soziale Arbeit in der forensischen Psychiatrie
- 4.1. Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie
- 4.2. Aktuelles Tätigkeitsfeld in der forensischen Psychiatrie
- 4.3. Casemanagement - eine Methode der Sozialen Arbeit
- 4.4. Die interprofessionelle Kooperation
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie. Ziel ist es, anhand herausgearbeiteter Professionalisierungskriterien eine mögliche Professionalisierung der Sozialen Arbeit in diesem Feld aufzuzeigen.
- Professionstheoretische Auseinandersetzung der Sozialen Arbeit
- Beschreibung der forensischen Psychiatrie und des Maßregelvollzuges
- Aktuelle Tätigkeit der Sozialen Arbeit im Maßregelvollzug
- Spezifische Professionalisierungskriterien für die Soziale Arbeit in der forensischen Psychiatrie
- Mögliche Perspektiven der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie und beschreibt die aktuelle Situation und die Notwendigkeit einer Professionalisierung.
Im zweiten Kapitel wird eine professionelle Auseinandersetzung mit der Sozialen Arbeit als Profession durchgeführt. Dabei werden verschiedene Professionstheorien und deren Anwendung auf die Soziale Arbeit beleuchtet.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die forensische Psychiatrie, indem es die Begriffserklärung, die historische Entwicklung des Maßregelvollzuges und die rechtlichen Grundlagen sowie die Voraussetzungen für eine Einweisung und die Behandlungsziele beleuchtet.
Im vierten Kapitel wird die Soziale Arbeit in der forensischen Psychiatrie im Detail betrachtet. Es werden aktuelle Tätigkeitsfelder, die Methode des Casemanagements und die interprofessionelle Kooperation erläutert.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab, das die Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie gibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Soziale Arbeit, Maßregelvollzug, forensische Psychiatrie, Professionstheorien, professionelle Soziale Arbeit und Professionstheoretische Auseinandersetzung. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Professionalisierung der Sozialen Arbeit im Bereich der forensischen Psychiatrie und betrachtet dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Anwendung spezifischer Methoden wie dem Casemanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Bachelorarbeit zur Sozialen Arbeit im Maßregelvollzug?
Das Ziel der Arbeit ist es, anhand erarbeiteter Professionalisierungskriterien eine mögliche Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie aufzuzeigen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden im Kontext der forensischen Psychiatrie behandelt?
Die Arbeit erläutert die psychiatrische Maßregel (§ 63 StGB), die Entziehungsmaßregel (§ 64 StGB) sowie die einstweilige Unterbringung (§ 126a StPO).
Welche Rolle spielt das Casemanagement in der forensischen Sozialarbeit?
Casemanagement wird als eine zentrale Methode der Sozialen Arbeit vorgestellt, um die komplexen Hilfeprozesse im Maßregelvollzug zu koordinieren.
Welche professionstheoretischen Ansätze werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit setzt sich mit dem strukturtheoretischen Ansatz nach Oevermann und dem machttheoretischen Ansatz nach Abbott auseinander.
Was sind die spezifischen Merkmale professioneller Sozialer Arbeit laut dieser Studie?
Dazu gehören diffuse Allzuständigkeiten, die doppelte Loyalitätsverpflichtung, die geringe Standardisierbarkeit des Handelns sowie die Nutzung der eigenen Person als Arbeitsinstrument.
Warum gilt die forensische Psychiatrie als wenig erforschtes Handlungsfeld?
Da die Soziale Arbeit erst vor einigen Jahren ein festes Tätigkeitsfeld in diesem Bereich etabliert hat, mangelt es noch an umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Soziale Arbeit mit psychisch kranken Rechtsbrecher:innen im Maßregelvollzug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1324314