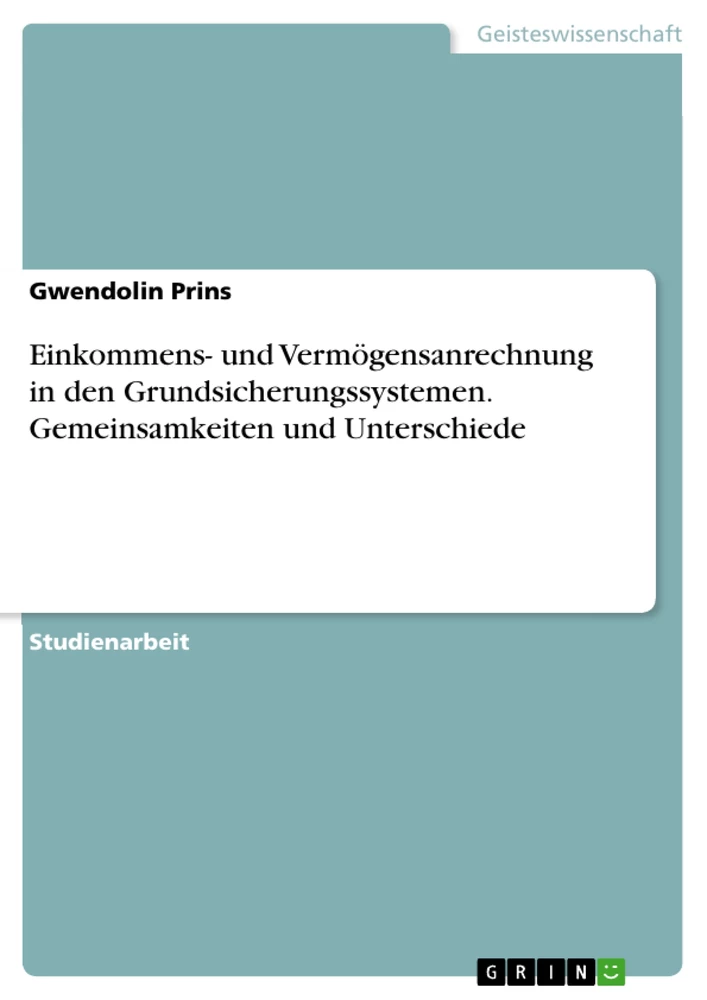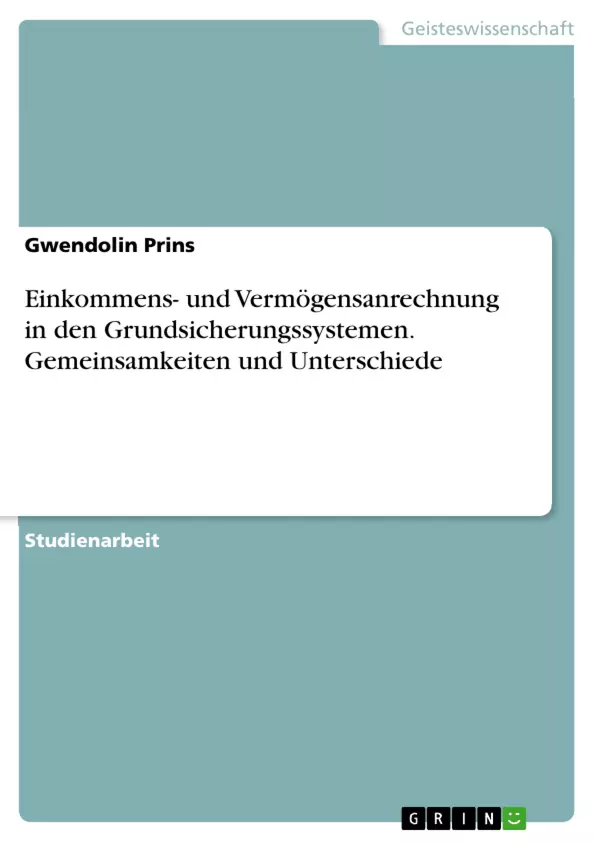Was stellen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Einkommens- und Vermögensanrechnung in den Grundsicherungssystemen dar, und welche Folgen ergeben sich daraus für die Praxis der Sozialen Arbeit? Dafür sollen zuallererst historische und sozialverwaltungsrechtliche Grundlagen und die Vorstellung beider Grundsicherungssysteme des SGB II und SGB XII als Fundament dienen, um dann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Anrechnungsarten herauszukristallisieren und gegenüberzustellen. Im Anschluss werden dann die Auswirkungen auf die Praxis der Sozialen Arbeit einer näheren Betrachtung unterzogen. Ein resümierendes Fazit rundet die wissenschaftliche Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Wie arm ist Deutschland?
- 2. Die Grundsicherungssysteme in Deutschland
- 2.1 Kurzer historischer Ausschnitt
- 2.2 Grundlagen des Allgemeinen Sozialverwaltungsrechts
- 2.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- 2.4 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
- 3. Einkommens- und Vermögensanrechnung in den Grundsicherungssystemen
- 3.1 Einkommens- und Vermögensanrechnung im SGB II
- 3.2 Einkommens- und Vermögensanrechnung im SGB XII
- 3.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Anrechnungsarten
- 4. Auswirkungen und Aufgaben im Praxisalltag der Sozialen Arbeit
- 5. Fazit
- 6. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Einkommens- und Vermögensanrechnung in den deutschen Grundsicherungssystemen, nämlich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII). Die Arbeit beleuchtet die historischen und sozialverwaltungsrechtlichen Grundlagen, um die spezifischen Anrechnungsarten in beiden Systemen zu vergleichen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen dieser Anrechnungen auf die Praxis der Sozialen Arbeit untersucht.
- Historische Entwicklung und Bedeutung der Grundsicherung in Deutschland
- Grundlagen des Allgemeinen Sozialverwaltungsrechts im Kontext der Grundsicherung
- Einkommens- und Vermögensanrechnung im SGB II und SGB XII
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Anrechnungsarten
- Auswirkungen der Anrechnungsarten auf die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Hausarbeit beginnt mit einer kurzen Einleitung zum Thema Armut in Deutschland und verdeutlicht die Relevanz der Grundsicherungssysteme in der aktuellen Gesellschaft. Der Bezug auf die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen dient als Kontextualisierung für die Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Grundsicherungssysteme in Deutschland. Zunächst wird ein kurzer historischer Abriss der Sozialversicherung in Deutschland gegeben, um die Entwicklung des Sozialstaates und die Grundlage für die heutigen Grundsicherungssysteme zu beleuchten. Im Anschluss werden die Grundlagen des Allgemeinen Sozialverwaltungsrechts erläutert und die Wichtigkeit der rechtlichen Grundlage für die Bewilligung von Sozialleistungen hervorgehoben.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel widmet sich dem Vergleich der Einkommens- und Vermögensanrechnung im SGB II und SGB XII. Es werden die spezifischen Regelungen und Unterschiede in beiden Systemen dargestellt und detailliert erläutert.
Schlüsselwörter
Grundsicherung, Sozialhilfe, SGB II, SGB XII, Einkommensanrechnung, Vermögensanrechnung, Sozialverwaltungsrecht, Soziale Arbeit, Armut, Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Altersarmut, Erwerbsminderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen SGB II und SGB XII?
SGB II regelt die Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitsuchende (Hartz IV / Bürgergeld), während SGB XII für Menschen zuständig ist, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die Altersgrenze erreicht haben.
Wie wird Einkommen in der Grundsicherung angerechnet?
Grundsätzlich mindert jedes verfügbare Einkommen den Leistungsanspruch. Es gibt jedoch Freibeträge, insbesondere bei Erwerbstätigkeit im SGB II, um Anreize zur Arbeit zu erhalten.
Welches Vermögen gilt als "Schonvermögen"?
Schonvermögen ist der Teil des Ersparten, der nicht für den Lebensunterhalt eingesetzt werden muss. Die Grenzen hierfür sind im SGB II meist großzügiger bemessen als in der Sozialhilfe nach SGB XII.
Welche Auswirkungen hat die Anrechnung auf die Soziale Arbeit?
Sozialarbeiter müssen Klienten bei der Antragstellung unterstützen, Bescheide prüfen und über die komplexen rechtlichen Regelungen aufklären, um existenzielle Notlagen zu verhindern.
Gibt es Unterschiede bei der Berücksichtigung von Wohneigentum?
Ja, ein selbst genutztes Haus oder eine Eigentumswohnung von angemessener Größe bleibt in beiden Systemen meist anrechnungsfrei, wobei die Kriterien für "Angemessenheit" variieren können.
- Arbeit zitieren
- M.A. Gwendolin Prins (Autor:in), 2022, Einkommens- und Vermögensanrechnung in den Grundsicherungssystemen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1324526