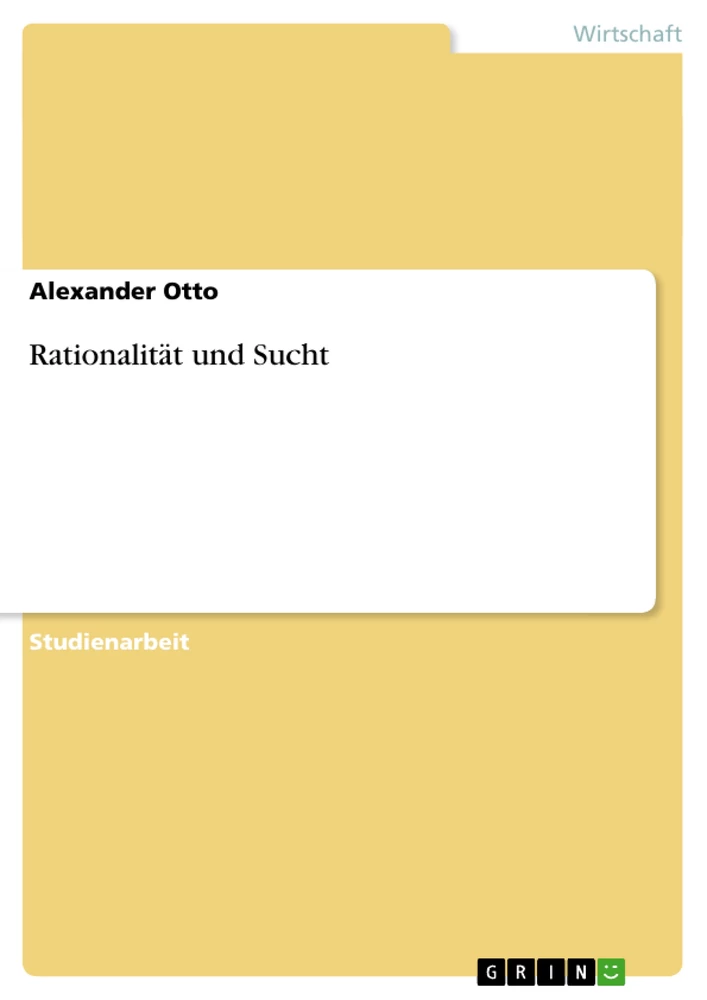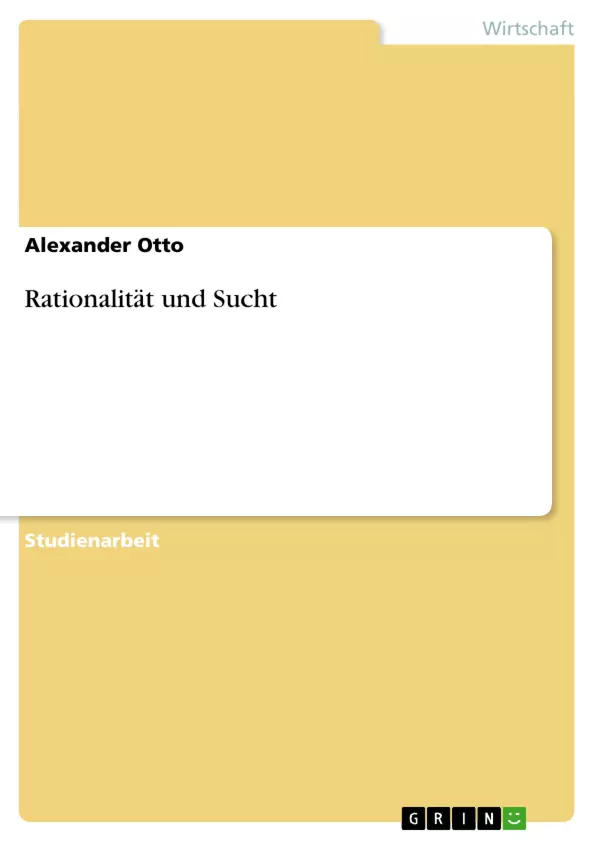Die Bedeutung von Sucht für individuelle Entscheidungen spielt in den Untersuchungen zu rationalem Verhalten eine immer wichtigere Rolle – Sucht stellt einen Ausnahmefall dar, der bisher nicht empirisch erklärt werden konnte. Entscheidungen von Individuen, die nicht nach scheinbar rationalen Mustern handeln, sondern für außenstehende irrationale Dinge tun, untergraben teil- und verständlicherweise grundlegende Annahmen der Rational Choice Theorie.
Doch wie lassen sich diese unverständlichen Entscheidungen empirisch untersuchen? Welche Ansätze sollten zu Erklärung von Verhalten unter Suchteinfluss herangezogen werden? Ist die Spieltheorie mit ihren internen Spielen hier auf dem richtigen Weg? Und können Wirtschaftswis-senschaftler mit ihrem Instrumentarium tiefenpsychologische, unterbewusste individuelle suchtgesteuerte Verhaltensmuster überhaupt nachvollziehen, geschweige denn Erklären oder Vorhersagen?
Der deutsche Ökonom Prof. Dr. Björn Frank hat hierzu einen maßgeblichen Aufsatz verfasst. "The use of internal Games: The case of addiction versucht", Drogenkonsum mit Methoden aus der Spieltheorie auf Basis von Kavkas Darstellungen zu internen Spielen zu erklären. Doch dieser Versuch erzeugte heftige Kritik: Als Antwort auf Björn Franks Aufsatz haben der Berliner Ökonom Werner Güth und der Duisburger Philosoph Hartmut Kliemt den Text "One Person – many Players" verfasst. Im Hauptteil dieser Seminararbeit soll zunächst Kavkas Theorie der internen Spiele erläutert, dann die beiden deutschen Aufsätze vorgestellt und die aufgeführten Ansätze verglichen und überprüft werden. Auch anderweitige Erklärungsversuche für suchtgesteuertes Verhalten sollen in einem Überblick erläutert werden. Und obwohl es Modellen in der Rational Choice Theorie oft an empirischer Belegbarkeit mangelt, wird der Vergleich im Idealfall ein Fazit ermöglichen, indem bestimmt werden kann, wie sich die Rational Choice Forschung und Sucht in Einklang bringen lassen kann.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EINFÜHRUNGEN
- RATIONAL CHOICE THEORIE
- SPIELTHEORIE
- GEFANGENENDILEMMA
- THEORIE DER INTERNEN SPIELE
- INTERNE GEFANGENENDILEMMATA
- THE USE OF INTERNAL GAMES: THE CASE OF ADDICTION
- KRITIK AN THE USE OF INTERNAL GAMES: THE CASE OF ADDICTION
- ALTERNATIVE ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG VON SUCHT
- Innerhalb der Spieltheorie
- Unvollständige Rationalität und Selbstbindung
- Ein Sozio-ökonomischer Ansatz
- FAZIT UND KONSEQUENZEN FÜR DIE DROGENPOLITIK
- QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, wie Suchtverhalten mit Hilfe der Spieltheorie erklärt werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung von Kavkas Theorie der internen Spiele auf den Fall von Drogenkonsum. Die Arbeit analysiert den Aufsatz "The use of internal Games: The case of addiction" von Björn Frank und die darauf folgende Kritik von Werner Güth und Hartmut Kliemt in "One Person - many Players". Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze zu vergleichen und zu überprüfen, ob die Spieltheorie ein geeignetes Instrument zur Erklärung von Suchtverhalten ist. Darüber hinaus werden alternative Erklärungsansätze für suchtgesteuertes Verhalten vorgestellt.
- Anwendung der Spieltheorie auf Suchtverhalten
- Kavkas Theorie der internen Spiele
- Kritik an der Anwendung der Spieltheorie auf Sucht
- Alternative Erklärungsansätze für Sucht
- Rational Choice Theorie und Sucht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sucht und deren Bedeutung für die Rational Choice Theorie ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Erklärung von suchtgesteuertem Verhalten und die Relevanz der Spieltheorie in diesem Kontext dar. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Kavkas Theorie der internen Spiele und deren Anwendung auf den Fall von Drogenkonsum.
Das Kapitel "Einführungen" behandelt die Grundlagen der Rational Choice Theorie und der Spieltheorie. Es erläutert die Grundannahmen der Rational Choice Theorie, das Modell des Homo Oeconomicus und die Bedeutung von Präferenzen für Entscheidungen. Die Spieltheorie wird als Methode zur Analyse von strategischen Entscheidungen von Gruppen, Individuen und intra-personellen Agenten vorgestellt. Das Gefangenendilemma wird als Beispiel für eine strategische Entscheidungssituation erläutert.
Das Kapitel "Theorie der internen Spiele" beschäftigt sich mit Kavkas Theorie der internen Spiele und deren Anwendung auf den Fall von Drogenkonsum. Es werden die Argumente von Björn Frank in "The use of internal Games: The case of addiction" dargestellt und die Kritik von Werner Güth und Hartmut Kliemt in "One Person - many Players" analysiert. Die Arbeit untersucht, ob die Spieltheorie ein geeignetes Instrument zur Erklärung von Suchtverhalten ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rational Choice Theorie, die Spieltheorie, das Gefangenendilemma, interne Spiele, Sucht, Drogenkonsum, Kavkas Theorie der internen Spiele, "The use of internal Games: The case of addiction", "One Person - many Players", alternative Erklärungsansätze für Sucht, unvollständige Rationalität, Selbstbindung, sozio-ökonomische Ansätze und die Folgen für die Drogenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann Spieltheorie Suchtverhalten erklären?
Sucht wird als „internes Spiel“ betrachtet, bei dem verschiedene „Ich-Zustände“ (z. B. der Konsument vs. der Abstinente) gegeneinander agieren.
Was ist Kavkas Theorie der internen Spiele?
Sie überträgt strategische Entscheidungskonflikte (wie das Gefangenendilemma) auf das Innenleben einer einzelnen Person.
Warum wird die Anwendung der Rational Choice Theorie auf Sucht kritisiert?
Kritiker wie Güth und Kliemt argumentieren, dass tiefenpsychologische Muster durch rein ökonomische Modelle oft nicht ausreichend erfasst werden.
Was bedeutet „Selbstbindung“ bei Sucht?
Es sind Strategien der unvollständigen Rationalität, bei denen sich ein Individuum heute einschränkt, um künftiges Suchtverhalten zu verhindern.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die Drogenpolitik?
Die Arbeit diskutiert, ob politische Maßnahmen Anreize für diese internen Spiele setzen können, um den Ausstieg aus der Sucht zu erleichtern.
- Quote paper
- Alexander Otto (Author), 2009, Rationalität und Sucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132518