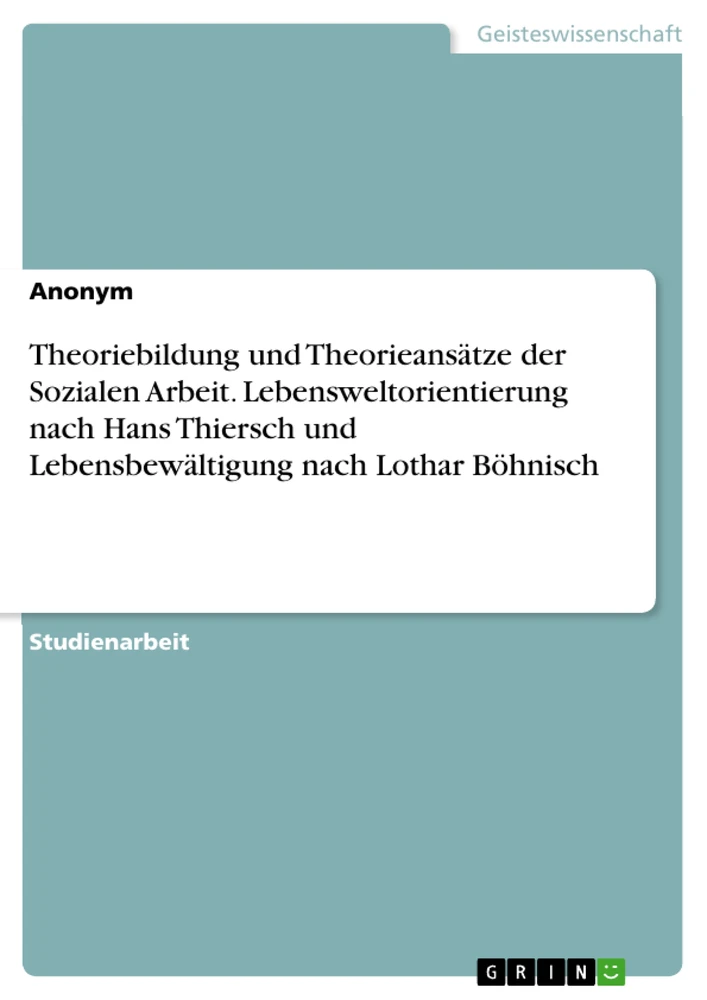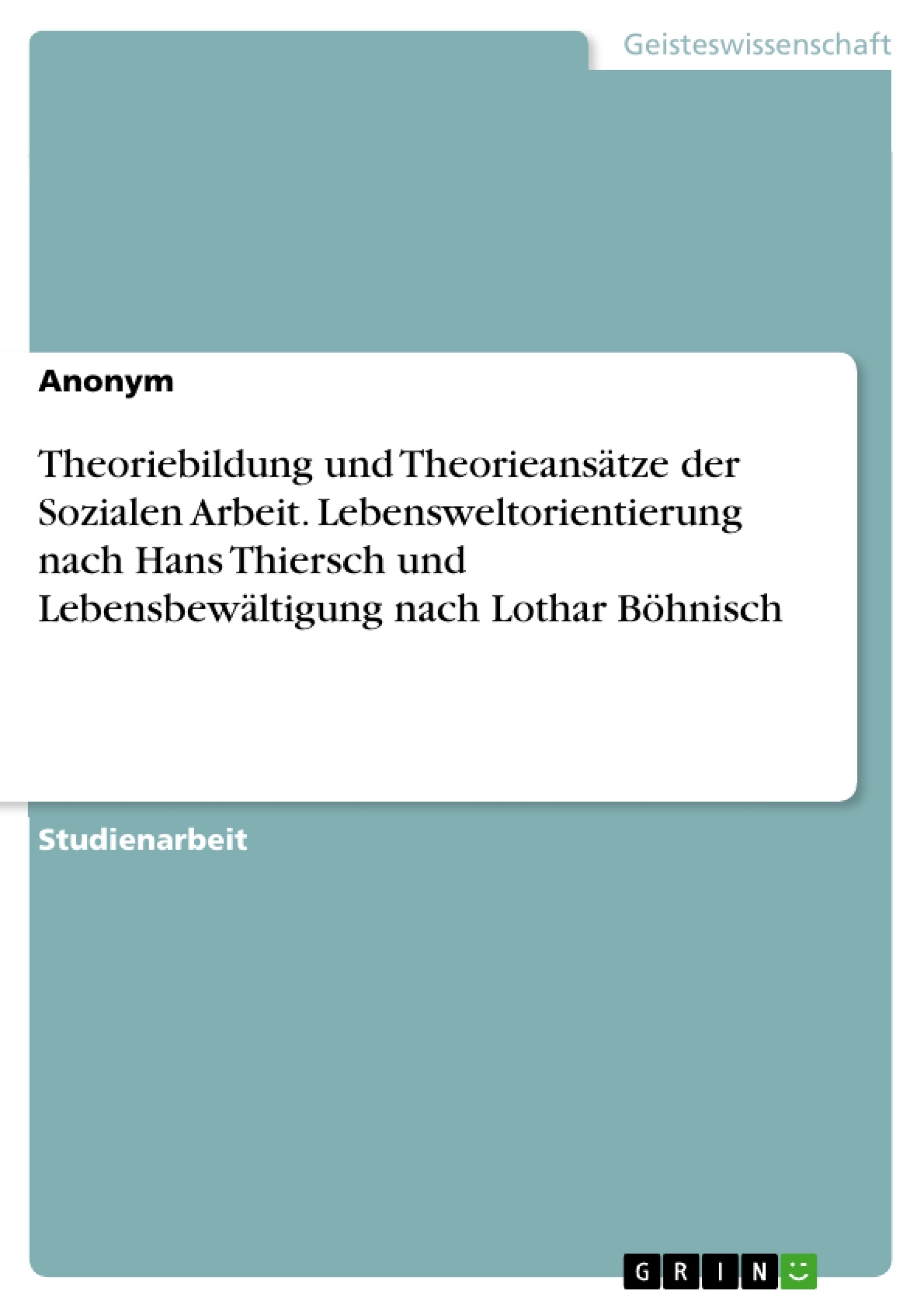Die Hausarbeit besteht aus drei verschiedenen Fragestellungen, die in den jeweiligen Kapiteln beantwortet werden. Angesprochene Themen sind das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch, das Konzept der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch und der Theoriepluralismus in der sozialen Arbeit.
Zunächst wird erklärt, was das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch, nachfolgend LWO genannt, ist und welche Aufgaben und Ziele es in dem Konzept gibt. Anschließend werden kurze Einblicke in den historischen Kontext gegeben. Es folgen die Dimensionen des Konzeptes und die Bewältigungsformen des Alltages. Danach werden die Struktur- und Handlungsmaxime beschrieben, die die "Grundhaltungen der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit" konkretisiert. Nach der Skizzierung des Konzeptes wird die Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld dargestellt, um danach zentrale Ideen des Ansatzes mit dem Handlungsfeld zu erläutern.
Dann wird das Konzept der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch vorgestellt. Danach werden das Theorie-Praxis-Modell und die kritische Lebenskonstellation im Zusammenhang der Lebensbewältigung dargestellt. Es folgen die Aufgaben und Ziele des Konzeptes und ein kleiner Einblick in die Entstehung. Anschließend werden die personal-psychodynamischen, die relational-intermediären und die sozialstruktureIlen und sozialpolitischen Ebenen der Lebensbewältigung mit den in Zusammenhang stehenden Bewältigungslagen näher betrachtet. Nach der Skizzierung der Lebensbewältigung werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch anhand eines Handlungsfeldes
- Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch
- Hilfe zur Erziehung in der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Vergleich der Lebensbewältigung nach Böhnisch und Lebensweltorientierung nach Thiersch
- Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Lebensweltorientierung
- Funktionen der Theorien Sozialer Arbeit: Verhältnis von sozialpädagogischer Forschung und Theoriebildung
- Funktionen der Theorien Sozialer Arbeit
- Verhältnis von sozialpädagogischer Forschung und Theoriebildung
- Reflektion des Moduls
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio setzt sich zum Ziel, die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch zu erläutern und in Bezug zu einem Handlungsfeld zu setzen. Es vergleicht die Lebensweltorientierung mit anderen Theorien und beleuchtet die Funktionen von Theorien in der Sozialen Arbeit. Zudem wird das Verhältnis von sozialpädagogischer Forschung und Theoriebildung diskutiert.
- Die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch
- Vergleich der Lebensweltorientierung mit anderen Theorien
- Funktionen der Theorien Sozialer Arbeit
- Das Verhältnis von sozialpädagogischer Forschung und Theoriebildung
- Anwendung der Lebensweltorientierung in einem Handlungsfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch (LWO) vor, erläutert seine Aufgaben und Ziele und gibt einen kurzen Einblick in den historischen Kontext. Es werden die Dimensionen des Konzeptes sowie die Bewältigungsformen des Alltags beschrieben. Des Weiteren werden die Struktur- und Handlungsmaximen der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit erläutert. Um das Konzept zu verdeutlichen, wird anschließend die Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld vorgestellt und zentrale Ideen des Ansatzes mit diesem Handlungsfeld verknüpft.
Das zweite Kapitel vergleicht die Lebensbewältigung nach Böhnisch mit der Lebensweltorientierung nach Thiersch. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze aufgezeigt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Funktionen von Theorien in der Sozialen Arbeit. Es werden die verschiedenen Funktionen von Theorien erläutert und das Verhältnis von sozialpädagogischer Forschung und Theoriebildung diskutiert.
Schlüsselwörter
Lebensweltorientierung, Hans Thiersch, Soziale Arbeit, Handlungsfeld, Kinder- und Jugendhilfe, Lebensbewältigung, Lothar Böhnisch, Theoriebildung, sozialpädagogische Forschung, Prävention, Integration, Inklusion, Partizipation, Alltagsnähe, Regionalisierung, Sozialräumlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch?
Es ist ein Konzept der Sozialen Arbeit, das darauf abzielt, Hilfen nah am Alltag der Menschen zu gestalten und deren Selbsthilfepotenziale zu stärken.
Was versteht Lothar Böhnisch unter Lebensbewältigung?
Lebensbewältigung beschreibt das Streben des Individuums, in kritischen Lebenskonstellationen handlungsfähig zu bleiben und soziale Anerkennung zu finden.
Was sind die Strukturmaximen der Lebensweltorientierung?
Dazu gehören Prävention, Alltagsnähe, Regionalisierung, Dezentralisierung, Integration und Partizipation.
Wie unterscheiden sich Thiersch und Böhnisch?
Während Thiersch den Fokus auf die Gestaltung des Alltags legt, betont Böhnisch stärker die psychodynamischen und sozialpolitischen Ebenen der Problembewältigung.
Welche Rolle spielt die Kinder- und Jugendhilfe in diesen Konzepten?
Sie dient als zentrales Handlungsfeld, um die theoretischen Ansätze der LWO und der Lebensbewältigung in der Praxis anzuwenden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Theoriebildung und Theorieansätze der Sozialen Arbeit. Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch und Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1325337