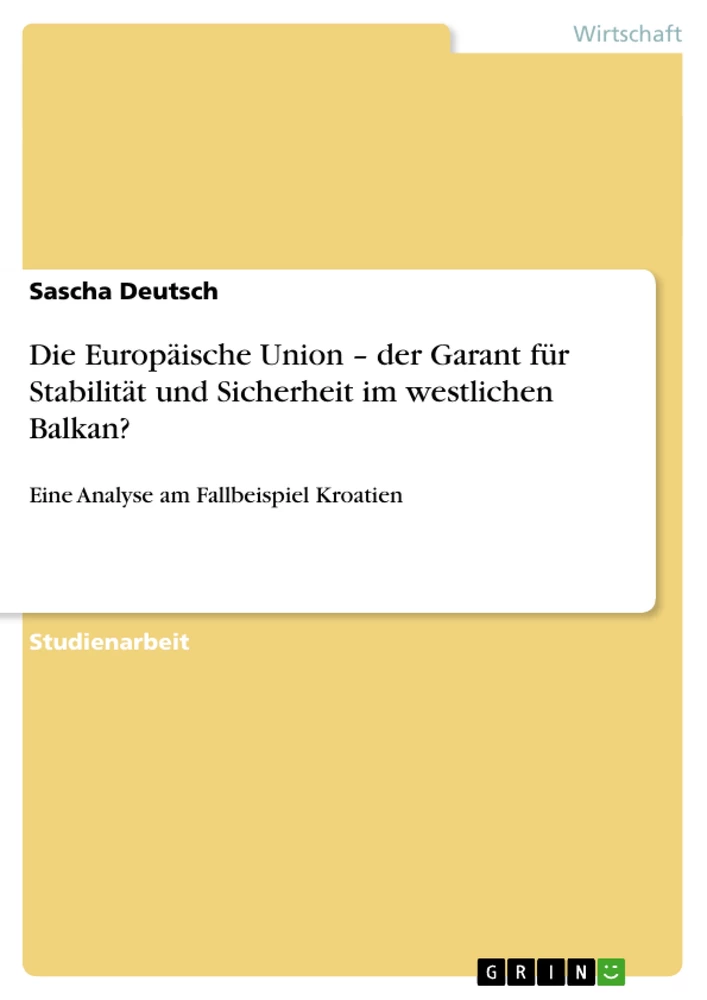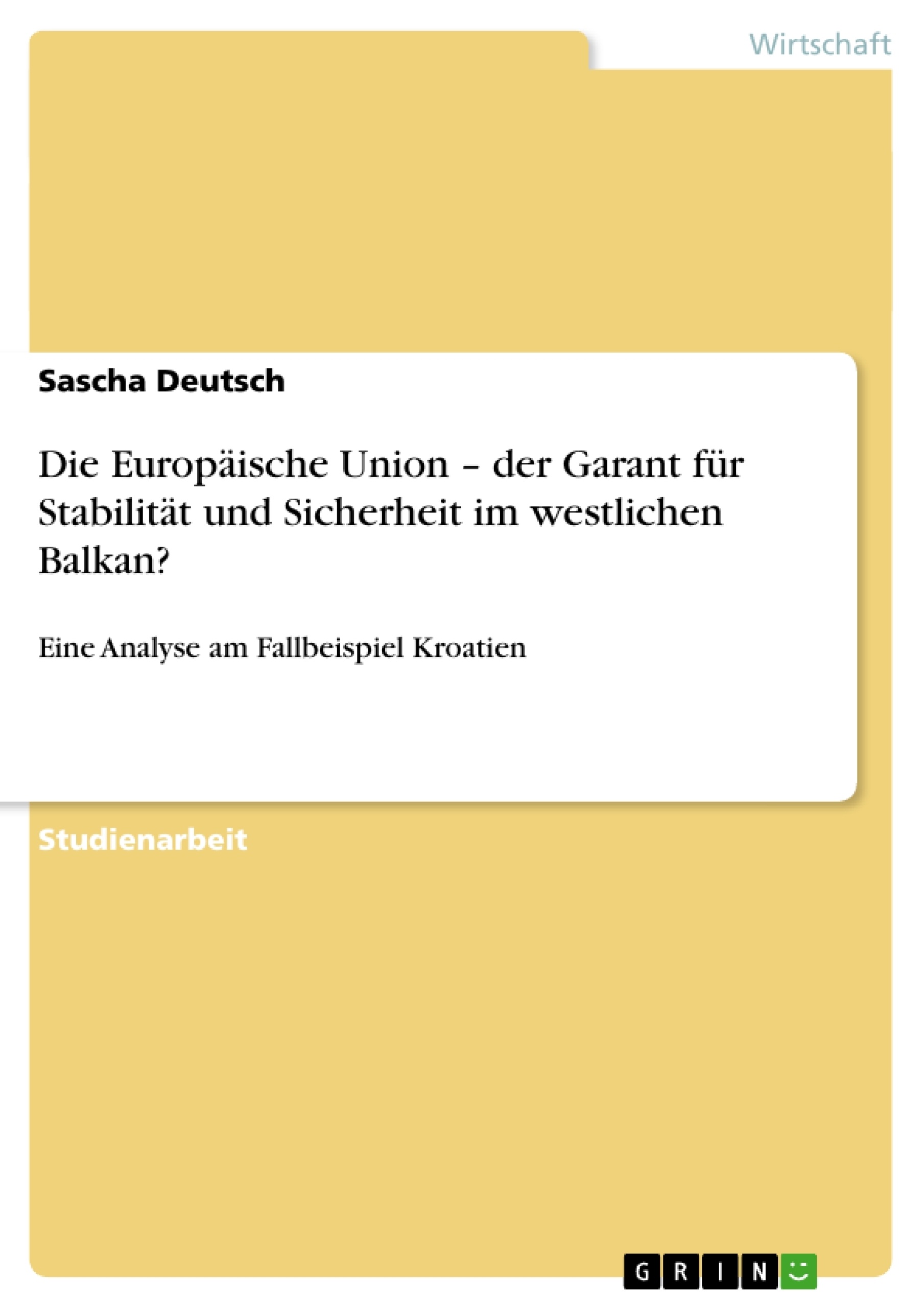Der Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaftssysteme in Mittel- und Osteuropa in den Jahren 1989/90 beendete die Rivalität der bipolaren Weltordnung und zog einen Schlussstrich unter den seit vierzig Jahren herrschenden Kalten Krieg. Daraus entstand eine große Chance die tiefe politische und wirtschaftliche Spaltung Europas zu überwinden (Kramer 1998, 1). Die Eingliederung zehn dieser Staaten in die EU, durch die fünfte und größte Erweiterung 2004, war in ihrer Größe und ihrem Ausmaß einzigartig, gar historisch. Die Schwierigkeiten lagen bei dem Transformationsprozess der Beitrittsländer. Durch die fehlenden Erfahrungen mit einem marktwirtschaftlichen System und festen demokratischen Werten, war es nötig verschiedene Hilfsprogramme von Seiten der Union auf die Beine zu stellen. Während sich die reformwilligen MOEL vor allem eine innen- und wirtschaftspolitische Stabilisierung erhofften, drängten die Europäer aus drei Gründen auf eine Osterweiterung (Karakas 2004, 43). Erstens sollte ein Bekenntnis zur Einigkeit Europas abgelegt und zweitens neue Absatzmärkte sowie kostengünstigere Produktionsbedingungen erlangt werden (ebenda, 43). Vor allem aber ging es um eine sicherheitspolitische Stabilisierung Europas. Diese Intention ist auch für den Balkanraum von großer Bedeutung. Der einsetzende Transformationsprozess wurde jedoch zusätzlich durch ethische Konflikte und die damit verbundenen schlimmsten militärischen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden seit dem Ende des zweiten Weltkrieges überschattet.
In der vorliegenden Arbeit wird als erstes die Balkanregion und Kroatiens Transformationsprozess bis 2000 beschrieben. Als theoretische Grundlage für die weitere Analyse der politischen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen dient dabei das working paper „EU as an outside anker“ von Berglöf. Darauf aufbauend wird analysiert, ob die EU durch die besonderen Bedingungen (Konditionalitäten) wie zum Beispiel die Kopenhagener Kriterien, Wohlstand und Stabilität in Kroatien nach 2000 fördern konnte. Im letzten Abschnitt soll die Entwicklung ab 2000 bis heute beschrieben werden. Die aktuelle Diskussion um den Reformbedarf innerhalb der EU und den Vertrag von Lissabon soll in dieser Arbeit nicht beachtet werden, da der Beitritt Kroatiens die EU-25 Bevölkerung lediglich um 1% und den Output um 0,3% steigen lassen würde (Lejour/Mervar/Verweij 2008, 7).
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der westliche Balkan
- 3. Kroatien bis 2000.
- 3.1 Politische Entwicklung..
- 3.2 Wirtschaftliche Entwicklung.
- 4. The “EU as an outside anchor" for transition reforms
- 5. Kopenhagener Kriterien
- 6. Heranführungsinstrumente der EU für die Länder des westlichen Balkans
- 7. Kroatien ab 2000.
- 7.1 Politisch Entwicklung
- 7.2 Wirtschaftliche Entwicklung.
- 8. Aktuelle Entwicklung...
- 9. Schlussbetrachtung..
- Quellenverzeichnis .
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Europäische Union als Garant für Stabilität und Sicherheit im Balkan am Fallbeispiel Kroatien. Sie untersucht die politische und wirtschaftliche Entwicklung Kroatiens vor und nach dem Jahr 2000 im Kontext der EU-Beitrittsverhandlungen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der EU als "Außenanker" für den Transformationsprozess in Kroatien und analysiert die Wirksamkeit der Kopenhagener Kriterien und der Heranführungsinstrumente der EU.
- Der Transformationsprozess Kroatiens nach dem Zerfall Jugoslawiens
- Die Rolle der EU als "Außenanker" für den Transformationsprozess
- Die Wirksamkeit der Kopenhagener Kriterien und der Heranführungsinstrumente der EU
- Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Kroatiens nach 2000
- Die Herausforderungen und Chancen für Kroatien im Kontext der EU-Mitgliedschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Europäischen Union als Garant für Stabilität und Sicherheit im Balkan ein und stellt die Relevanz des Fallbeispiels Kroatien heraus. Kapitel 2 definiert den Begriff "westlicher Balkan" und beleuchtet die historische und politische Situation der Region. Kapitel 3 beschreibt die politische und wirtschaftliche Entwicklung Kroatiens bis zum Jahr 2000. Kapitel 4 analysiert das Konzept der EU als "Außenanker" für den Transformationsprozess in den Ländern des westlichen Balkans. Kapitel 5 stellt die Kopenhagener Kriterien als wichtige Bedingung für den EU-Beitritt vor. Kapitel 6 erläutert die Heranführungsinstrumente der EU für die Länder des westlichen Balkans. Kapitel 7 beschreibt die politische und wirtschaftliche Entwicklung Kroatiens nach dem Jahr 2000. Kapitel 8 beleuchtet die aktuelle Entwicklung Kroatiens im Kontext der EU-Mitgliedschaft. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Zukunft Kroatiens in der EU.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Europäische Union, den westlichen Balkan, Kroatien, EU-Beitritt, Transformationsprozess, Kopenhagener Kriterien, Heranführungsinstrumente, politische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, Stabilität, Sicherheit, Wohlstand.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die EU für die Stabilität auf dem Balkan?
Die EU fungiert als „Außenanker“, der durch Beitrittsperspektiven und wirtschaftliche Hilfsprogramme Reformen und Stabilität in der Region fördert.
Was sind die Kopenhagener Kriterien?
Dies sind die Voraussetzungen, die ein Land erfüllen muss, um der EU beizutreten, darunter stabile demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und eine funktionierende Marktwirtschaft.
Wie verlief der Transformationsprozess in Kroatien bis 2000?
Der Prozess war nach dem Zerfall Jugoslawiens durch ethnische Konflikte und militärische Auseinandersetzungen überschattet, was die politische und wirtschaftliche Stabilisierung erschwerte.
Was änderte sich in Kroatien nach dem Jahr 2000?
Nach 2000 intensivierten sich die Beitrittsbemühungen, und die EU-Konditionalitäten führten zu signifikanten Fortschritten in der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung.
Warum drängte die EU auf eine Osterweiterung?
Die Hauptgründe waren die sicherheitspolitische Stabilisierung Europas, das Bekenntnis zur Einigkeit des Kontinents sowie die Erschließung neuer Absatzmärkte.
- Quote paper
- Sascha Deutsch (Author), 2009, Die Europäische Union – der Garant für Stabilität und Sicherheit im westlichen Balkan?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132583