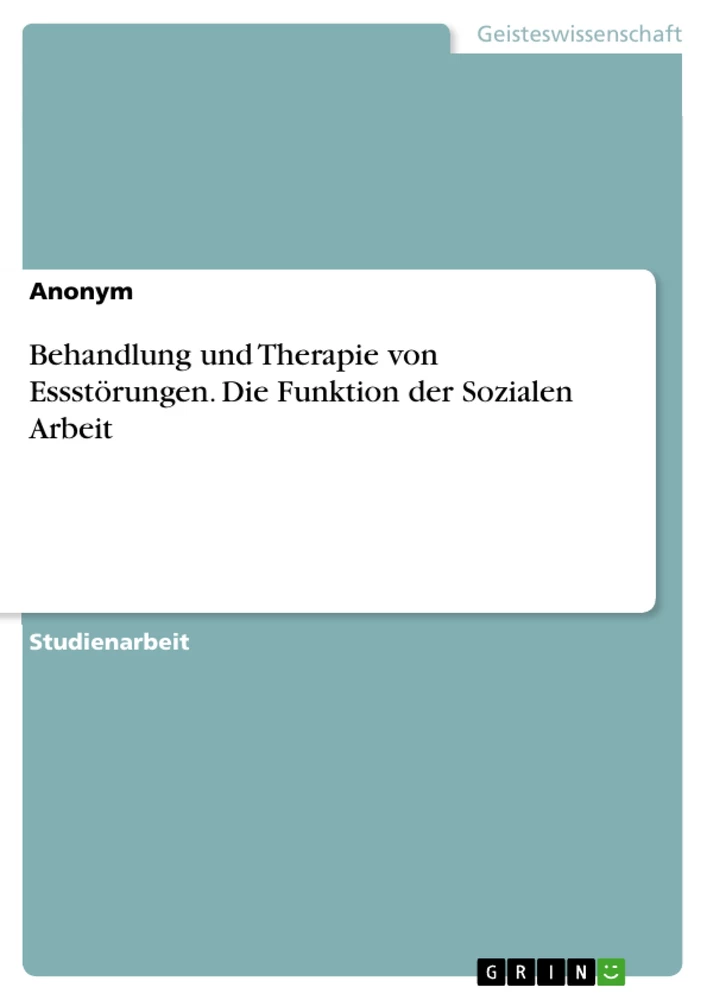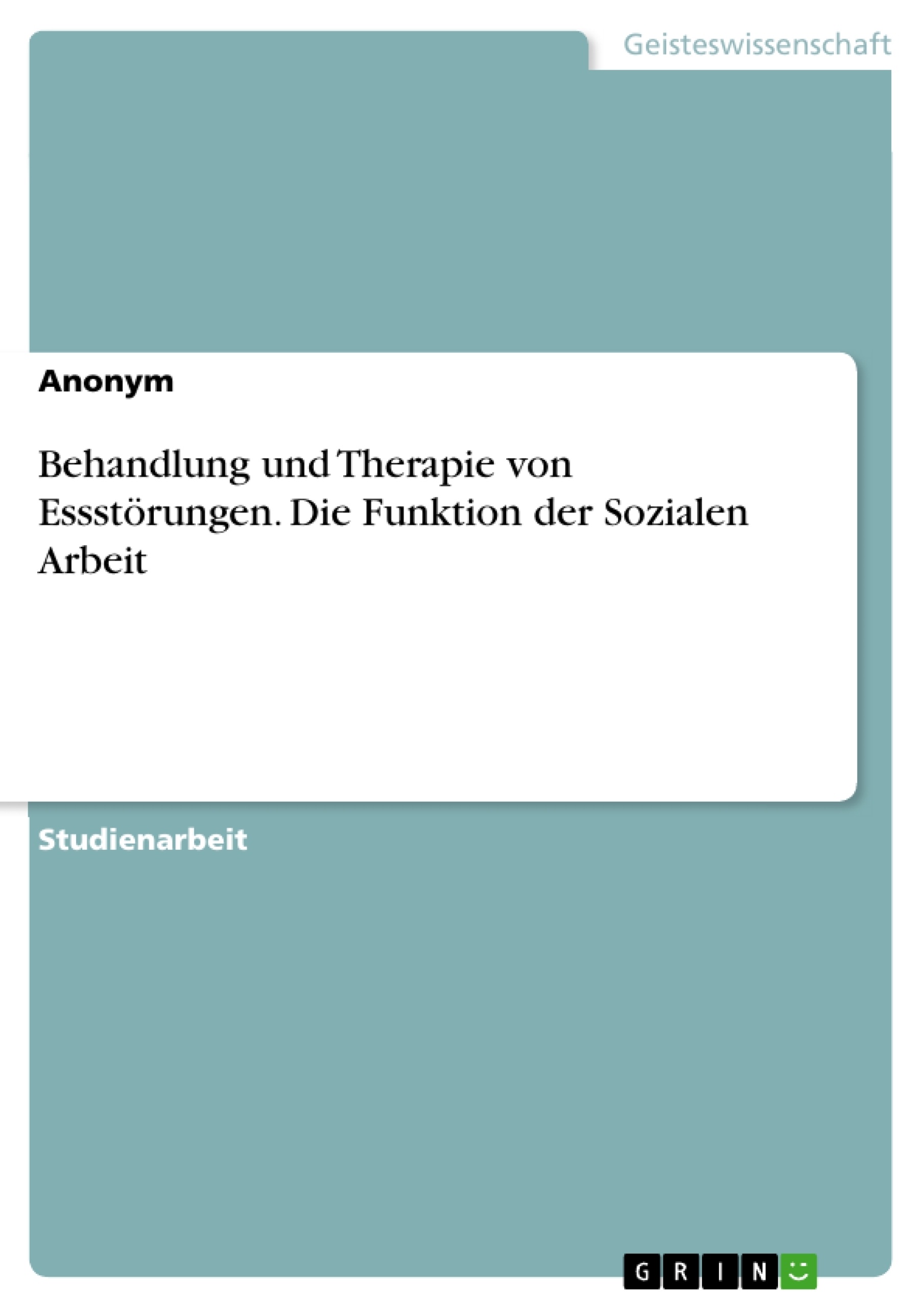In der vorliegenden Hausarbeit soll der Schwerpunkt auf die Anorexia Nervosa gerichtet und ein Einblick in die Verhaltensstörung gegeben werden. Diese Krankheit sollte auch in der Sozialen Arbeit nicht unbeachtet bleiben. Bei der Krankheit handelt es sich um eine Körperschemastörung, bei der die Betroffenen sich immer als zu dick empfinden und dieser Gedanke die Oberhand einnimmt.
Hauptsächlich wird Anorexia Nervosa von Medizinern und Psychologen therapiert und behandelt. In dieser Hausarbeit soll darauf eingegangen werden, wie auch andere Professionalitäten des Gesundheitswesens einen wichtigen Teil in der Behandlung spielen. Soziale Arbeit ist in vielen Bereichen des Gesundheitswesens, wie der Psychiatrie oder in der Hospizarbeit, vertreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Essstörungen
- Magersucht
- Auslöser und Ursachen von Magersucht
- Einfluss der Sozialen Netzwerke, Internet und anderen Medien
- Krankheitsbild
- Symptome einer Erkrankung
- Psychische und physische Folgen
- Intervention
- Medizinische Betreuung
- Ernährungsberatung
- Psychotherapie und Soziale Arbeit
- Gruppenpädagogische Begleitung
- Prognose und Verlauf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Magersucht (Anorexia Nervosa) und zielt darauf ab, einen Einblick in die Verhaltensstörung zu geben. Dabei wird insbesondere der Fokus auf die Rolle der Sozialen Arbeit in der Behandlung von Magersüchtigen gelegt. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung verschiedener Professionalitäten im Gesundheitswesen und untersucht, wie Soziale Arbeit in der Behandlung von Magersucht einen wichtigen Beitrag leisten kann.
- Begriffsklärungen von Essstörungen und Magersucht
- Auslöser und Ursachen von Magersucht, einschließlich des Einflusses sozialer Medien
- Krankheitsbild und Symptome einer Anorexia Nervosa
- Psychische und physische Folgen von Magersucht
- Interventionen und Behandlungsmöglichkeiten in der Magersuchttherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Magersucht-Thematik im Kontext der Sozialen Arbeit. Die Begriffsklärungen definieren Essstörungen und Magersucht, wobei insbesondere die körperlichen und psychischen Folgen hervorgehoben werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit Auslösern und Ursachen von Magersucht, wobei der Einfluss sozialer Medien und anderer Medien im Detail behandelt wird. Das Krankheitsbild der Magersucht wird im vierten Kapitel beleuchtet, mit Fokus auf die Symptome und die damit einhergehenden psychischen und physischen Folgen.
Schlüsselwörter
Magersucht, Anorexia Nervosa, Essstörungen, Soziale Arbeit, Gesundheitswesen, Psychische Folgen, Physische Folgen, Intervention, Behandlung, Soziale Medien, Medienkonsum, Körperbild, Selbstbild, Selbstwertgefühl, Kontrolle, Zwangsverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Anorexia Nervosa (Magersucht)?
Es handelt sich um eine schwere Essstörung und Körperschemastörung, bei der sich Betroffene trotz Untergewichts als zu dick empfinden und die Nahrungsaufnahme extrem einschränken.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei Essstörungen?
Soziale Arbeit unterstützt Betroffene in der Psychiatrie oder Beratungsstellen, hilft bei der Alltagsbewältigung und bietet gruppenpädagogische Begleitung an.
Wie beeinflussen soziale Medien die Entstehung von Magersucht?
Das Internet und soziale Netzwerke können unrealistische Schönheitsideale vermitteln, die das Selbstbild negativ beeinflussen und als Auslöser für Essstörungen wirken.
Was sind die physischen Folgen von extremer Magersucht?
Zu den Folgen gehören schwere Organschäden, Hormonstörungen, Knochenschwund und im schlimmsten Fall Organversagen.
Welche Berufsgruppen sind an der Therapie beteiligt?
Neben Medizinern und Psychologen sind Ernährungsberater und Sozialpädagogen essenzielle Teile eines multidisziplinären Behandlungsteams.
Wie sieht die Prognose für eine Heilung aus?
Der Verlauf ist oft langwierig; eine frühzeitige Intervention und eine Kombination aus medizinischer und psychosozialer Betreuung verbessern die Heilungschancen deutlich.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Behandlung und Therapie von Essstörungen. Die Funktion der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1325914