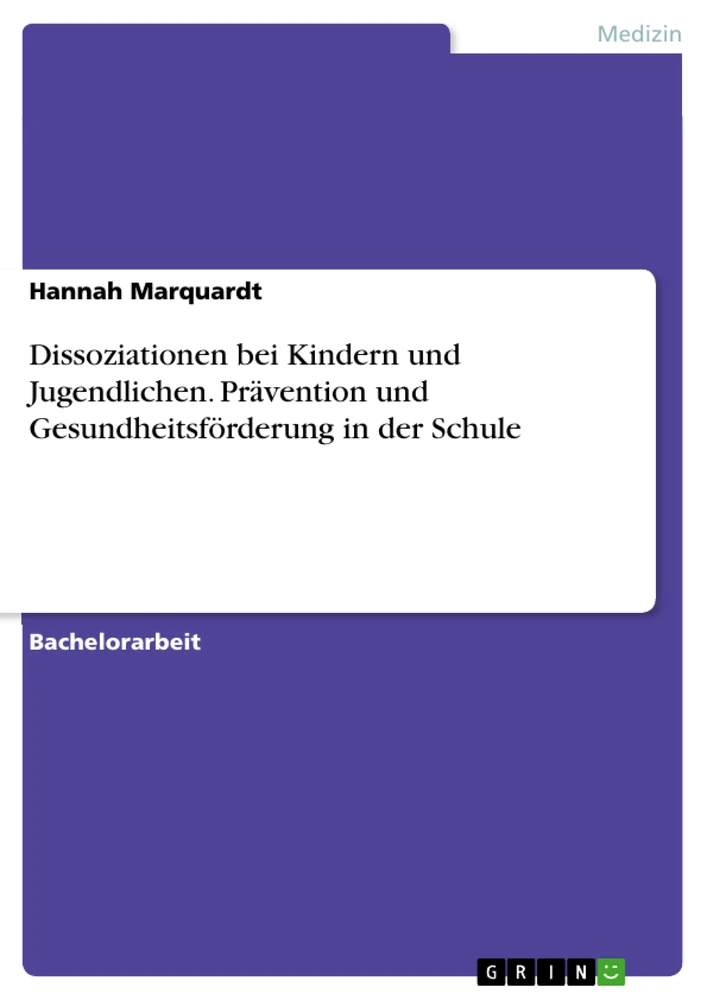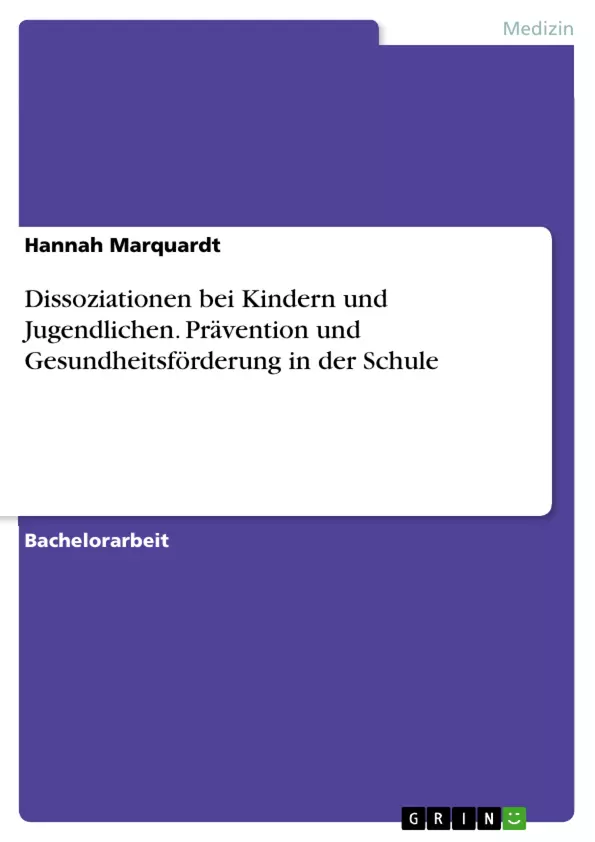Kinder und Jugendliche zeigen sich aufgrund mangelnder Copingstrategien sensibel für das Entstehen von dissoziativen Störungen. Aufgrund der vielen Zeit, die Lernende in der Schule verbringen, wird dieser Institution eine hohe Bedeutung bezüglich Prävention und Gesundheitsförderung beigemessen. Während es für andere psychische Erkrankungen bereits eine Menge präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen gibt, ist dies bei dissoziativen Störungen nicht der Fall. Um hierfür Maßnahmen zu entwickeln, benötigt es jedoch zunächst einmal den aktuellen Wissensstand über dissoziative Störungen an sich.
Das Ziel der Bachelorarbeit ist es daher, die Forschungsfragen zu beantworten, inwieweit angehende Lehrende in Deutschland Kenntnisse in Bezug auf dissoziative Störungen besitzen und ob angehende Lehrende weniger über dissoziative Störungen als, am Beispiel der Depressionen, über andere psychische Erkrankungen informiert sind. Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen ist eine quantitative Studie mittels Online-Umfragebogen zum aktuellen Kenntnisstand bei angehenden Lehrenden durchgeführt worden. Spezifisch haben die Befragten an einem Wissenstest teilgenommen sowie ihre Kenntnisse selbst eingeschätzt. Dabei hat sich diese Wissensabfrage sowohl auf dissoziative Störungen als auch auf Depressionen bezogen. Des Weiteren haben die Befragten die Relevanz dieser Störung für angehende Lehrende eingeschätzt und angegeben, ob sie sich mehr Informationen diesbezüglich wünschen würden.
Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass angehende Lehrende in Deutschland nur wenig bzw. wenig korrektes Wissen über dissoziative Störungen aufweisen und signifikant mehr Wissen über Depressionen als über dissoziative Störungen besitzen, wobei der Wunsch nach mehr Wissen und eine von angehenden Lehrenden erkennbare Relevanz dieser Störung für ihr Berufsfeld vorhanden ist. Eine Vorbildung im medizinischen, pädiatrischen, psychiatrischen oder psychosomatischen Bereich hat dabei keine Auswirkungen auf den Wissensstand gezeigt.
Dies hat zur Folge, dass eine Implementierung präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen zunächst vor allem im Bereich der Informationsvermittlung, z.B. in Form von Informationsveranstaltungen, innerhalb der Schule sinnvoll ist. Weiterführende Forschung könnte auf die Wirksamkeit von stressreduzierenden Maßnahmen auf die Prävention und Gesundheitsförderung dissoziativer Störungen ausgerichtet sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Dissoziative Störungen als Krankheitsbild
- 1.1.1 Definition
- 1.1.2 Formen und Symptome
- 1.1.3 Prävalenz
- 1.2 Aktueller Forschungsstand
- 1.3 Untersuchungsleitende Fragestellungen und Hypothesen
- 1.1 Dissoziative Störungen als Krankheitsbild
- 2. Methodik
- 2.1 Forschungsdesign
- 2.2 Stichprobe
- 2.3 Datenerhebungsinstrument
- 2.4 Datenerhebung
- 2.5 Datenauswertung
- 3. Ergebnisse
- 3.1 Stichprobencharakteristika
- 3.2 Prüfung der untersuchungsleitenden Hypothesen
- 3.3 Zusätzliche Untersuchungsergebnisse
- 4. Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, das Wissen angehender Lehrender in Deutschland über dissoziative Störungen zu untersuchen. Die Arbeit betrachtet, ob angehenden Lehrenden ausreichende Kenntnisse über dissoziative Störungen im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen, wie Depressionen, zur Verfügung stehen. Die Arbeit befasst sich mit den aktuellen Forschungsstand zu dissoziativen Störungen und untersucht das Wissen von angehenden Lehrenden anhand einer quantitativen Studie mit einem Online-Fragebogen. Die Studie befasst sich mit der Selbstbewertung des Wissens, objektiven Wissenstests sowie der wahrgenommenen Relevanz und dem Bedarf nach weiterer Information.
- Wissensstand angehender Lehrender über dissoziative Störungen
- Vergleich des Wissens über dissoziative Störungen mit dem Wissen über andere psychische Erkrankungen (z.B. Depressionen)
- Relevanz von dissoziativen Störungen im Kontext Schule
- Bedarf an präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen im Bereich dissoziativer Störungen
- Entwicklung von Interventions- und Präventionsmaßnahmen für Lehrende und Lernende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt eine Einführung in das Thema und stellt die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit vor. Kapitel 1 behandelt den theoretischen Hintergrund von dissoziativen Störungen. Es werden Definitionen, Formen und Symptome sowie die Prävalenz von dissoziativen Störungen erläutert. Außerdem wird der aktuelle Forschungsstand zu dissoziativen Störungen zusammengefasst.
Kapitel 2 beschreibt die Methodik der durchgeführten Studie. Es werden das Forschungsdesign, die Stichprobe, das Datenerhebungsinstrument, die Datenerhebung und die Datenauswertung erläutert.
Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die Stichprobencharakteristika vorgestellt, die untersuchungsleitenden Hypothesen geprüft und zusätzliche Ergebnisse dargestellt.
Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse der Studie und zieht Schlussfolgerungen. Es werden die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und für weitere Forschung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Dissoziative Störungen, Prävention, Gesundheitsförderung, Schule, Lehrende, Lernende, Wissen, Kenntnisse, Online-Umfrage, Wissenstest, Relevanz, Bedarf, Intervention, Prävention, Intervention
Häufig gestellte Fragen
Was sind dissoziative Störungen bei Kindern?
Es handelt sich um psychische Störungen, bei denen die Integration von Bewusstsein, Gedächtnis oder Identität unterbrochen ist, oft aufgrund mangelnder Copingstrategien bei Belastungen.
Wie viel wissen angehende Lehrer über Dissoziationen?
Die Studie zeigt, dass angehende Lehrende in Deutschland nur wenig korrektes Wissen über dissoziative Störungen besitzen, insbesondere im Vergleich zu Depressionen.
Warum ist die Schule ein wichtiger Ort für Prävention?
Da Lernende viel Zeit in der Schule verbringen, ist diese Institution prädestiniert für Gesundheitsförderung und das frühzeitige Erkennen psychischer Auffälligkeiten.
Wünschen sich Lehrer mehr Informationen zu diesem Thema?
Ja, die Untersuchung ergab einen deutlichen Wunsch nach mehr Wissen und eine hohe wahrgenommene Relevanz der Störung für das Berufsfeld der Lehrenden.
Welche Maßnahmen werden für die Schule empfohlen?
Sinnvoll ist zunächst eine verstärkte Informationsvermittlung durch Veranstaltungen sowie zukünftig die Implementierung stressreduzierender Maßnahmen.
Hat eine medizinische Vorbildung Einfluss auf den Wissensstand?
Überraschenderweise zeigte eine Vorbildung im pädiatrischen oder psychiatrischen Bereich in dieser Studie keine signifikanten Auswirkungen auf das Wissen über dissoziative Störungen.
- Quote paper
- Hannah Marquardt (Author), 2022, Dissoziationen bei Kindern und Jugendlichen. Prävention und Gesundheitsförderung in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326401