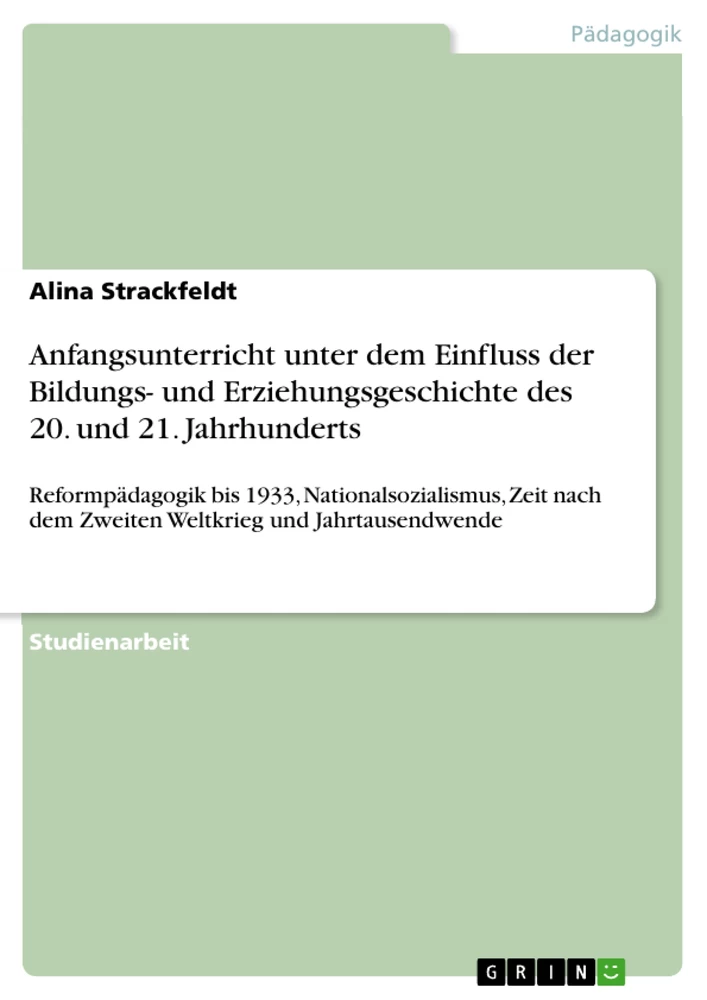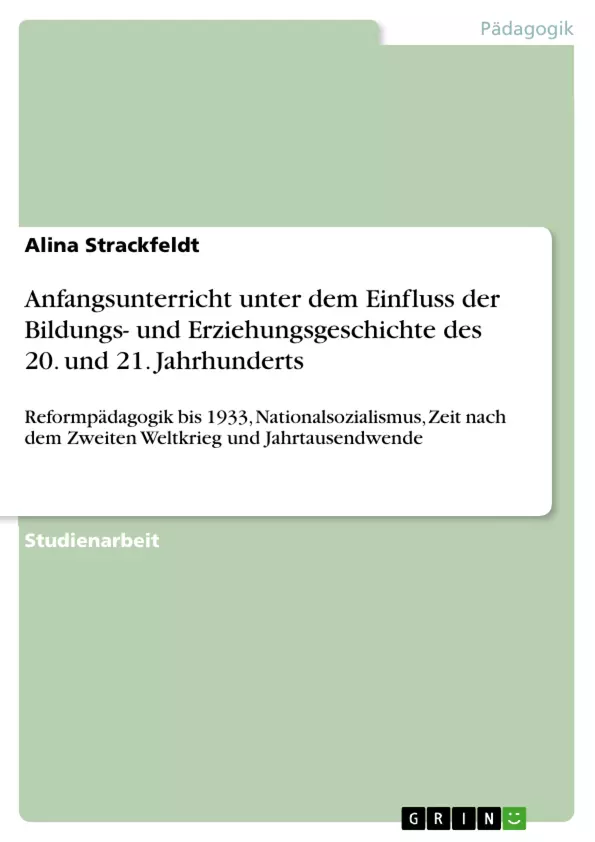Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, welche Veränderungen der Gestaltung des Anfangsunterrichts bei einem Vergleich von Lexikonbeiträgen aus den Jahren 1931 bis 1942, 1962 bis 1974 und 2000 bis 2012 deutlich werden. Im Folgenden werden theoretische Grundlagen zum Anfangsunterricht erläutert. Dazu wird zunächst ein kurzer Überblick über die Bildungs- und Erziehungsgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts gegeben. Weiterhin wird die Bedeutsamkeit des Anfangsunterrichts, sowie dessen curriculare Verankerung erläutert. Neben theoretischen Grundlagen zum Anfangsunterricht wird in Kapitel 3 die Beschreibung des methodischen Vorgehens erfolgen. Dazu erfolgen Begründungen der Forschungsfrage und der Quellenauswahl, sowie die Beschreibung der Forschungsmethode. Weiterhin erfolgt in Kapitel 3.4 die Auswahl und Darstellung der Analysekategorien. In Kapitel 4 schließt sich die eigentliche Quellenanalyse an. In einem abschließenden Fazit wird schließlich Rückschluss auf die Forschungsfrage genommen, eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, sowie ein Ausblick über ergänzende Forschungsmöglichkeiten und eine kritische Würdigung erfolgen.
Beate Leßmann beschreibt mit dem von ihr entwickelten Leßmann-Konzept die Relevanz des Anfangsunterrichts für die Schülerinnen und Schüler auf emotionaler, wie auch kognitiver Ebene. Die von ihr dargestellten Aspekte fassen nahezu gänzlich die motivationalen Aspekte zusammen, sich mit der Thematik und historischen Entwicklung des Anfangsunterrichts auseinanderzusetzen. Dem Bildungsbericht 2022 ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund und einem Alter von 3 Jahren in deutschen Kindertageseinrichtung im Zeitraum 2008 bis 2021 von 26,1 % auf 31% angestiegen ist. Gleichzeitig sank der Anteil der Kinder von Eltern, welche beide in Deutschland geboren wurden von 73,9 % auf 69. Innerhalb der 31 % der Kinder, von denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist, ist bei 21,1 % der Kinder Deutsch nicht die vorrangig gesprochene Familiensprache.
Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz von Anfangsunterricht im Hinblick auf sprachliche Heterogenität im Klassenraum. Sprachentwicklung ist nicht der einzige Aspekt von Anfangsunterricht, dennoch verdeutlicht er die Diversität der Schülerschaft und welche Schwierigkeiten beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule auftreten können. Ebenso wird deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit dem Wandel der Gesellschaft und dessen kulturelle Zusammensetzung Auswirkungen auf Schule und damit auch den Anfangsunterricht haben. Vorschulisches Lernen beginnt bereits in der Kindertagesstätte und schließlich ist es Aufgabe der Grundschule dieses Vorwissen aufzugreifen, weiterzuentwickeln und allen Schülerinnen und Schülern ein anschlussfähiges Lernen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Motivation
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Theoretische Grundlagen zum Anfangsunterricht
- 2.1 Bildungs- und Erziehungsgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts
- 2.1.1 Reformpädagogische Bewegung bis 1933
- 2.1.2 Die Zeit des Nationalsozialismus
- 2.1.3 Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.1.4 Die Zeit um und nach der Jahrtausendwende
- 2.2 Bedeutsamkeit und Aufgaben des Anfangsunterrichts
- 2.3 Curriculare und gesetzliche Verankerung
- 3 Methodisches Vorgehen
- 3.1 Begründung der Forschungsfrage
- 3.2 Begründung der Quellenauswahl
- 3.3 Beschreibung der Forschungsmethode
- 3.4 Analysekategorien
- 4 Quellenanalyse
- 4.1 Vorstellung der Quellen
- 4.2 Analysekategorie 1 „Formale Aspekte“
- 4.3 Analysekategorie 2 „Motivationale Aspekte“
- 4.4 Analysekategorie 3 „Psychosoziale Aspekte“
- 5 Fazit, Ausblick und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Gestaltung des Anfangsunterrichts im 20. und 21. Jahrhundert. Mithilfe der Analyse von Lexikonbeiträgen aus drei verschiedenen Zeiträumen (1931-1942, 1962-1974 und 2000-2012) sollen die Veränderungen des Anfangsunterrichts in Bezug auf seine formalen, motivationalen und psychosozialen Aspekte untersucht werden.
- Entwicklung des Anfangsunterrichts im historischen Kontext
- Einfluss der Reformpädagogik, des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit
- Veränderungen in der Gestaltung des Unterrichts und der Lerninhalte
- Motivationale und psychosoziale Aspekte des Anfangsunterrichts
- Aktuelle Herausforderungen des Anfangsunterrichts im Kontext der sprachlichen Heterogenität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung und Motivation der Arbeit ein. Es wird die Relevanz des Anfangsunterrichts für die Entwicklung und das Lernen von Kindern hervorgehoben und die aktuelle Situation der sprachlichen Heterogenität im Bildungssystem beleuchtet.
Kapitel 2 bietet einen theoretischen Überblick über die Bildungs- und Erziehungsgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, wobei die Reformpädagogik, die Zeit des Nationalsozialismus und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie die Entwicklungen um die Jahrtausendwende im Fokus stehen. Außerdem werden die Bedeutsamkeit und Aufgaben des Anfangsunterrichts, sowie seine curriculare und gesetzliche Verankerung dargestellt.
Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es werden die Begründung der Forschungsfrage, die Quellenauswahl, die Forschungsmethode und die Analysekategorien erläutert.
Kapitel 4 beinhaltet die Analyse der ausgewählten Quellen. Die Untersuchung konzentriert sich auf drei Analysekategorien: Formale Aspekte, motivationale Aspekte und psychosoziale Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Anfangsunterricht historisch verändert?
Die Arbeit vergleicht drei Epochen (1931-1942, 1962-1974, 2000-2012) und zeigt den Wandel von reformpädagogischen Ansätzen über die NS-Zeit bis hin zur modernen Förderung.
Welchen Einfluss hatte die Reformpädagogik vor 1933?
Die reformpädagogische Bewegung legte den Grundstein für kindzentriertes Lernen und eine stärkere Berücksichtigung der emotionalen Bedürfnisse der Schulanfänger.
Wie wirkt sich sprachliche Heterogenität auf den heutigen Anfangsunterricht aus?
Durch den Anstieg von Kindern mit Migrationshintergrund (ca. 31%) gewinnt die Sprachförderung und der Umgang mit Diversität im Klassenzimmer massiv an Bedeutung.
Was sind die Aufgaben des modernen Anfangsunterrichts?
Er soll den Übergang von der Kita zur Schule begleiten, Vorwissen aufgreifen und allen Kindern ein anschlussfähiges Lernen auf emotionaler und kognitiver Ebene ermöglichen.
Wie wurden die Quellen für diese Untersuchung ausgewählt?
Die Analyse basiert auf dem Vergleich von Lexikonbeiträgen aus verschiedenen Zeiträumen, um offizielle pädagogische Leitbilder zu rekonstruieren.
Was ist das Leßmann-Konzept?
Ein Konzept von Beate Leßmann, das die Relevanz des Anfangsunterrichts für Schüler sowohl auf emotionaler als auch auf kognitiver Ebene betont.
- Arbeit zitieren
- Alina Strackfeldt (Autor:in), 2022, Anfangsunterricht unter dem Einfluss der Bildungs- und Erziehungsgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326466