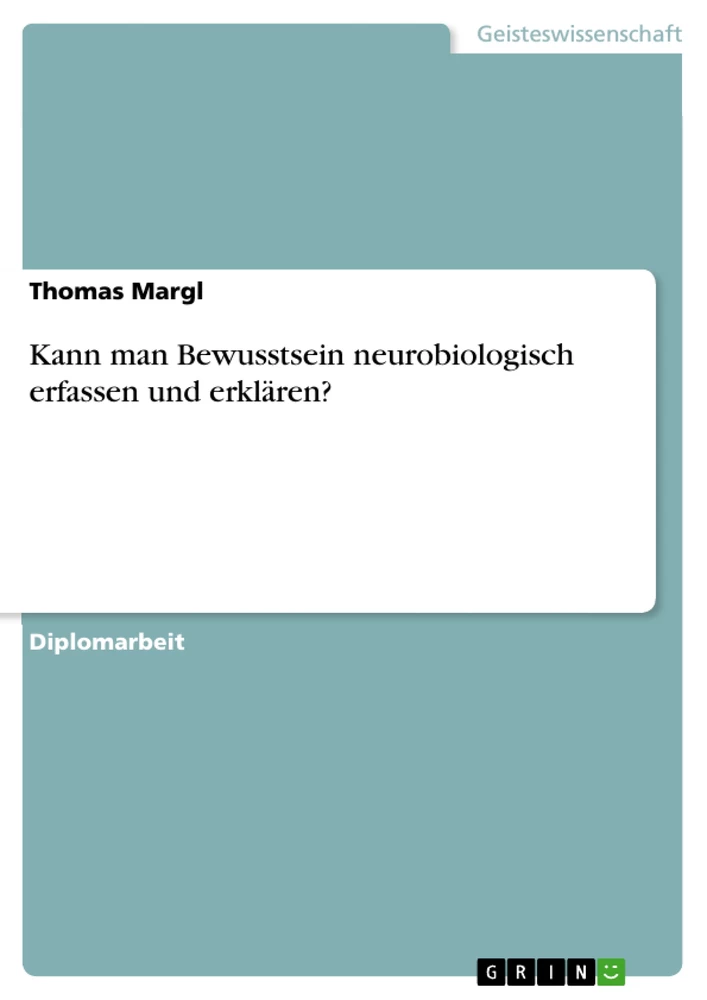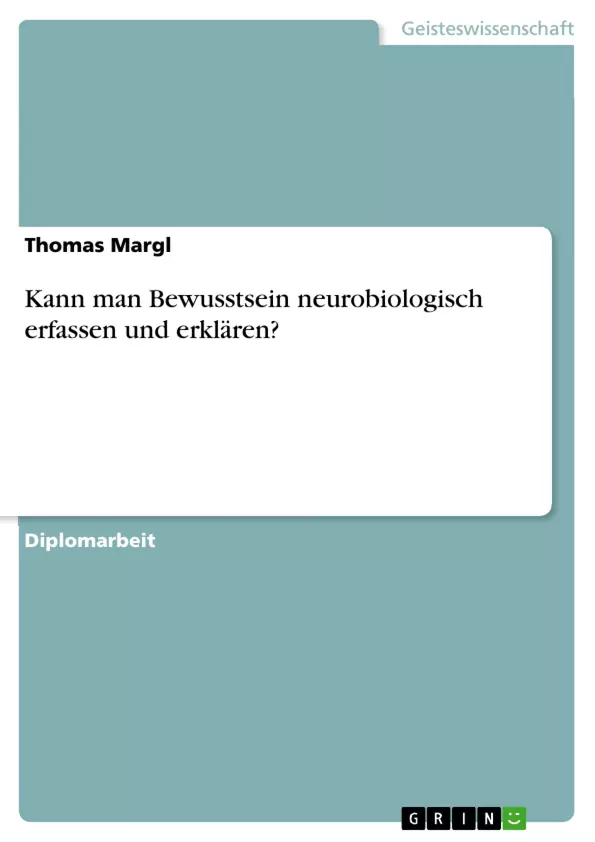„Dies Neue, Unbegreifliche, ist das Bewusstsein. Ich werde jetzt, wie ich glaube, in sehr zwingender Weise dartun, dass […] das Bewusstsein aus seinen materiellen Bedingungen nicht erklärbar ist, was wohl jeder zugibt, sondern auch, dass es der Natur der Dinge nicht aus diesen nicht erklärbar sein wird. Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglich nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen, […] und der ebenso unmittelbar schließenden Gewissheit, also bin ich. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammenwirken [der Atome] Bewusstsein entstehen könnte.“ (Auszug aus der Rede von Emil Du Bois-Reymond, 1872 vor der Tagung der Naturforscher und Ärzte)
In dieser Rede äußert Du Bois-Reymond schon den begründeten Zweifel, ob man jemals zu einer reduktionistischen Lösung des Leib-Seele-Konflikts kommen kann. Seit dem letzten Jahrhundert gibt es viele Thesen, die den Zusammenhang zwischen phänomenalen Gegenständen und einer materiellen Basis - deren Resultat sie sind - darstellen sollen: sowohl reduktionistische als auch nicht-reduktionistische Thesen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Leib-Seele-Problem im aktuellen Spannungsfeld von Philosophie und Neurobiologie. Zwischen diesen beiden (rivalisierenden) Wissenschaften herrscht keine Klarheit über die Aufgabenteilung bei einer Lösungsfindung. Gerade aus dieser Konkurrenz heraus entsteht ein beträchtliches Konfliktpotential, aber auch die Möglichkeit, neue Wege zu gehen.
Diese Arbeit versucht zu zeigen, wie moderne kognitive Neurowissenschaften sich um die Beantwortung des Problems bemühen. Es geht vor allem um eine kritische Durchleuchtung der Probleme, die bei diesen Lösungsversuchen entstehen. Die Problematik soll anhand der Thesen des Neurobiologen Wolf Singer aufgezeigt werden. Sein Ansatz ist grundsätzlich nicht reduktionistisch. Für ihn sind Bewusstsein, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit für höchste kognitive Leistungen Ergebnis eines evolutionären Prozesses. Durch Iteration, der immer gleichen Anwendung auf sich selbst, bilden sich im evolutionären Prozess immer komplexer ausgeformte emergente Ebenen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- L-S-PROBLEM IM SPANNUNGSFELD PHILOSOPHIE – NEUROBIOLOGIE
- Aktualität des Leib-Seele-Problems
- In wessen Kompetenzbereich fällt das Leib-Seele-Problem
- Die Aufgabe der Philosophie - Was ist die Aufgabe der Neurobiologie
- DAS LEIB-SEELE-PROBLEM
- Wo sind die grundlegenden Probleme?
- Kulturelle Vorraussetzungen für das Leib-Seele-Problem
- DUALISMUS
- Substanzdualismus
- Eigenschaftsdualismus
- Kritikpunkte am Dualismus
- MATERIALISMUS
- Reduktionistischer Physikalismus
- Nichtreduktionistischer Physikalismus
- Kritik am Materialismus
- ALLGEMEINE THEORIEN ZUM GEIST-KÖRPER-ZUSAMMENHANG
- Die Theorie der Supervenienz
- Die Vorteile der Supervenienz in der Neurophilosophie
- Die Theorie der Emergenz
- Schwache Emergenz
- Starke Emergenz
- Emergenz im Bereich kognitiver Neurowissenschaften
- SINGERS KONZEPT DER GEISTENTSTEHUNG
- Evolution und Aufbau des Gehirns
- Die Organisation der Ebene des Nervensystems
- Wie wird Mentales im Gehirn repräsentiert?
- Von Repräsentationen zum Bewusstsein
- Metarepräsentation
- Nutzen der Metarepräsentation
- Ich-Erfahrung und Selbstkonzept
- Frühkindliche Ontogenese
- Gene und Gelerntes
- Die Ebene des Geistes
- KRITISCHER TEIL
- Grundlegende kritische Betrachtung der Emergenztheorie
- Kritische Analyse der Verwendung der Emergenztheorie bei Singer
- Wie versteht Singer Emergenz?
- FEHLER UND UNZULÄNGLICHKEITEN IN DER BEGRIFFSSPRACHE
- Naturalistische Fehlschlüsse und Hermeneutische Projektionen
- Begriffliche Fehler
- Begriffliche Fehler vermeiden
- ÜBERGANG VON ERSTER-PERSON ZU DRITTER-PERSON
- Brückentheorien
- Erste-Person versus Dritte-Person
- Erklärungslückenproblematik
- Wie versteht Singer das Phänomen des subjektiven Erlebens?
- Das „,Innere Auge"
- Das Selbst als Soziales Konstrukt
- Sozial vermittelte Phänomenale Gegenstände
- KONKLUSIO
- Was wurde geklärt?
- Welche Fragen bleiben offen?
- Abschließende Worte
- LITERATURLISTE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Thomas Margl befasst sich mit der Frage, ob Bewusstsein neurobiologisch erfasst und erklärt werden kann. Sie analysiert das Leib-Seele-Problem im Spannungsfeld von Philosophie und Neurobiologie und untersucht, wie moderne kognitive Neurowissenschaften sich um eine Lösung bemühen. Die Arbeit fokussiert auf die kritische Durchleuchtung der Probleme, die bei diesen Lösungsversuchen entstehen, und analysiert den Ansatz des Neurobiologen Wolf Singer, der Bewusstsein als Ergebnis eines evolutionären Prozesses betrachtet.
- Das Leib-Seele-Problem im Kontext von Philosophie und Neurobiologie
- Kritik an reduktionistischen und nicht-reduktionistischen Theorien zur Erklärung des Bewusstseins
- Analyse der Emergenztheorie und ihrer Anwendung in der Neurophilosophie
- Die Rolle von Metarepräsentation und Selbstkonzept bei der Entstehung von Bewusstsein
- Die Problematik des Übergangs von der ersten zur dritten Person in der Bewusstseinsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Leib-Seele-Problem und seine Aktualität im Kontext der modernen Neurowissenschaften dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Philosophie und Neurobiologie auf die Frage nach dem Bewusstsein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
Das Kapitel „L-S-Problem im Spannungsfeld Philosophie – Neurobiologie“ analysiert die unterschiedlichen Kompetenzbereiche von Philosophie und Neurobiologie im Hinblick auf das Leib-Seele-Problem. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Problems und die Herausforderungen, die sich aus der Konkurrenz der beiden Disziplinen ergeben.
Das Kapitel „DAS LEIB-SEELE-PROBLEM“ untersucht die grundlegenden Probleme, die mit der Erklärung des Bewusstseins verbunden sind. Es beleuchtet die kulturellen Voraussetzungen für das Leib-Seele-Problem und die verschiedenen philosophischen Positionen, die sich mit der Frage nach dem Verhältnis von Geist und Körper auseinandersetzen.
Das Kapitel „DUALISMUS“ analysiert die verschiedenen Formen des Dualismus, insbesondere den Substanzdualismus und den Eigenschaftsdualismus. Es beleuchtet die Kritikpunkte, die gegen den Dualismus vorgebracht werden, und zeigt die Grenzen seiner Erklärungskraft auf.
Das Kapitel „MATERIALISMUS“ untersucht die verschiedenen Formen des Materialismus, insbesondere den reduktionistischen Physikalismus und den nichtreduktionistischen Physikalismus. Es beleuchtet die Kritikpunkte, die gegen den Materialismus vorgebracht werden, und zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus der Reduktion des Geistes auf Materie ergeben.
Das Kapitel „ALLGEMEINE THEORIEN ZUM GEIST-KÖRPER-ZUSAMMENHANG“ stellt die Theorien der Supervenienz und der Emergenz vor. Es analysiert die Vorteile der Supervenienz in der Neurophilosophie und beleuchtet die verschiedenen Formen der Emergenz, insbesondere die schwache und die starke Emergenz.
Das Kapitel „SINGERS KONZEPT DER GEISTENTSTEHUNG“ stellt das Konzept des Neurobiologen Wolf Singer zur Entstehung des Bewusstseins vor. Es beleuchtet die evolutionäre Entwicklung des Gehirns, die Organisation des Nervensystems und die Rolle von Repräsentationen und Metarepräsentationen bei der Entstehung von Bewusstsein.
Das Kapitel „KRITISCHER TEIL“ analysiert die Emergenztheorie und ihre Anwendung in der Neurophilosophie. Es beleuchtet die kritischen Punkte, die gegen die Emergenztheorie vorgebracht werden, und untersucht, wie Wolf Singer die Emergenz versteht.
Das Kapitel „FEHLER UND UNZULÄNGLICHKEITEN IN DER BEGRIFFSSPRACHE“ analysiert die Fehler und Unzulänglichkeiten in der Begriffssprache, die bei der Erklärung des Bewusstseins auftreten. Es beleuchtet die Problematik von naturalistischen Fehlschlüssen und hermeneutischen Projektionen und zeigt, wie man begriffliche Fehler vermeiden kann.
Das Kapitel „ÜBERGANG VON ERSTER-PERSON ZU DRITTER-PERSON“ untersucht die Problematik des Übergangs von der ersten zur dritten Person in der Bewusstseinsforschung. Es analysiert die verschiedenen Brückentheorien, die diese Problematik zu lösen versuchen, und beleuchtet die Erklärungslücken, die sich aus der Perspektive der dritten Person ergeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Leib-Seele-Problem, Bewusstsein, Neurobiologie, Philosophie, kognitive Neurowissenschaften, Emergenztheorie, Metarepräsentation, Selbstkonzept, Wolf Singer, erste Person, dritte Person, Erklärungslückenproblematik.
- Quote paper
- Magister Thomas Margl (Author), 2009, Kann man Bewusstsein neurobiologisch erfassen und erklären?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132689