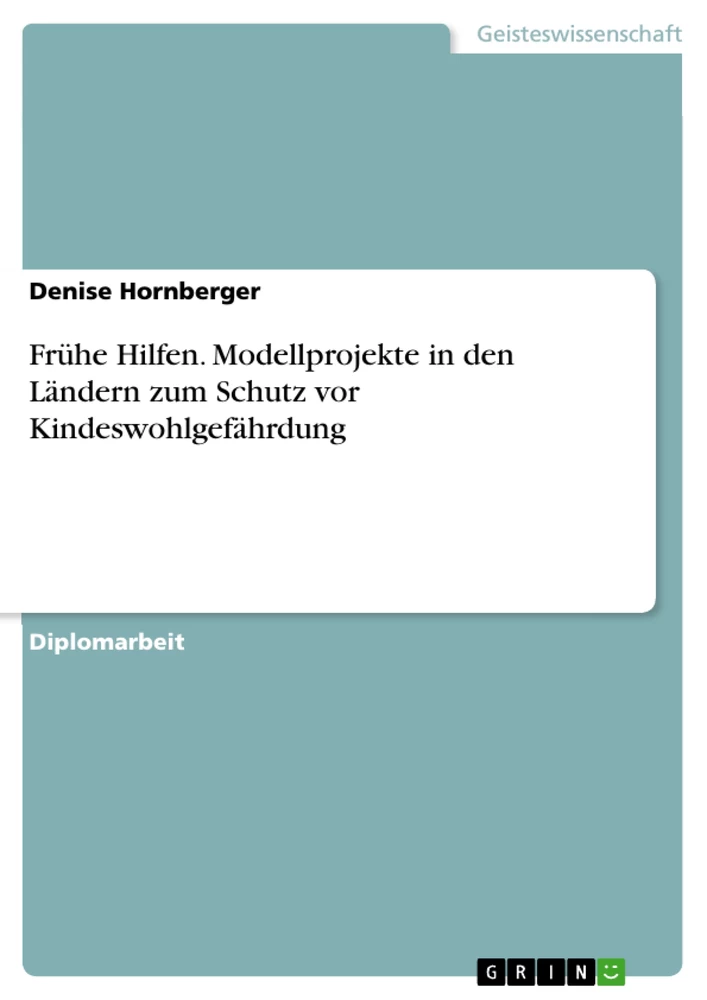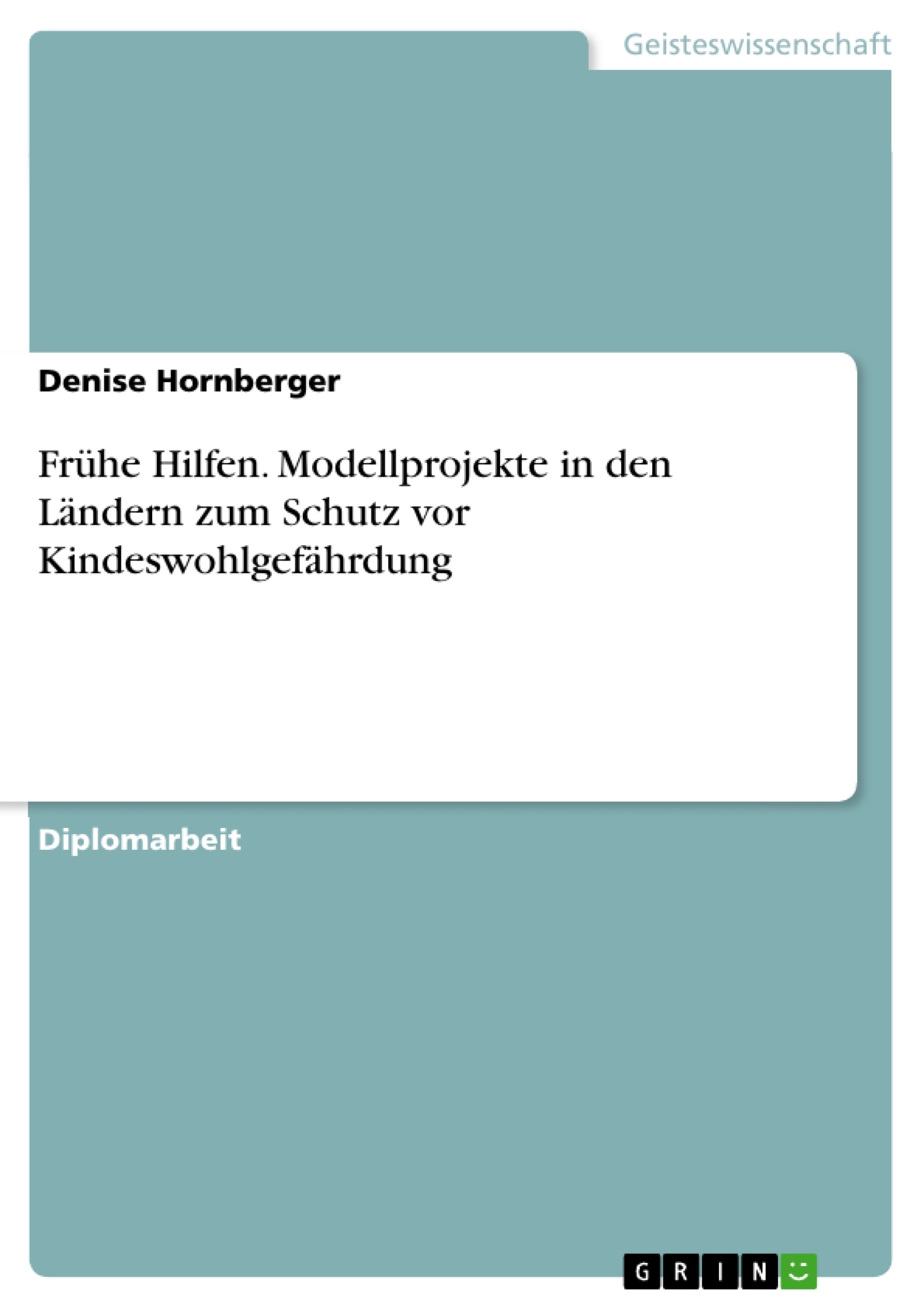In den letzten Jahren wird die Öffentlichkeit vermehrt mit dramatischen Medienberichten über misshandelte sowie vernachlässigte Kinder konfrontiert. Manche dieser Fälle endeten tödlich und nicht selten waren die eigenen Eltern die Täter. „Vater misshandelt Baby fast zu Tode“ , „Eltern kommen wegen Mordes vor Gericht“ , „Lea Sophie ist verhungert und verdurstet“ sind nur einige der Schlagzeilen, welche in den Zeitungsberichten auftauchten. Die Berichte schockieren und gleichzeitig steigt der Druck auf die Politiker, Maßnahmen zu treffen, um Kinder vor diesen Gefahren zu schützen. Nach der Vergleichsstudie „Child Maltreatment Deaths in Rich Nations“ im August 2003, sterben jedes Jahr 3500 Kinder aus den OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) -Ländern an den Folgen von Misshandlung und Vernachlässigung. Wie viele Fälle von nicht tödlichen Misshandlungen in Deutschland vorliegen, ist aus der Studie nicht erkennbar. Ein Artikel der Zeit beruft sich auf Zahlen des Bundeskriminalamtes. Danach sollen im Jahr 2005 2905 Kinder Opfer von Misshandlungen und 1178 Kinder Opfer von Vernachlässigung geworden sein. Die Experten sind sich jedoch sicher, dass die Dunkelziffer über 90 % ausmacht. Im Jahr 2007, während meines Praktikums beim Jugendamt, habe ich mir die Frage gestellt was auf politischer Ebene unternommen wird, um Kinder besser vor Gefährdungen zu schützen. Ich wurde dabei auf das Aktionsprogramm der Bundesregierung „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ aufmerksam, welches im selben Jahr ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen des Aktionsprogramms starteten in ganz Deutschland zehn Modellprojekte, die wissenschaftlich begleitet werden. Diese streben eine bessere Vernetzung zwischen Gesundheitshilfe und Jugendhilfe an, um rechtzeitig Belastungen in Familien zu erkennen und somit präventiv gegen Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern vorzugehen. In Anlehnung an verschiedene Nachrichtenblätter, war der Tod des zweieinhalbjährigen Kevin, im Oktober 2006 in Bremen, Auslöser für die Initiierung des Programms. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete am 13.10.2006 „die Bundesregierung beschleunigt angesichts des Falls des tot aufgefundenen Bremer Jungen ihre Aktivitäten zum Schutz vor Vernachlässigten Kindern.“
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Kindeswohlgefährdung
- Kindesmisshandlung
- Vernachlässigung
- Psychische Misshandlung
- Physische Misshandlung
- Theoretische Grundlagen
- Folgen von Vernachlässigung und Misshandlung
- Risiken für eine Gefährdung
- Mannheimer Risikostudie
- Bedürfnisse des Kindes
- Rechtliche Grundlagen
- Rechte der Kinder
- Interventionsmöglichkeiten der Jugendhilfe
- Ausgangslage des Aktionsprogramms
- Vereinbarungen der Bundesregierung
- Aktivitäten der Länder
- Diskussion um verbindliche Früherkennungsuntersuchungen
- Frühe Hilfen
- Erläuterung Frühe Hilfen und soziale Frühwarnsysteme
- Soziale Frühwarnsysteme
- Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen
- Kooperation im Bereich Frühe Hilfen
- Kooperation Gesundheitssystem und Jugendhilfe
- Datenschutzrechtliche Aspekte
- Datenermittlung und -weitergabe in der Jugendhilfe
- Datenermittlung und -weitergabe im Gesundheitswesen
- Bestandaufnahme zu Kooperationsformen im Bereich Frühe Hilfen
- Anforderungen an Frühe Hilfen und soziale Frühwarnsysteme
- Die Bekanntmachung
- Die Anforderungen der Bundesregierung
- Das Netzwerk Frühe Hilfen
- Die Modellprojekte
- „Soziale Frühwarnsysteme in NRW“ und „Schutzengel für Schleswig-Holstein"
- Allgemeines
- Die Elternberatungsstelle der Stadt Gütersloh
- Fazit
- Keiner fällt durchs Netz: Saarland, Hessen
- Allgemeines
- Ziele und Zielgruppen
- Angebote
- Die wissenschaftliche Begleitung
- Fazit
- Guter Start ins Kinderleben: Baden Württemberg, Rheinland- Pfalz, Bayern, Thüringen
- Allgemeines
- Ziele und Zielgruppen
- Angebote
- Die wissenschaftliche Begleitung
- Fazit
- Pro Kind: Niedersachsen, Bremen, Sachsen
- Allgemeines
- Ziele und Zielgruppen
- Angebote
- Die wissenschaftliche Begleitung
- Fazit
- Wie Elternschaft gelingt: Wiege – STEEP™. Brandenburg, Hamburg
- Allgemeines
- Ziele und Zielgruppen
- Angebote
- Die wissenschaftliche Begleitung
- Fazit
- Übersicht über die Modellprojekte in den Ländern
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Frühe Hilfen und den Modellprojekten in den Ländern zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze und Konzepte der Frühen Hilfen in den Bundesländern zu analysieren und zu bewerten. Dabei werden die rechtlichen Grundlagen, die Anforderungen an Frühe Hilfen und soziale Frühwarnsysteme sowie die Herausforderungen der Kooperation zwischen Gesundheitssystem und Jugendhilfe beleuchtet.
- Rechtliche Grundlagen und Interventionsmöglichkeiten der Jugendhilfe
- Frühe Hilfen und soziale Frühwarnsysteme als Präventionsansatz
- Kooperation zwischen Gesundheitssystem und Jugendhilfe
- Datenschutzrechtliche Aspekte im Kontext von Frühen Hilfen
- Bewertung der Modellprojekte in den Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Definition von Kindeswohlgefährdung und Kindesmisshandlung, wobei verschiedene Formen der Misshandlung wie Vernachlässigung, psychische und physische Misshandlung erläutert werden. Im Anschluss werden die theoretischen Grundlagen von Kindeswohlgefährdung beleuchtet, einschließlich der Folgen von Vernachlässigung und Misshandlung, der Risikofaktoren für eine Gefährdung und der Mannheimer Risikostudie. Die Arbeit beleuchtet auch die rechtlichen Grundlagen, insbesondere die Rechte der Kinder und die Interventionsmöglichkeiten der Jugendhilfe.
Im weiteren Verlauf wird das Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Stärkung der Frühen Hilfen vorgestellt, einschließlich der Vereinbarungen der Bundesregierung, der Aktivitäten der Länder und der Diskussion um verbindliche Früherkennungsuntersuchungen. Die Arbeit erläutert die Konzepte von Frühen Hilfen und sozialen Frühwarnsystemen und stellt das Nationale Zentrum Frühe Hilfen vor. Es werden die Herausforderungen der Kooperation zwischen Gesundheitssystem und Jugendhilfe im Bereich Frühe Hilfen beleuchtet, einschließlich der datenschutzrechtlichen Aspekte.
Die Diplomarbeit analysiert die Anforderungen an Frühe Hilfen und soziale Frühwarnsysteme, einschließlich der Bekanntmachung, der Anforderungen der Bundesregierung und des Netzwerks Frühe Hilfen. Im Mittelpunkt stehen die Modellprojekte in den Ländern, die in der Arbeit detailliert vorgestellt werden. Die Arbeit beleuchtet die Ziele, Zielgruppen, Angebote und die wissenschaftliche Begleitung der einzelnen Projekte. Die Arbeit schließt mit einem Resümee, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die Bedeutung von Frühen Hilfen für den Schutz von Kindern vor Kindeswohlgefährdung hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Frühe Hilfen, Kindeswohlgefährdung, Kindesmisshandlung, Prävention, Jugendhilfe, Gesundheitssystem, Kooperation, Datenschutz, Modellprojekte, Bundesländer, wissenschaftliche Begleitung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Frühe Hilfen" im Kinderschutz?
Frühe Hilfen sind präventive Angebote für Eltern und Kinder, die darauf abzielen, Belastungen in Familien frühzeitig zu erkennen und Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung oder Misshandlung zu verhindern.
Welche Rolle spielt die Kooperation zwischen Gesundheitshilfe und Jugendhilfe?
Eine enge Vernetzung ist entscheidend, um medizinische Früherkennungsuntersuchungen mit sozialen Unterstützungsangeboten zu verknüpfen und so ein lückenloses Schutznetz zu weben.
Was war der Auslöser für das Aktionsprogramm der Bundesregierung?
Dramatische Fälle von Kindesmisshandlung, insbesondere der Tod des Jungen Kevin in Bremen im Jahr 2006, beschleunigten die politischen Aktivitäten zum Schutz vernachlässigter Kinder.
Welche datenschutzrechtlichen Hürden gibt es bei Frühen Hilfen?
Die Weitergabe von Daten zwischen dem Gesundheitswesen (ärztliche Schweigepflicht) und der Jugendhilfe ist streng reglementiert und erfordert klare gesetzliche Grundlagen für den Informationsaustausch im Gefährdungsfall.
Was leisten die Modellprojekte in den Bundesländern?
Projekte wie "Schutzengel" oder "Pro Kind" erproben verschiedene Ansätze wie aufsuchende Hilfe durch Familienhebammen und werden wissenschaftlich begleitet, um ihre Wirksamkeit zu prüfen.
- Quote paper
- Denise Hornberger (Author), 2009, Frühe Hilfen. Modellprojekte in den Ländern zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132771