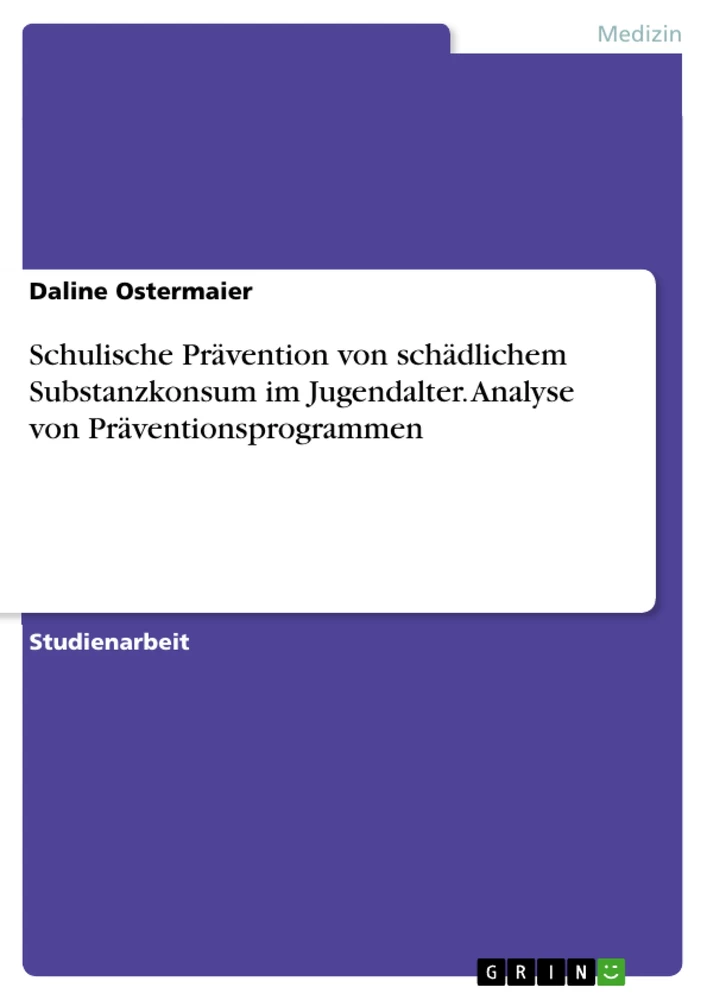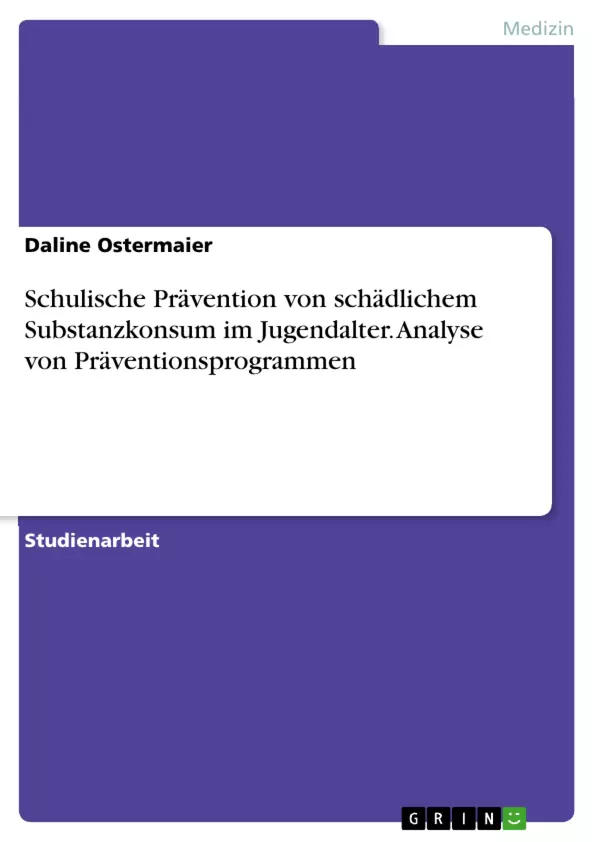Die Arbeit soll daher der Forschungsfrage nachgehen, inwieweit sich bereits niederschwellige und einfache Maßnahmen zur schulischen Prävention von schädlichem Substanzgebrauch eignen. Hierfür sollen insgesamt drei Beispielprogramme herangezogen werden, um diese hinsichtlich der theoretischen Fundierung, der Wirksamkeit und der Praktikabilität zu vergleichen.
Theorien und Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung gesundheitsbezogenen Verhaltens bilden eine grundlegende Säule zur Konstruktion und Evaluation präventiver Interventionsprogramme. Ein relevantes Einsatzgebiet solcher Programme ist die Prävention von Substanzkonsum im Jugendalter. Je nach Substanz und Konsummuster geht ein erhebliches Gesundheitsrisiko von psychotropen Substanzen aus. Während die akute Intoxikation u. a. das Risiko einer Überdosierung birgt, gefährden insbesondere auch substanz-bedingte Folgeerkrankungen die Gesundheit. So steht die in Deutschland am häufigsten konsumierte Substanz Alkohol mit zahlreichen psychiatrischen, neurologischen und internistischen Erkrankungen in Verbindung. Insgesamt sind in Industrieländern etwa 30 % aller Todesfälle in der Population der 15-29-Jährigen auf Substanzkonsum zurückzuführen. Fatal ist zudem, dass das Einstiegsalter bezüglich des Alkohol- oder Tabakkonsums zu sinken scheint. Da Kinder und Jugendliche einen große Zeitraum ihres außerfamiliären Lebens in der Schule verbringen, kommt der Implementierung von effektiven schulbasierten Programmen, die den Konsum von psychotropen Substanzen vorbeugen, eine besondere Bedeutung zu.
Zu Beginn dieser Arbeit wird zunächst auf den zentralen Begriff der Prävention eingegangen, um die für den weiteren Verlauf relevanten Fachbegriffe zu definieren. Den Kern des Theorieteils bildet jedoch die Zusammenstellung wichtiger störungsspezifischer Informationen rund um das Störungsbild des schädlichen Substanzgebrauchs, wobei sich hier möglichst auf das Alter der Adoleszenz konzentriert wird. Neben einer Definition des Störungsbegriffs liefert dieses Kapitel Daten zur Verbreitung von Substanzkonsum im Jugendalter, um die Relevanz für präventive Maßnahmen zu verdeutlichen. Außerdem werden ätiologische sowie gesundheitspsychologische Modelle und Theorien angerissen, da diese für die Konstruktion und Evaluation von Interventionsprogrammen eine wichtige Rolle spielen. Im Anwendungsteil erfolgt nach einer knappen Einführung in das Thema schulische Suchtprävention eine Auseinandersetzung mit den Programmen "Aktion Glasklar", "Be Smart – Don’t Start" sowie "Unplugged". Zunächst wird jede Maßnahme einzeln beleuchtet, damit im Anschluss ein zusammenfassender Vergleich angestellt werden kann. Die Diskussion beinhaltet eine abschließende Empfehlung in Bezug auf die analysierten Programme sowie eine knappe kritische Reflexion des eigenen Vorgehens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieteil
- Prävention: Definition
- Schädlicher Substanzkonsum im Jugendalter
- Klassifikation „schädlicher Gebrauch“
- Epidemiologie des Substanzkonsums im Jugendalter
- Ätiologie von Substanzkonsumstörungen
- Relevante gesundheitspsychologische Modelle
- Zusammenfassung des Theorieteils
- Anwendungsteil
- Suchtprävention im Setting Schule
- Präventionsprogramm „Aktion Glasklar“
- Allgemeine Informationen
- Evaluation
- Präventionsprogramm „Be Smart - Don't Start“
- Allgemeine Informationen
- Evaluation
- Präventionsprogramm „Unplugged“
- Allgemeine Informationen
- Evaluation
- Zusammenfassender Vergleich der Programme
- Diskussion
- Empfehlungen zum Einsatz der untersuchten Programme
- Kritische Reflexion des Vorgehens
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Suchtprävention im Jugendalter und analysiert verschiedene Präventionsprogramme, die im Setting Schule eingesetzt werden. Dabei wird die Wirksamkeit der Programme anhand wissenschaftlicher Studien untersucht und ein umfassender Vergleich der einzelnen Ansätze erstellt. Die Arbeit trägt dazu bei, die wissenschaftliche Grundlage für die Auswahl und Implementierung effektiver Suchtpräventionsmaßnahmen im schulischen Kontext zu stärken.
- Definition und Klassifikation schädlichen Substanzkonsums im Jugendalter
- Epidemiologie und Ätiologie von Substanzkonsumstörungen
- Relevante gesundheitspsychologische Modelle zur Erklärung von Substanzkonsum
- Evaluierung verschiedener Suchtpräventionsprogramme im Schulsetting
- Empfehlungen für den Einsatz effektiver Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Suchtprävention im Jugendalter ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie stellt die Forschungsfrage und die Ziele der Arbeit vor.
- Theorieteil: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden theoretischen Rahmen für die Arbeit. Es definiert den Begriff „schädlicher Substanzkonsum“ im Jugendalter, beleuchtet die Epidemiologie und Ätiologie von Substanzkonsumstörungen und stellt relevante gesundheitspsychologische Modelle vor, die die Entwicklung von Suchtverhalten erklären.
- Anwendungsteil: In diesem Kapitel werden verschiedene Suchtpräventionsprogramme, die im Setting Schule eingesetzt werden, vorgestellt und analysiert. Es werden die Programme „Aktion Glasklar“, „Be Smart - Don’t Start“ und „Unplugged“ genauer betrachtet. Die Kapitel befassen sich mit der jeweiligen Zielgruppe, den Programminhalten, den Evaluationsergebnissen und der Wirksamkeit der Programme.
- Diskussion: Das Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Analyse der einzelnen Programme und stellt Empfehlungen für den Einsatz der untersuchten Programme im schulischen Kontext auf.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, Jugendalter, Substanzkonsum, Schule, Präventionsprogramme, Wirksamkeit, Evaluation, gesundheitspsychologische Modelle, Aktion Glasklar, Be Smart - Don’t Start, Unplugged, BZgA, HAPA, SE, SKT.
- Arbeit zitieren
- Daline Ostermaier (Autor:in), 2023, Schulische Prävention von schädlichem Substanzkonsum im Jugendalter. Analyse von Präventionsprogrammen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1327822