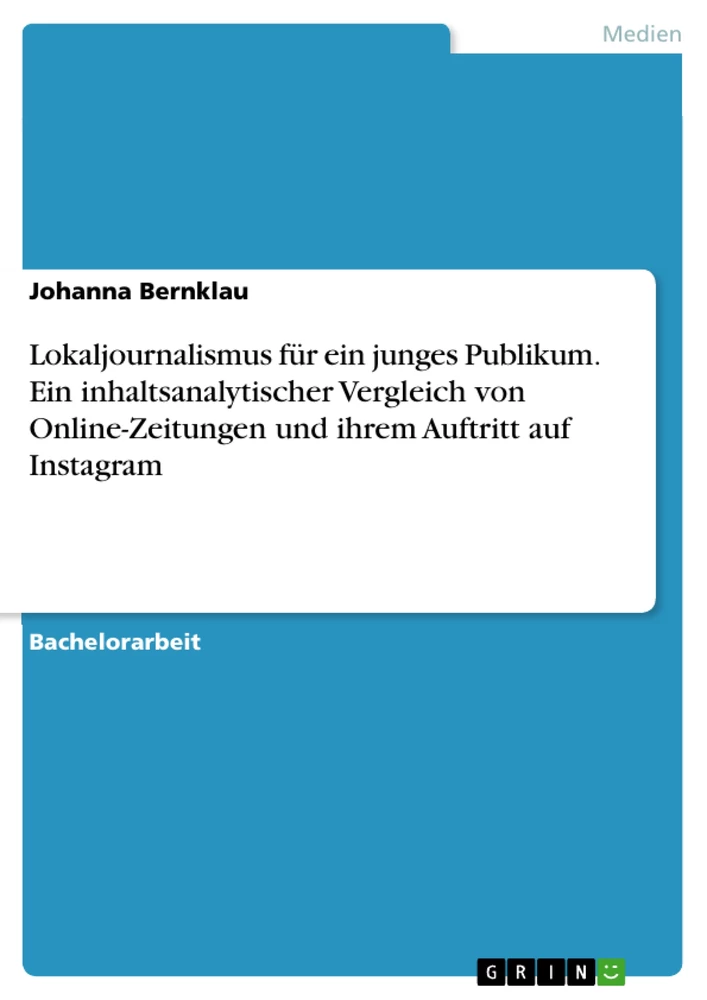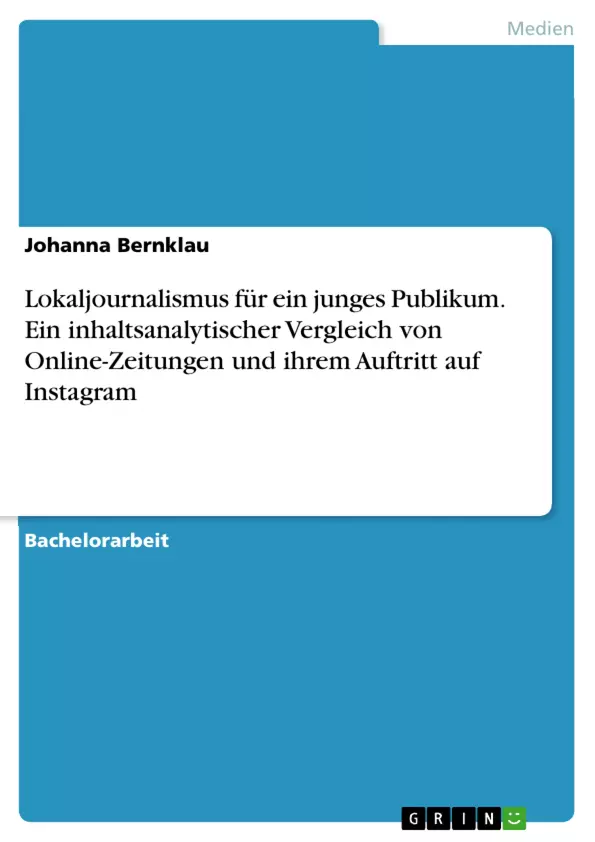In der Arbeit werden zwei Lokalzeitungen – die etablierte Ostsee-Zeitung und das junge Katapult MV – anhand elf Kategorien verglichen, die für das junge Publikum und die Verbreitungsplattform Instagram relevant sind. Dazu wurden insgesamt 40 Instagram-Posts und die dazugehörigen Website-Beiträge der beiden Lokalmedien qualitativ untersucht. Ein Viertel des Materials besteht aus Beiträgen der beiden Medien zum gleichen Thema, drei Viertel der Beiträge wurden zu unterschiedlichen Themen publiziert.
Die Ergebnisse der qualitativen Analyse zeigen, dass beide Lokalmedien in den Bereichen der Objektivität und Meinungstransparenz noch nicht den Erwartungen der jungen Zielgruppe entsprechen. Katapult MV versteht als junges Medium die Funktionsweise von Instagram und die relevante Themenaufbereitung für jegliche Zielgruppen deutlich besser als die Ostsee-Zeitung. Kritik, Quellentransparenz und die Vernetzung von Instagram mit den eigenen Inhalten gehören für Katapult MV zum Alltagsgeschäft, während die Ostsee-Zeitung vor allem stark durch werbliche, stellenweise nicht belegte und weiche Themenaufbereitungen hervorsticht. Auffallend ist auch die unterschiedliche Berichterstattung der beiden Medien zu den gleichen Themen, zu der in dieser Arbeit stellvertretend drei Beispiele her-vorgehoben wurden.
Für den Lokaljournalismus ergibt sich ein düsteres Bild: Vermehrte Redaktionsschließungen, sinkende Auflagen, eine abnehmende Lesesozialisation der neuen Generationen. Um besonders junge Leser:innen wieder für lokale Nachrichten begeistern zu können, müssen Lokalzeitungen einen größeren Fokus auf ihre Online-Präsenz legen, vor allem auf die soziale Plattform Instagram, die die beliebteste der jungen Zielgruppe ist. Zusätzlich sollten die Redaktionen einen höheren Wert auf Qualitätskriterien legen, die für das junge Publikum wichtig sind: Quellentransparenz, Objektivität und eine kritische Auseinandersetzung mit Inhalten sind nur einige, bei denen in den letzten Jahrzehnten große Mängel bei Lokalzeitungen festgestellt wurden.
Die Forschung und auch die vorliegende Analyse zeigen, dass sich Lokaljournalismus in vielen Bereichen noch mehr Veränderung trauen und leisten muss, um junge Leser:innen wieder an Boot holen zu können. Qualität im Lokaljournalismus ist – egal ob für jung oder alt – das wichtigste Kriterium, das langfristig über die Zukunft des Lokaljournalismus und dessen Außenpluralität entscheiden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung...
- 2 Lokaljournalismus..
- 2.1 Definition und Funktion
- 2.2 Probleme und Entwicklung
- 3 Lokaljournalismus im Internet..
- 3.1 Definition und Entwicklung.
- 3.2 Strategien für den Online-Journalismus.....
- 3.3 Nutzung und Chancen
- 4 Das junge Publikum.
- 4.1 Charakterisierung.
- 4.2 Verhalten und Erreichbarkeit .......
- 4.3 Interesse und Ansprüche an den Journalismus...
- 5 Die sozialen Plattformen.
- 5.1 Beziehung zwischen Journalismus und sozialen Plattformen..
- 5.2 Die Plattform Instagram.
- 6 Zwischenfazit......
- 7 Methode.....
- 7.1 Vorstellung der untersuchten Lokalzeitungen.
- 7.2 Die qualitative Inhaltsanalyse
- 8 Auswertung nach Kategorien .......
- 8.1 Ergebnisse
- 8.2 Auswertung nach gleichen Themen
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Adaption des Lokaljournalismus an die Bedürfnisse eines jungen Publikums im digitalen Raum, speziell auf der Plattform Instagram. Im Fokus steht ein Vergleich zweier Lokalzeitungen – einer etablierten und einer jungen – anhand von elf Kategorien, die für die junge Zielgruppe und Instagram relevant sind. Der Vergleich soll aufzeigen, wie gut Lokalmedien die Ansprüche des jungen Publikums im Hinblick auf Qualität, Objektivität und Themenaufbereitung verstehen und umsetzen.
- Die Herausforderungen des Lokaljournalismus im digitalen Zeitalter
- Die Bedeutung von Social Media Plattformen, insbesondere Instagram, für die Reichweite und Relevanz des Lokaljournalismus
- Die Ansprüche und Erwartungen eines jungen Publikums an den Lokaljournalismus
- Ein Vergleich der Inhaltsqualität und der Social-Media-Präsenz zweier Lokalzeitungen
- Die Rolle von Objektivität, Quellentransparenz und kritischer Berichterstattung im Lokaljournalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den Forschungsstand zu Lokaljournalismus und dessen Herausforderungen in der digitalen Welt. Sie beleuchtet die Problematik der traditionellen Ansätze im Vergleich zur modernen Medienlandschaft, die sich durch neue Kommunikationsformen und Zielgruppen auszeichnet.
Kapitel 2 definiert den Lokaljournalismus und seine Funktionen, beleuchtet die bestehenden Probleme und Entwicklungen der Branche.
Kapitel 3 untersucht die Entwicklung und Bedeutung des Lokaljournalismus im Internet, einschließlich der Strategien für den Online-Journalismus und die Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Plattform.
Kapitel 4 charakterisiert das junge Publikum, dessen Verhalten und Erreichbarkeit und seine Interessen und Ansprüche an den Journalismus.
Kapitel 5 thematisiert die Beziehung zwischen Journalismus und sozialen Plattformen, mit besonderem Augenmerk auf Instagram als zentrale Plattform für die junge Zielgruppe.
Kapitel 7 beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse, die als Methode für die Untersuchung der Online-Inhalte der beiden Lokalzeitungen eingesetzt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Lokaljournalismus im Kontext der Digitalisierung, insbesondere auf die Anpassung an ein junges Publikum und die Nutzung der Plattform Instagram. Schwerpunkte sind Inhaltsanalyse, Qualitätskriterien, Objektivität, Quellentransparenz, Instagram, Lokaljournalismus, Online-Präsenz und junge Zielgruppe. Die Arbeit untersucht, wie gut Lokalzeitungen die Ansprüche und Erwartungen der jungen Generation in ihrer Online-Berichterstattung erfüllen und wie die Plattform Instagram genutzt wird, um die junge Zielgruppe zu erreichen.
- Citation du texte
- Johanna Bernklau (Auteur), 2022, Lokaljournalismus für ein junges Publikum. Ein inhaltsanalytischer Vergleich von Online-Zeitungen und ihrem Auftritt auf Instagram, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1327854