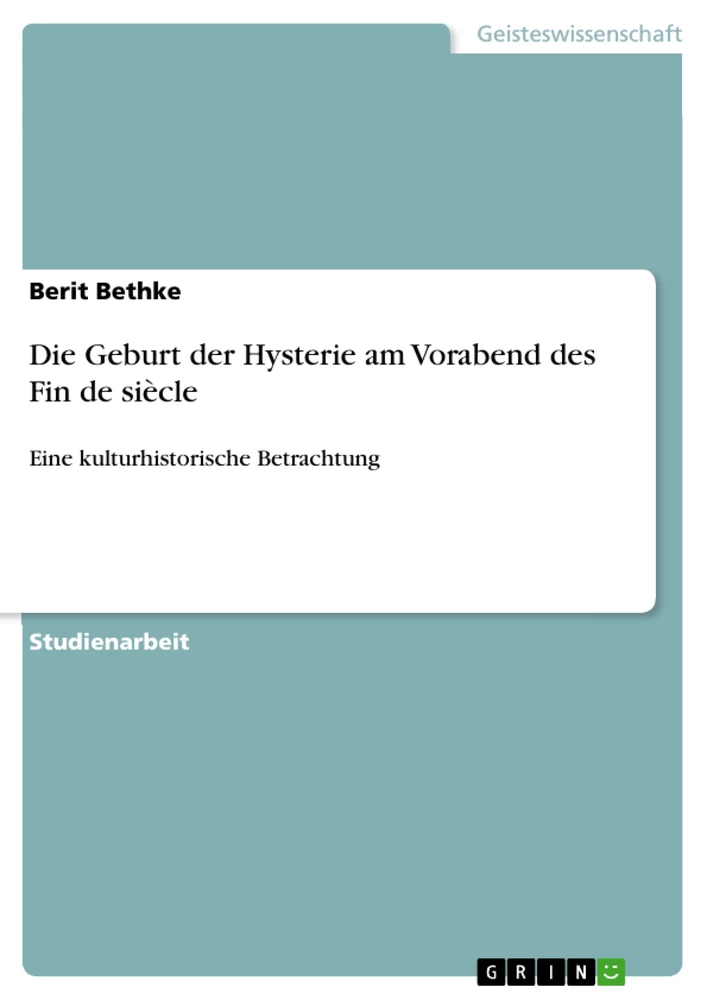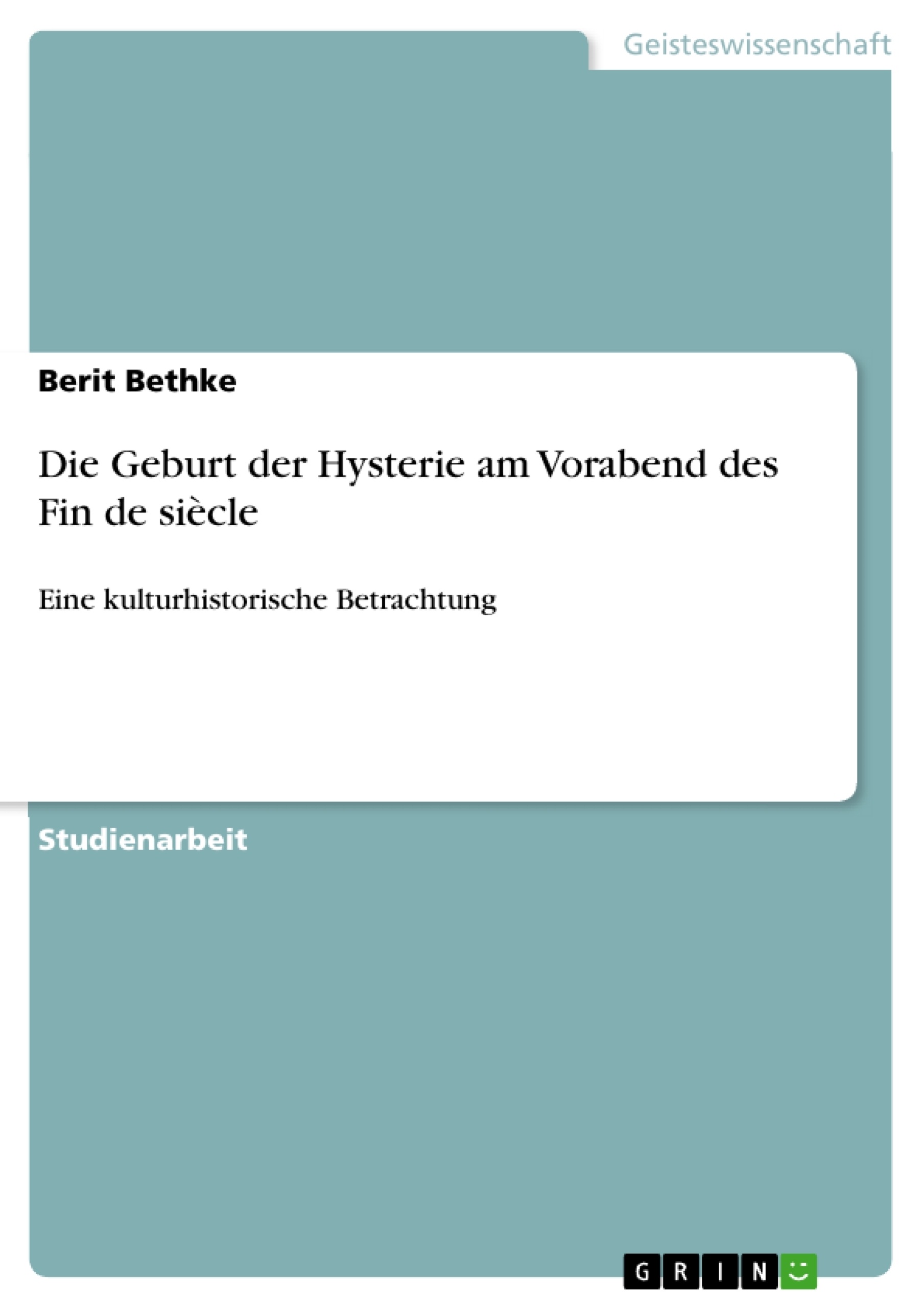Am 18. März 1928 erschien in der Zeitschrift La Revolution surrealiste ein Gedenkartikel zum 50. Jubiläum der Hysterie. Die Verfasser Louis ARAGON und Andre BRETON huldigten damit «eine der größten poetischen Erfindung gegen Ende des 19. Jahrhunderts» und zelebrierten zugleich deren Untergang. Es ist bemerkenswert, dass gerade die Surrealisten, rund 50 Jahre nach dem Erscheinen von Jean-Martin CHARCOTs Iconographie photographique de la Salpêtrière, den Aspekt der Inszenierung resp. der ästhetischen Produktion des Krankheitsbildes, das sich in CHARCOTs Werk manifestiert, herausstellen. CHARCOTs »Bild׀Wissens׀Produktion« selbst hatte mindestens zwei Generationen von Wissenschaftlern und Künstlern fasziniert und die Reproduktion und Ausbreitung eines Diskurses gesichert – des Diskurses um den weiblichen Körper und dessen Ausdrucksfähigkeit.
Die Gedenkschrift der Surrealisten liefert den Ansatzpunkt für diesen Essay. Im Folgenden soll die Hysterie als ein kulturhistorisches Phänomen des ausgehenden 19. Jahrhunderts betrachtet werden, das den Zusammenhang von Imagologie und nosologischer Repräsentation verdeutlicht und Nietzsches Ansatz »Kunst als Physiologie« einbezieht. Der Blick richtet sich dabei auf die vorherrschenden »Denkstile« und Deutungsmuster, die das »Fin de siècle«, als kulturhistorische Epoche im umfassenden Sinne prägten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende theoretische Reflexion
- Kulturhistorische Betrachtung
- Die Ära der Nervosität
- Das physiologische Paradigma
- »Nervenkunst« als Leitmotiv
- Die Konstruktion eines Krankheitsbildes
- Charcots »Hölle der Frauen«
- Der Wille zum Wissen
- Das Paradigma der Sichtbarkeit
- Hysterie als Gesamtkunstwerk
- Literarische Vor-Bilder
- Mädanische Traumtänzerinnen
- Das Archiv der weiblichen Ausdruckgebärden
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Hysterie als kulturhistorisches Phänomen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er beleuchtet den Zusammenhang zwischen der „Imagologie“ und der nosologischen Präsentation der Hysterie, unter Einbezug von Nietzsches Ansatz „Kunst als Physiologie“. Der Fokus liegt auf den vorherrschenden Denkstilen und Deutungsmustern des Fin de Siècle.
- Die Historizität des Körpers und die Konstruktion von Wissen
- Das physiologische Paradigma und seine Auswirkungen auf die Kunst und Gesellschaft
- Charcots Beitrag zur Ästhetisierung der Hysterie und die Entstehung einer Ikonografie weiblicher Ausdruckgebärden
- Die Hysterie als „Gesamtkunstwerk“ und kulturelle Repräsentation von Weiblichkeit
- Der Einfluss von Nietzsche's Denken auf die Interpretation des Phänomens Hysterie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat der Surrealisten, die die Hysterie als „größte poetische Erfindung“ des 19. Jahrhunderts feiern, gleichzeitig aber auch deren Untergang konstatieren. Der Essay betrachtet die Hysterie als kulturhistorisches Phänomen, das den Zusammenhang von „Imagologie“ und nosologischer Repräsentation verdeutlicht. Nietzsches Konzept der „Kunst als Physiologie“ wird miteinbezogen, um die vorherrschenden Denkstile und Deutungsmuster des Fin de Siècle zu analysieren. Die zentrale These ist, dass die Kategorie der Hysterie aus einer epistemologischen Ordnung entstand, die auf wissenschaftliche Diskurse und eine „Semiotik der Weiblichkeit“ zurückgreift.
Grundlegende theoretische Reflexion: Dieses Kapitel diskutiert die Notwendigkeit einer historischen Betrachtung menschlicher Leidenschaften, insbesondere der Geschichte des Körpers, beeinflusst von Michel Foucaults Werk. Es wird Nietzsches Einfluss auf die Auffassung von Wahrheit als „Gemachtes“ hervorgehoben, sowie die Implikation für die Historisierung von Erkenntnissen und Erfahrungen im Kontext der „epistemischen Ästhetisierung“.
Kulturhistorische Betrachtung: Dieser Abschnitt analysiert die kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Entstehung und Wahrnehmung der Hysterie beitrugen. Er untersucht die "Ära der Nervosität", das "physiologische Paradigma" und die Rolle der "Nervenkunst" als Leitmotiv. Das Kapitel etabliert einen Kontext, um die nachfolgende Diskussion über die medizinische Konstruktion der Hysterie zu verstehen.
Die Konstruktion eines Krankheitsbildes: Hier wird Charcots Rolle bei der Konstruktion des Krankheitsbildes der Hysterie detailliert untersucht, insbesondere sein Konzept der „Hölle der Frauen“ und die Betonung der Sichtbarkeit von Symptomen. Der "Wille zum Wissen" und das "Paradigma der Sichtbarkeit" werden im Zusammenhang mit Charcots fotografischer Dokumentation der Hysterie analysiert. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse mit gesellschaftlichen Vorstellungen und Interpretationen verwoben waren.
Hysterie als Gesamtkunstwerk: Dieser Teil erörtert die Ästhetisierung der Hysterie, indem er literarische Vorbilder, die Rolle „mädanischer Traumtänzerinnen“ und Charcots fotografisches Archiv als Repräsentation weiblicher Ausdruckgebärden untersucht. Die Hysterie wird als „Gesamtkunstwerk“ und kulturelle Repräsentation von Weiblichkeit dargestellt und analysiert, die ein breites ästhetisches Interesse erzeugte.
Schlüsselwörter
Hysterie, Fin de Siècle, Kulturgeschichte, Physiologie, Jean-Martin Charcot, Nietzsche, „Kunst als Physiologie“, Gesamtkunstwerk, Semiotik der Weiblichkeit, Ikonografie, Wissenschaftsdiskurs, Ästhetisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Essay über Hysterie im Fin de Siècle
Was ist der Gegenstand dieses Essays?
Der Essay untersucht die Hysterie als kulturhistorisches Phänomen des ausgehenden 19. Jahrhunderts (Fin de Siècle). Er analysiert den Zusammenhang zwischen der „Imagologie“ (bildlichen Darstellung) und der nosologischen Präsentation (medizinische Klassifizierung) der Hysterie, unter Berücksichtigung von Nietzsches „Kunst als Physiologie“. Der Fokus liegt auf den Denkstilen und Deutungsmustern dieser Epoche.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Historizität des Körpers und die Konstruktion von Wissen, das physiologische Paradigma und seine Auswirkungen auf Kunst und Gesellschaft, Charcots Beitrag zur Ästhetisierung der Hysterie und die Entstehung einer Ikonografie weiblicher Ausdruckgebärden, die Hysterie als „Gesamtkunstwerk“ und kulturelle Repräsentation von Weiblichkeit sowie der Einfluss von Nietzsches Denken auf die Interpretation der Hysterie.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in eine Einleitung, eine grundlegende theoretische Reflexion, eine kulturhistorische Betrachtung, die Konstruktion eines Krankheitsbildes, Hysterie als Gesamtkunstwerk und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Rolle spielt Jean-Martin Charcot im Essay?
Charcot spielt eine zentrale Rolle, da sein Konzept der „Hölle der Frauen“ und seine Betonung der Sichtbarkeit von Symptomen bei der Konstruktion des Krankheitsbildes der Hysterie analysiert werden. Seine fotografische Dokumentation der Hysterie wird im Kontext des „Willens zum Wissen“ und des „Paradigmas der Sichtbarkeit“ untersucht.
Wie wird Nietzsches Denken in den Essay integriert?
Nietzsches Konzept der „Kunst als Physiologie“ dient als analytisches Werkzeug, um die vorherrschenden Denkstile und Deutungsmuster des Fin de Siècle zu verstehen. Sein Einfluss auf die Auffassung von Wahrheit als „Gemachtes“ und die Implikation für die Historisierung von Erkenntnissen und Erfahrungen im Kontext der „epistemischen Ästhetisierung“ werden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Essays wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Hysterie, Fin de Siècle, Kulturgeschichte, Physiologie, Jean-Martin Charcot, Nietzsche, „Kunst als Physiologie“, Gesamtkunstwerk, Semiotik der Weiblichkeit, Ikonografie und Wissenschaftsdiskurs.
Welche These vertritt der Essay?
Die zentrale These des Essays ist, dass die Kategorie der Hysterie aus einer epistemologischen Ordnung entstand, die auf wissenschaftliche Diskurse und eine „Semiotik der Weiblichkeit“ zurückgreift.
Welche Methoden werden im Essay angewendet?
Der Essay verwendet eine kulturhistorische Analysemethode, die wissenschaftliche Diskurse, medizinische Konzepte und kulturelle Repräsentationen der Hysterie in Verbindung bringt. Er greift dabei auf literarische und bildliche Quellen zurück.
Für wen ist dieser Essay gedacht?
Dieser Essay richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts, die Geschichte der Medizin und die Geschlechterforschung interessiert.
Wo finde ich den vollständigen Essay?
Der vollständige Essay ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Text bietet lediglich eine umfassende Übersicht.
- Arbeit zitieren
- Berit Bethke (Autor:in), 2007, Die Geburt der Hysterie am Vorabend des Fin de siècle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132787