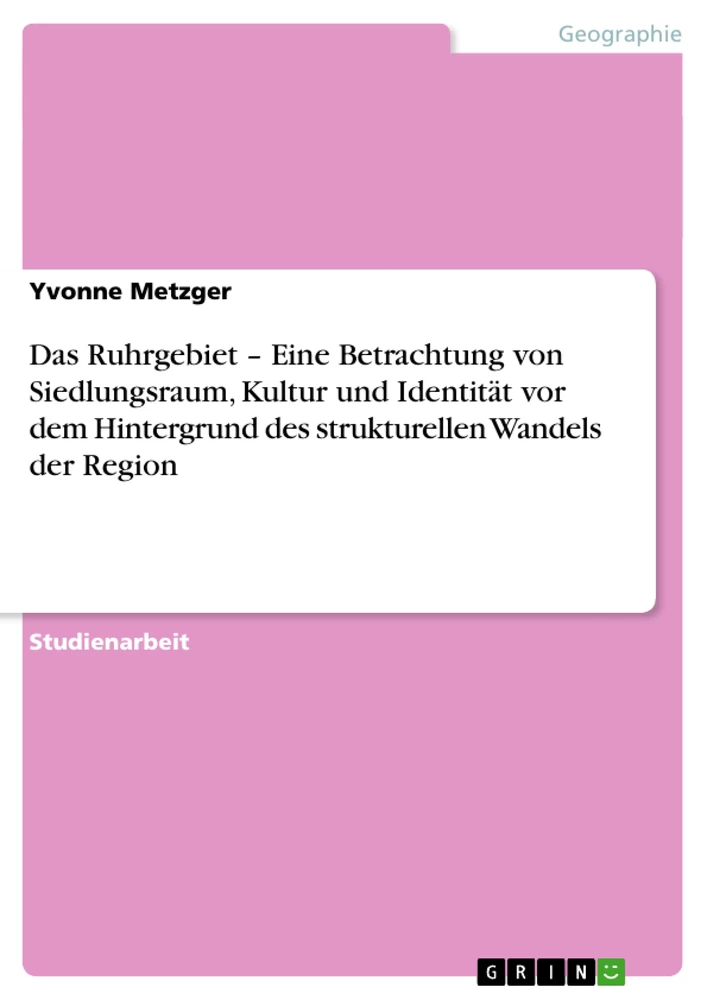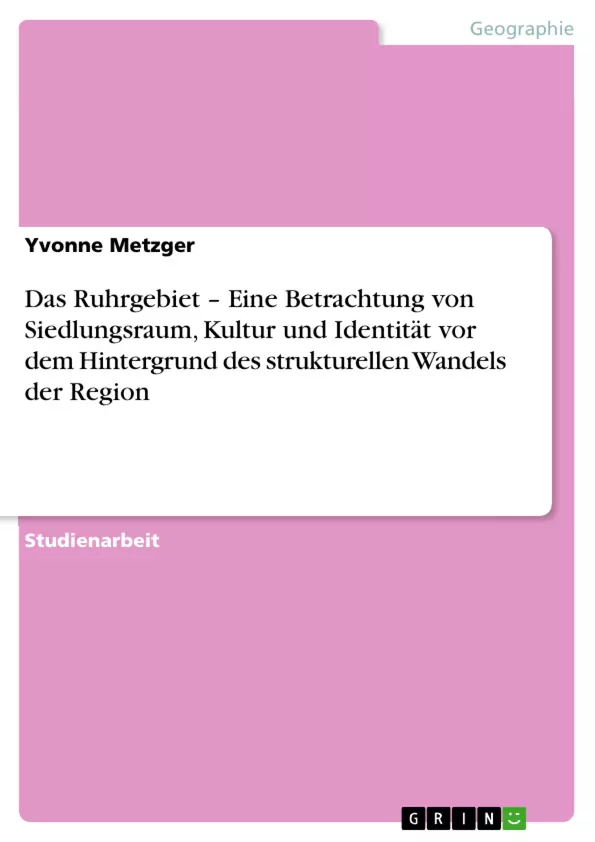Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung 3
II. Sozioökonomische Aspekte des Strukturwandels 4
2.1. Wirtschaftlicher Strukturwandel - Der Prozess der Deindustrialisierung 4
2.2. Gesellschaftlicher Strukturwandel - Um- und Neuorientierung 5
III. Siedlungsraum Ruhrgebiet - Wandel der städtebaulichen Leitbilder und 6
Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur
3.1. Entwicklung der Siedlungsstruktur von Beginn der Industrialisierung bis
zum Zweiten Weltkrieg 6
3.2. Stadtentwicklung und Stadtplanung nach dem Zweiten Weltkrieg 7
3.2.1. Die Bedeutung von Grünflächen in der Stadtplanung der Nachkriegszeit 8
3.2.2. Die Inhalte einer ökologisch orientierten Stadtplanung in der Gegenwart 8
3.3. Exkurs: Neue Einkaufszentren im Ruhrgebiet 10
IV. Das Projekt Internationale Bauausstellung Emscher Park –
Verknüpfung von Industrie, Siedlung, Kultur und Natur 12
4.1. Leitideen, Akteure und erste Bilanz der IBA Emscher Park 12
4.2. Die Neu- und Umgestaltung von Gartenstädten als Beispiel für neue Wohnkultur 13
4.3. Kulturregion Ruhrgebiet 14
4.3.1. Kultur: Sinnstifter – Standortfaktor – Wachstumsbranche 14
4.3.2. Bedeutung von Industriekultur 15
4.3.3. Industriekultur im Rahmen der IBA - Ausgewählte Beispiele für die Umnutzung alter Industriegebäude als neue Kultureinrichtungen 16
4.3.3.1. Der Duisburger Innenhafen 16
4.3.3.2. Der Landschaftspark Duisburg-Nord 17
4.3.3.3. Kultur in der Stadt Oberhausen 17
4.3.3.4. Die Zeche Zollverein in Essen 18
V. Region Ruhrgebiet? - Gibt es eine regionsspezifische Identität? 19
VI. Ausblick – welche Zukunft hat das Ruhrgebiet? 22
VII. Literatur 24
VIII. Links 25
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Sozioökonomische Aspekte des Strukturwandels
- 2.1. Wirtschaftlicher Strukturwandel - Der Prozess der Deindustrialisierung
- 2.2. Gesellschaftlicher Strukturwandel - Um- und Neuorientierung
- III. Siedlungsraum Ruhrgebiet - Wandel der städtebaulichen Leitbilder und Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur
- 3.1. Entwicklung der Siedlungsstruktur von Beginn der Industrialisierung bis zum Zweiten Weltkrieg
- 3.2. Stadtentwicklung und Stadtplanung nach dem Zweiten Weltkrieg
- 3.2.1. Die Bedeutung von Grünflächen in der Stadtplanung der Nachkriegszeit
- 3.2.2. Die Inhalte einer ökologisch orientierten Stadtplanung in der Gegenwart
- 3.3. Exkurs: Neue Einkaufszentren im Ruhrgebiet
- IV. Das Projekt Internationale Bauausstellung Emscher Park – Verknüpfung von Industrie, Siedlung, Kultur und Natur
- 4.1. Leitideen, Akteure und erste Bilanz der IBA Emscher Park
- 4.2. Die Neu- und Umgestaltung von Gartenstädten als Beispiel für neue Wohnkultur
- 4.3. Kulturregion Ruhrgebiet
- 4.3.1. Kultur: Sinnstifter - Standortfaktor - Wachstumsbranche
- 4.3.2. Bedeutung von Industriekultur
- 4.3.3. Industriekultur im Rahmen der IBA - Ausgewählte Beispiele für die Umnutzung alter Industriegebäude als neue Kultureinrichtungen
- 4.3.3.1. Der Duisburger Innenhafen
- 4.3.3.2. Kultur in der Stadt Oberhausen
- 4.3.3.3. Der Landschaftspark Duisburg-Nord
- 4.3.3.4. Die Zeche Zollverein in Essen
- V. Region Ruhrgebiet? - Gibt es eine regionsspezifische Identität?
- VI. Ausblick - welche Zukunft hat das Ruhrgebiet?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entwicklung des Siedlungsraums, der Kultur und der Identität des Ruhrgebiets vor dem Hintergrund des Strukturwandels. Sie untersucht die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und städteplanerischen Veränderungen und beleuchtet den Übergang vom industriellen Zentrum zu einer Kulturlandschaft. Der Fokus liegt auf Stadtplanung und Kultur, wobei die Reaktion der Bevölkerung auf diese Veränderungen ebenfalls betrachtet wird.
- Der wirtschaftliche Strukturwandel und die Deindustrialisierung des Ruhrgebiets.
- Der gesellschaftliche Wandel und die Anpassung der Bevölkerung an neue Lebensbedingungen.
- Die Entwicklung der Stadtplanung und die Rolle ökologischer Aspekte im Ruhrgebiet.
- Das Projekt Internationale Bauausstellung Emscher Park und seine Bedeutung für die Region.
- Die Frage nach einer regionsspezifischen Identität im Ruhrgebiet.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt das Ruhrgebiet als größten industriellen Ballungsraum Europas vor und beschreibt die vielschichtigen Aspekte, die eine umfassende Analyse rechtfertigen würden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Siedlungsraums, der Kultur und der Identität im Kontext des tiefgreifenden Strukturwandels. Sie will die Zusammenhänge zwischen diesen Komponenten aufzeigen und ein Gesamtbild vermitteln, wobei der Schwerpunkt auf Stadtplanung und Kultur liegt. Die Analyse betrachtet die Transformation des Ruhrgebiets von einem industriellen Zentrum hin zu einer Kulturlandschaft und die Reaktion der Bevölkerung auf diesen Wandel, stets im Kontext des umfassenderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels in Deutschland.
II. Sozioökonomische Aspekte des Strukturwandels: Dieses Kapitel analysiert den sozioökonomischen Strukturwandel im Ruhrgebiet, beginnend mit der ersten Kohlekrise der 1950er Jahre. Der wirtschaftliche Strukturwandel wird durch die Deindustrialisierung, den Rückgang des Kohlebergbaus und die Substitution durch andere Energieträger gekennzeichnet. Dies führte zu Arbeitsplatzverlusten, Abwanderung und einer steigenden Arbeitslosenquote. Der gesellschaftliche Strukturwandel umfasste die Pluralisierung der Lebensstile, Veränderungen der Arbeitswelt, bildungspolitische Herausforderungen im Kontext des steigenden Ausländeranteils und die Auswirkungen der Globalisierung. Landesentwicklungspläne zielten auf die Förderung des Städtebaus, die Verbesserung der Infrastruktur und die Stärkung des Freizeitwerts der Region ab.
III. Siedlungsraum Ruhrgebiet - Wandel der städtebaulichen Leitbilder und Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet, differenziert zwischen der Entwicklung bis zum Zweiten Weltkrieg und den nach 1945 gewandelten städtebaulichen Leitbildern. Es werden ökologische Komponenten der Stadtplanung hervorgehoben, die maßgeblich den heutigen Baustil prägten und prägen. Ein Exkurs befasst sich mit der Entwicklung großer Einkaufszentren.
IV. Das Projekt Internationale Bauausstellung Emscher Park – Verknüpfung von Industrie, Siedlung, Kultur und Natur: Dieses Kapitel behandelt die Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA) als kennzeichnendes Merkmal des Strukturwandels. Es beleuchtet die Ziele und Leitideen der IBA, die siedlungsverändernden Maßnahmen (Sanierung alter Arbeitersiedlungen) und die entscheidende Rolle der Kultur. Die kulturelle Inszenierung alter Industrieanlagen und die Errichtung neuer kultureller Einrichtungen werden als Einflussfaktoren für ein regionales Identitätsgefühl betrachtet. Beispiele wie der Duisburger Innenhafen, Kultur in Oberhausen, der Landschaftspark Duisburg-Nord und die Zeche Zollverein werden genannt, um die Umnutzung alter Industriegebäude als neue Kultureinrichtungen zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Strukturwandel, Ruhrgebiet, Deindustrialisierung, Stadtplanung, Kulturlandschaft, Identität, IBA Emscher Park, Industriekultur, gesellschaftlicher Wandel, ökologische Stadtplanung, Wohnkultur, ökonomische Aspekte, Bevölkerungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Entwicklung des Ruhrgebiets im Kontext des Strukturwandels
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Entwicklung des Ruhrgebiets, insbesondere den Siedlungsraum, die Kultur und die Identität der Region, vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Strukturwandels. Sie untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und städteplanerischen Veränderungen und beleuchtet den Wandel vom industriellen Zentrum zu einer Kulturlandschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den wirtschaftlichen Strukturwandel und die Deindustrialisierung, den gesellschaftlichen Wandel und die Anpassung der Bevölkerung, die Entwicklung der Stadtplanung und die Rolle ökologischer Aspekte, das Projekt Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA) und seine Bedeutung, sowie die Frage nach einer regionsspezifischen Identität im Ruhrgebiet.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, sozioökonomische Aspekte des Strukturwandels, Siedlungsraum Ruhrgebiet und Wandel der städtebaulichen Leitbilder, die Internationale Bauausstellung Emscher Park, die Frage nach einer regionsspezifischen Identität und ein Ausblick auf die Zukunft des Ruhrgebiets. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Entwicklung des Ruhrgebiets und deren Interdependenzen.
Welche Aspekte des wirtschaftlichen Strukturwandels werden untersucht?
Der wirtschaftliche Strukturwandel wird durch die Deindustrialisierung, den Rückgang des Kohlebergbaus und die Substitution durch andere Energieträger beschrieben. Die Folgen wie Arbeitsplatzverluste, Abwanderung und steigende Arbeitslosenquote werden analysiert.
Wie wird der gesellschaftliche Wandel im Ruhrgebiet dargestellt?
Der gesellschaftliche Wandel umfasst die Pluralisierung der Lebensstile, Veränderungen der Arbeitswelt, bildungspolitische Herausforderungen im Kontext des steigenden Ausländeranteils und die Auswirkungen der Globalisierung. Die Anpassung der Bevölkerung an die neuen Lebensbedingungen wird ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielt die Stadtplanung in der Analyse?
Die Stadtplanung spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der städtebaulichen Leitbilder, von der Entwicklung bis zum Zweiten Weltkrieg bis hin zur ökologisch orientierten Stadtplanung der Gegenwart. Die Bedeutung von Grünflächen und die Entwicklung neuer Einkaufszentren werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die IBA Emscher Park?
Die Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA) wird als ein entscheidendes Projekt im Strukturwandel des Ruhrgebiets dargestellt. Die Arbeit analysiert die Leitideen, Akteure und die Bilanz der IBA, sowie die Umgestaltung von Gartenstädten und die Umnutzung alter Industriegebäude zu neuen Kultureinrichtungen.
Wie wird die Frage nach der regionalen Identität behandelt?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob es eine regionsspezifische Identität im Ruhrgebiet gibt, unter Berücksichtigung der kulturellen Inszenierung alter Industrieanlagen und der Entwicklung neuer kultureller Einrichtungen als Einflussfaktoren für ein regionales Identitätsgefühl.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Hausarbeit nennt konkrete Beispiele wie den Duisburger Innenhafen, Kulturinitiativen in Oberhausen, den Landschaftspark Duisburg-Nord und die Zeche Zollverein in Essen, um die Umnutzung alter Industriegebäude zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Strukturwandel, Ruhrgebiet, Deindustrialisierung, Stadtplanung, Kulturlandschaft, Identität, IBA Emscher Park, Industriekultur, gesellschaftlicher Wandel, ökologische Stadtplanung, Wohnkultur, ökonomische Aspekte, Bevölkerungsentwicklung.
- Quote paper
- Yvonne Metzger (Author), 2003, Das Ruhrgebiet – Eine Betrachtung von Siedlungsraum, Kultur und Identität vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels der Region, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132866