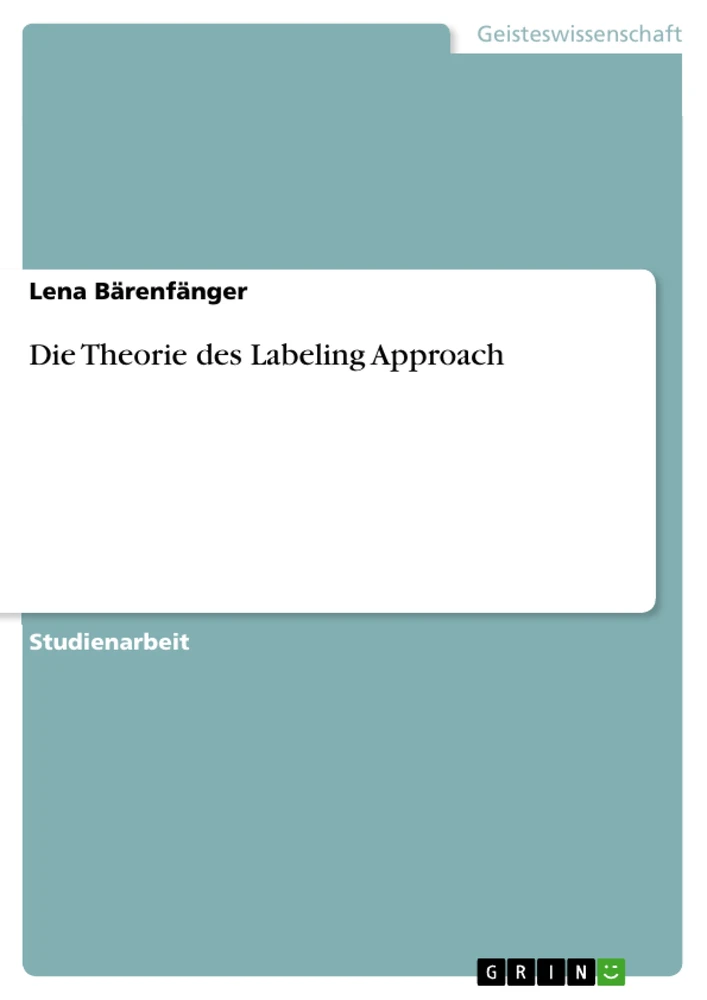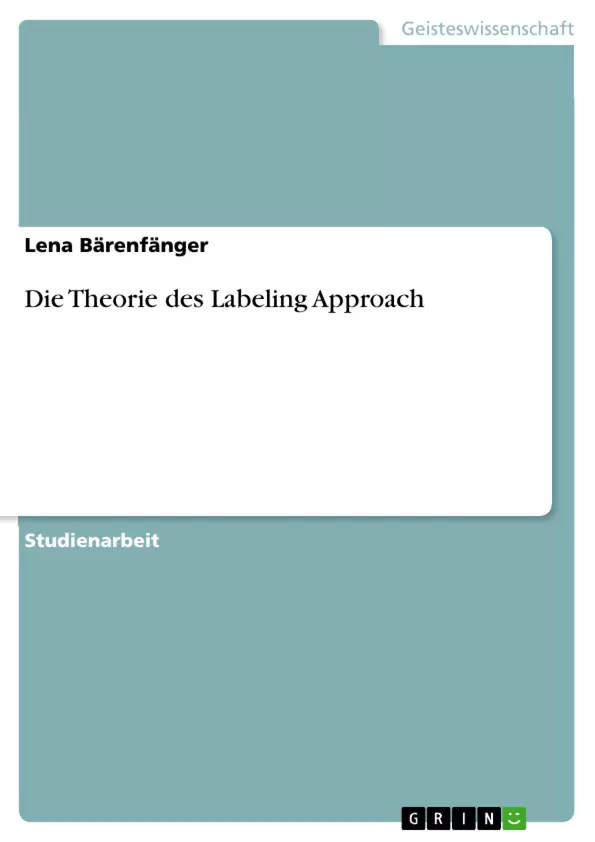Die vorliegende Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Kriminologie - Von den Anfängen bis zur interdisziplinären Wissenschaft“ befasst sich mit der Theorie des „labeling approach“, die abweichendes Verhalten zu erklären versucht. In dieser Hausarbeit wird der labeling approach hinsichtlich der Fragestellung untersucht, ob sich abweichendes Verhalten tatsächlich durch diesen Ansatz erklären und/oder erfassen lässt.
Hierzu werden zunächst der Ansatz und seine Vertreter vorwiegend mithilfe von Siegfried Lamneks Werk „Theorien abweichenden Verhaltens“ (1996) und Werner Rüthers "Abweichendes Verhalten und labeling approach" (1975) erklärt beziehungsweise vorgestellt, um einen Einblick zu schaffen. Zudem wird daraufhin besonders der Blick auf Howard Becker und sein Werk "Außenseiter. Zur Soziologie abweichenden Verhaltens" (1971) gerichtet.
Anschließend wird die Theorie anhand von Kritikern geprüft und Pierre Bourdieus Habituskonzept hinzugezogen, das in seinem Werk "Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft" (1987) erläutert wird.
Die vorliegenden Literaturquellen werden hinsichtlich der Fragestellung vergleichend und ergänzend bearbeitet, um abschließend im Fazit eine Antwort auf die Fragestellung finden zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Vorstellung des „labeling approach“
- „Labeling approach“ nach Howard S. Becker
- Kritik und Würdigung des „labeling approach“
- Kritiker zum labeling approach
- Das Habituskonzept nach Bourdieu
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Kriminologie - Von den Anfängen bis zur interdisziplinären Wissenschaft“ analysiert die Theorie des „labeling approach“, um die Frage zu beantworten, ob sich abweichendes Verhalten tatsächlich durch diesen Ansatz erklären und/oder erfassen lässt.
- Definition und Vorstellung des „labeling approach“
- Analyse des „labeling approach“ nach Howard S. Becker
- Kritik und Würdigung des „labeling approach“ durch verschiedene Wissenschaftler
- Vergleich des „labeling approach“ mit Pierre Bourdieus Habituskonzept
- Abschließende Bewertung der Theorie im Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung stellt die Hausarbeit und ihre Fragestellung vor. Sie führt den Leser in die Thematik des „labeling approach“ ein und zeigt die Relevanz der Theorie für die Erklärung abweichenden Verhaltens auf.
Definition und Vorstellung des „labeling approach“
Dieses Kapitel definiert den „labeling approach“ und beschreibt die wichtigsten Vertreter der Theorie, darunter Frank Tannenbaum, Edwin Lemert, Kai Erikson, John Kitsuse und Fritz Sack. Es werden die zentralen Elemente der Theorie und ihre Entwicklung beleuchtet.
„Labeling approach“ nach Howard S. Becker
Dieses Kapitel befasst sich mit der „labeling approach“-Theorie von Howard S. Becker und untersucht seine zentralen Aussagen im Werk „Außenseiter“. Es wird die Rolle der Etikettierung im Entstehungsprozess abweichenden Verhaltens analysiert.
Kritik und Würdigung des „labeling approach“
Dieses Kapitel präsentiert Kritikpunkte am „labeling approach“ und diskutiert unterschiedliche Perspektiven auf die Theorie. Es wird außerdem das Habituskonzept von Pierre Bourdieu in den Kontext der Kritik am „labeling approach“ eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Hausarbeit sind: abweichendes Verhalten, „labeling approach“, Etikettierung, soziale Reaktion, Devianz, Howard S. Becker, Pierre Bourdieu, Habitus, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Aussage des Labeling Approach?
Der Labeling Approach (Etikettierungsansatz) besagt, dass abweichendes Verhalten erst durch die soziale Reaktion und die Zuschreibung (Etikettierung) durch die Gesellschaft entsteht.
Welche Rolle spielt Howard S. Becker in dieser Theorie?
Becker ist ein Hauptvertreter; in seinem Werk „Außenseiter“ beschreibt er, wie soziale Gruppen Regeln aufstellen und Personen, die diese verletzen, als Außenseiter etikettieren.
Was bedeutet „primäre“ und „sekundäre“ Devianz?
Primäre Devianz ist der ursprüngliche Regelverstoß. Sekundäre Devianz entsteht, wenn die Person das Etikett „kriminell“ oder „abweichend“ in ihr Selbstbild übernimmt und daraufhin weiter abweichend handelt.
Wie wird der Labeling Approach kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass der Ansatz die Ursachen der ersten Tat (primäre Devianz) vernachlässigt und den Täter zu passiv als bloßes Opfer der Gesellschaft darstellt.
Was hat Pierre Bourdieus Habituskonzept mit dieser Theorie zu tun?
Die Arbeit zieht Bourdieus Konzept heran, um zu untersuchen, wie tief verwurzelte gesellschaftliche Urteilskraft und soziale Herkunft den Prozess der Etikettierung beeinflussen.
- Arbeit zitieren
- Lena Bärenfänger (Autor:in), 2014, Die Theorie des Labeling Approach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1329039