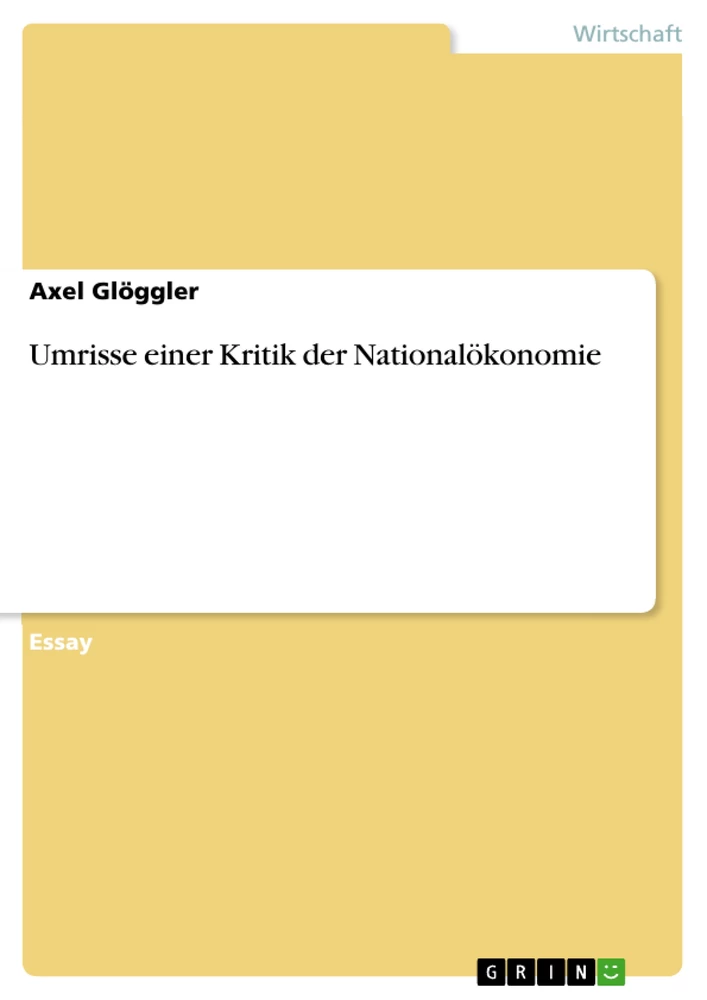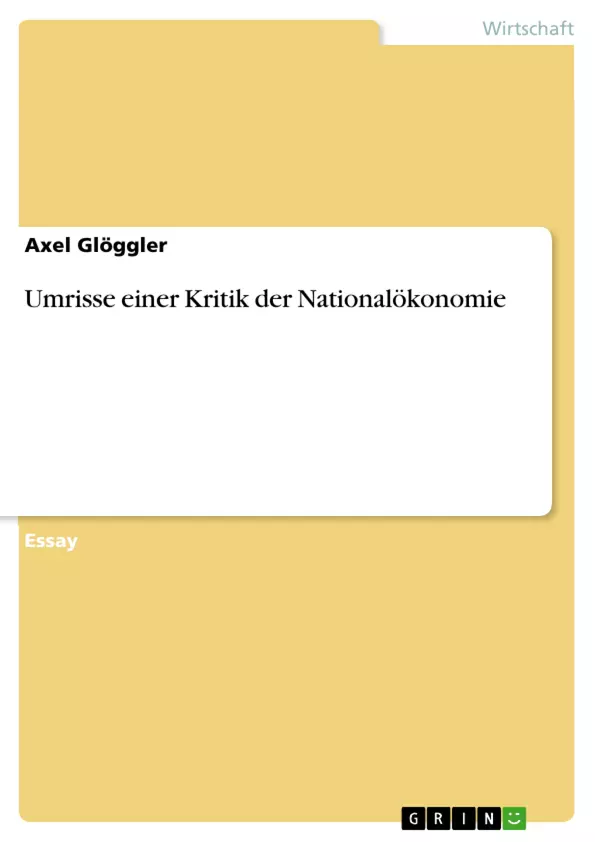Die Nationalökonomie ist ein „ausgebildetes System des erlaubten Betrugs, eine komplette Bereicherungswirtschaft“, eigentlich müsste sie „Privat-Ökonomie“ heißen.
Wenn man registriert, dass höchst-ausgezeichnete Wissenschaftler der Nationalökonomie sehr fantasievoll an der Erfindung, Ausgestaltung von Finanzprodukten (auch ihrer spekulativen Nutzung) beteiligt waren (Cox, Ross und Rubinstein haben ein entsprechendes Binomialmodell erstellt), die mithalfen, die Welt in eine Krise zu stürzen, scheint Friedrich Engels Behauptung bestätigt zu werden. Erst recht, wenn man liest, dass Myron Scholes, der 1996 den Nobelpreis „für die Ausarbeitung einer mathematischen Formel zur Bestimmung von Optionswerten an der Börse“ erhielt, zusammen mit seinen Kollegen bei dem Hedgefond LTMC 2008 einen Verlust von 4,6 Milliarden US-Dollar verursachte, was mit dazu beitrug, die globale Finanzkrise auszulösen. (2005 wurde Scholes wegen Steuerhinterziehung bei diesem Fond in Höhe von 40 Millionen US-Dollar verurteilt.)
Die Weltbank errechnet, dass weltweit Vermögensverluste von fünfzig Billionen US-Dollar zu beklagen sind, eine unvorstellbare Summe. Das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das diese Schäden zuließ, wird von vielen Politikern, nicht nur am linken Rand, in Frage gestellt.
Unsere Wirtschaftsordnung wurde durch die Nationalökonomie begründet. Ist also die Nationalökonomie an diesem Waterloo schuld?
Inhaltsverzeichnis
- Die Nationalökonomie ist ein „ausgebildetes System des erlaubten Betrugs, eine komplette Bereicherungswirtschaft“, eigentlich müsste sie „Privat-Ökonomie“ heißen.
- Die Weltbank errechnet, dass weltweit Vermögensverluste von fünfzig Billionen US-Dollar zu beklagen sind, eine unvorstellbare Summe.
- Unsere Wirtschaftsordnung wurde durch die Nationalökonomie begründet. Ist also die Nationalökonomie an diesem Waterloo schuld?
- Es fällt auf, dass sich die Mehrzahl der Nationalökonomen seit etwa fünfzig Jahren der Mathematisierung verschrieben hat.
- Die Weltwirtschaftskrise kann jedoch nicht als ein Waterloo der Nationalökonomie bezeichnet werden, noch weniger ist die Nationalökonomie ein „Betrugs- oder Bereicherungssystem“, wie das Friedrich Engels nach seinem Blick auf die Situation der englischen Arbeiterschaft vor gut 150 Jahren glaubte feststellen zu müssen.
- Doch hat sich die Ordnungsökonomik - eine intellektuelle Meisterleistung speziell der deutschen Nationalökonomie - keineswegs erschöpft. Sie ist nötiger denn je.
- Der Klassiker Adam Smith und seine unmittelbaren Nachfolger haben es zwar nicht hinreichend verstanden, die Schwankungen mit desaströsen Folgen speziell für die Arbeiterschaft zu erklären, die sich in ihrem Umfeld, dem (früh-)kapitalistischen Wirtschaftssystem zeigten.
- Dass der Ordnungsgedanke in Politik und Nationalökonomie kaum mehr einen Stellenwert besitzt, ist für mich der tiefe Grund für die gegenwärtige Finanz- und Realkrise.
- So müssen den Mathematikern Ordnungstheoretiker entgegentreten.
- So sieht beispielsweise die moderne volkswirtschaftliche Wachstumstheorie die Quellen für Innovationen vorzüglich in Großunternehmen, ebenso wie das amerikanische Vertreter der Managementlehre tun, die ein makroökomisches Organisationsdesign zu Gunsten von „,Groß“ befürworten.
- Unter der Überschrift Die Betriebswirtschaftlehre hat den Unternehmer vergessen, kritisiert ein Betriebswirt, Professor of Family Business, dass „die Betriebswirtschaftslehre, geschult am Leitbild der klassischen Publikumsaktiengesellschaften, sich mit dem Phänomen dominierender Inhaberschaft, von wenigen Ausnahmen abgesehen, praktisch nicht beschäftigt.
- Nun gab es ja vor kurzem eine Mammutkonferenz, die das Ziel der Neuordnung der globalen Finanzverfassung hatte.
- Zum ersten steht zu befürchten, dass das Problem der globalen Überschussliquidität unterschätzt wird und damit das der Inflation: weil man der Auffassung ist, dass man Liquidität jetzt nicht einfrieren könne, wo doch eine Deflation drohe.
- Dann, zum zweiten, wird die Frage der Haftung für Manager von Großkonzernen nicht konsequent gelöst werden.
- In das Privateigentum, drittens, wird weiter eingegriffen werden durch Aufrechterhaltung eines konfiskatorischen Steuerrechtes.
- Enteignungen, viertens, Eingriffe in privates Eigentum, werden abgesegnet werden, vorgeblich als ultima ratio.
- Vor allem, fünftens, wird es auch künftighin keine Konstanz der Wirtschaftspolitik geben.
- Dabei hätten sich die Akteure der Konferenz besonders auf dem Gebiet der Geld- und Währungspolitik, ein zentraler Punkt auf ihrer Agenda, bewußt sein müssen, dass es in der ,,Guten alten Zeit“ einen Goldstandard, einen Goldautomatismus gab, also eine einfache, aber klare Regel, die dazu zwang, die umlaufende Geldmenge an den Bestand von Goldreserven anzupassen, die Geldmenge also zu reduzieren, wenn Gold wegen eines Handelsbilanzdefizites abgegeben werden musste.
- Der chinesische Zentralbankpräsident Zhou Xiaochuan hat jüngst seinen Reformvorschlag zur langfristigen Verbesserung des Weltwährungssystems präsentiert.
- Die Zusammenhänge sind in praxi etwas komplizierter.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie“ von Dr. Axel Glöggler analysiert die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise und stellt die Nationalökonomie in Frage. Der Autor argumentiert, dass die Krise nicht nur ein Ergebnis der globalen Finanzmärkte ist, sondern auch auf die Fehlentwicklung der Macht und die Dominanz der mathematischen Ökonomie zurückzuführen ist.
- Kritik an der Nationalökonomie und ihrer Mathematisierung
- Die Bedeutung der Ordnungsökonomik
- Die Rolle von Großunternehmen und Innovationen
- Die Folgen der amerikanischen Kultur- und Wissenschaftshegemonie
- Die Notwendigkeit einer neuen Wirtschaftsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer scharfen Kritik an der Nationalökonomie, die als „ausgebildetes System des erlaubten Betrugs“ bezeichnet wird. Der Autor verweist auf die Rolle von Ökonomen bei der Entwicklung von Finanzprodukten und deren spekulativer Nutzung, die zur Finanzkrise 2008 beigetragen haben. Er argumentiert, dass die Nationalökonomie, insbesondere durch ihre Mathematisierung, die Ordnungsökonomik verdrängt hat und damit einen wichtigen Zweig der Wirtschaftswissenschaft vernachlässigt hat.
Im weiteren Verlauf des Textes wird die Bedeutung der Ordnungsökonomik hervorgehoben. Der Autor verweist auf die Schriften des Ordoliberalismus, die sich für eine Verbesserung der Wohlfahrt der Gesellschaft einsetzten. Er kritisiert die amerikanische Kultur- und Wissenschaftshegemonie, die zu einer globalen Mathematisierung der Ökonomie geführt hat und damit die Bedeutung von Ordnungsfragen vernachlässigt hat.
Der Text beleuchtet auch die Rolle von Großunternehmen und Innovationen. Der Autor argumentiert, dass die moderne Wachstumstheorie die Bedeutung von Großunternehmen für Innovationen überschätzt und die Rolle von kleinen und mittleren Unternehmen vernachlässigt. Er kritisiert die Dominanz von Großunternehmen und die Konzentration von Macht in den Händen weniger.
Schließlich stellt der Autor die Notwendigkeit einer neuen Wirtschaftsordnung in den Vordergrund. Er kritisiert die fehlende Konstanz der Wirtschaftspolitik und die Dominanz von kurzfristigen Interventionen. Er plädiert für eine Rückkehr zu grundlegenden Ordnungs-Prinzipien und für eine stärkere Berücksichtigung von langfristigen Zielen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Nationalökonomie, die Ordnungsökonomik, die Mathematisierung der Ökonomie, die Finanzkrise, die amerikanische Kultur- und Wissenschaftshegemonie, Großunternehmen, Innovationen, Wirtschaftsordnung und Konstanz der Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Nationalökonomie als "System des Betrugs" kritisiert?
Die Arbeit zitiert Friedrich Engels und kritisiert, dass moderne Ökonomen oft komplexe Finanzprodukte erfunden haben, die zur Bereicherung Weniger dienten und die globale Finanzkrise mitverursachten.
Was ist die Hauptkritik an der Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaft?
Es wird kritisiert, dass sich die Nationalökonomie zu sehr in mathematischen Modellen verliert und dabei reale ordnungspolitische Fragen sowie die soziale Verantwortung vernachlässigt.
Welche Bedeutung hat die Ordnungsökonomik heute noch?
Die Ordnungsökonomik (Ordoliberalismus) ist laut Autor nötiger denn je, um klare Regeln für Finanzmärkte zu setzen und die soziale Marktwirtschaft vor rein spekulativen Interessen zu schützen.
Welche Rolle spielten Nobelpreisträger wie Myron Scholes in der Krise?
Scholes entwickelte mathematische Formeln zur Optionsbewertung, die zwar wissenschaftlich geehrt wurden, in der Praxis jedoch zu massiven Verlusten (z.B. beim Hedgefonds LTMC) und globaler Instabilität beitrugen.
Was fordert der Autor für die zukünftige Wirtschaftspolitik?
Er plädiert für eine Rückkehr zu ordnungspolitischen Prinzipien, mehr Haftung für Manager, den Schutz des Privateigentums und eine Abkehr von kurzfristigen Interventionen.
- Citation du texte
- Axel Glöggler (Auteur), 2009, Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132944