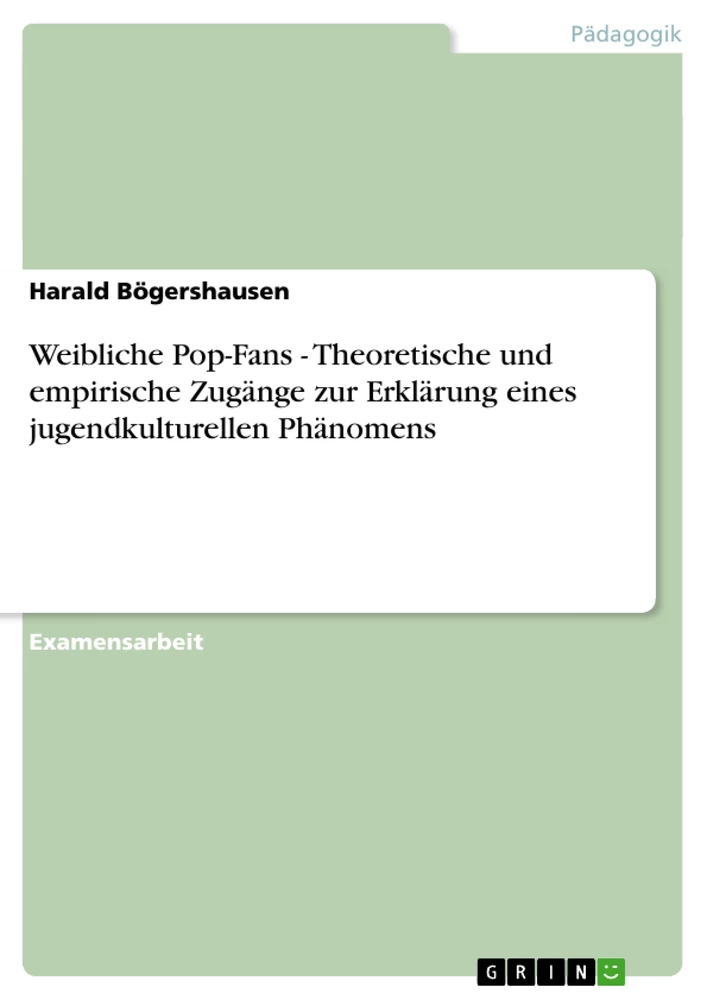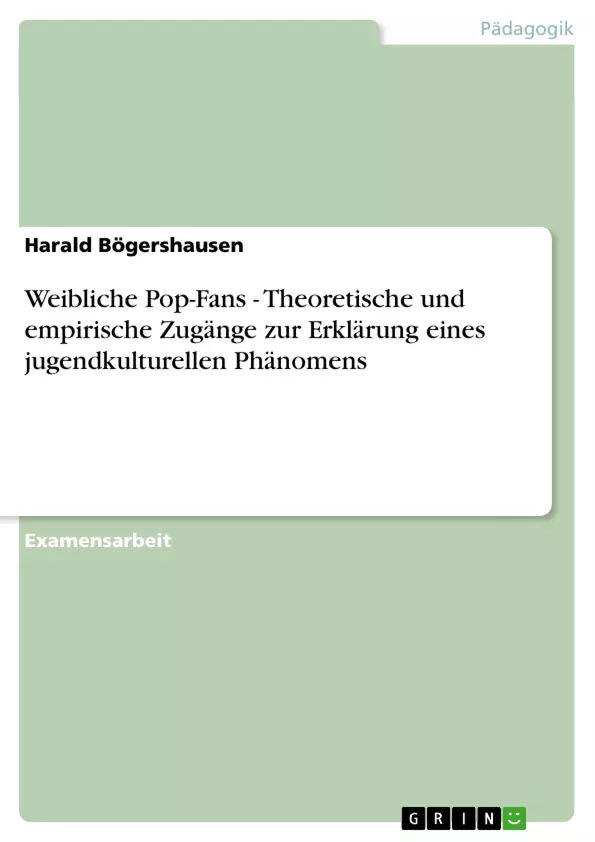„Im Deutschland der neunziger Jahre grassiert eine neue kollektive Kinderverzückung: Zwar zählen Mädchenkreischen, Ohnmachtsanfälle und Massenhysterie seit den wilden Zeiten der Beatles in den Sechzigern zu den gewöhnlichen Spaßritualen der Jugendkultur – noch nie aber hat sich ein ganzes Pop-Genre derart erfolgreich der mutwilligen Erregung von Teenagerkrawallen, Heulattacken und Kuscheltier-Bombardements auf Gesangskünstler verschrieben wie in jüngster Zeit.“
Weibliche Pop-Fans – jeder Leser dürfte gewisse Assoziationen an diese Bezeichnung knüpfen. Oftmals denkt man an hysterisch kreischende und weinende Fans, die blind vor Verzückung ,ihren‘ Star bedingungslos anhimmeln. Dieses negative Bild wird nicht zuletzt von den Medien vermittelt und aufrechterhalten. Was verbirgt sich jedoch hinter dem Fansein der Mädchen? Warum sind sie so begeistert und empfänglich für diese Art Musik und die dahinter stehenden Künstler?
Das Thema der vorliegenden Arbeit „Weibliche Pop-Fans. Theoretische und empirische Zugänge zur Erklärung eines jugendkulturellen Phänomens“ lässt bereits eine Laufrichtung, eine grobe Struktur erahnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Annäherung an wichtige Begrifflichkeiten
- Exkurs: Pop(musik)
- Definitionsversuch,Fan'
- Annäherung an den Jugendbegriff
- Psychologische Eingrenzungskriterien
- Soziologische Eingrenzungskriterien
- Exkurs: Jugendkultur
- Jugend und Musik
- Zur Bedeutung von Popmusik
- Zur Entstehung musikalischer Präferenz im Jugendalter
- Funktionen und Folgen jugendlicher Musikpräferenz
- Jugend – Eltern – Gleichaltrige
- Jugend zwischen Eltern und Gleichaltrigen
- Zur Bedeutung der Eltern in der Adoleszenz
- Zur Bedeutung von Gleichaltrigen und Freunden
- Eltern vs. Peers
- Boygroups als typische Objekte weiblichen Fantums
- Geschlechtsspezifische Fan-Unterschiede
- Begriffsbeschreibung,Boygroup'
- Zusammensetzung einer Boygroup
- Image einer Boygroup
- Texte der Boygroups
- Zur Funktion der Medien
- Boygroups heute
- Theorien zur Erklärung des Fan-Seins
- Funktion der Popmusik als Traum-Vorlage
- Pop als Regression in den „magischen Uterus"
- Popmusik als Orientierungshilfe und Mittel zur Opposition
- Boygroups als Übergangsobjekt
- Fan-Sein als Flucht in eine heile Parallelwelt
- Das Fan-Phänomen bei Sigmund Freud
- Zusammenfassende Betrachtung der Funktionen von Musik
- Fallinterpretationen
- Fall I
- Bemerkungen zur Interviewsituation
- Auswertung eines exemplarischen Interviews
- Fall II
- Bemerkungen zur Interviewsituation
- Auswertung eines exemplarischen Interviews
- Fall III
- Bemerkungen zur Interviewsituation
- Auswertung eines exemplarischen Interviews
- Analyse der Fallinterviews und Ansätze einer Bewertung
- Fall I
- Schlussbetrachtung und Ausblick
- Anhang
- Interviewtranskription I (Viertklässlerin)
- Interviewtranskriptionen
- Interviewtranskription II (Achtklässlerin)
- Interviewtranskription III (Studentin)
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen an der Universität Osnabrück befasst sich mit dem Phänomen weiblicher Pop-Fans. Ziel ist es, dieses jugendkulturelle Phänomen aus theoretischer und empirischer Perspektive zu beleuchten und zu erklären. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Popmusik für Jugendliche, insbesondere für Mädchen, und analysiert die Gründe für ihre Begeisterung für bestimmte Künstler und Musikgenres.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Pop“, „Fan“ und „Jugendkultur“
- Analyse der Bedeutung von Popmusik für Jugendliche und die Entstehung musikalischer Präferenzen
- Untersuchung der Rolle von Eltern und Gleichaltrigen in der Adoleszenz und deren Einfluss auf den Musikgeschmack
- Bedeutung von Boygroups als typische Objekte weiblichen Fantums und Analyse ihrer spezifischen Merkmale
- Rezeption und Interpretation verschiedener Theorien zur Erklärung des Fan-Seins
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz des Phänomens weiblicher Pop-Fans dar. Sie skizziert die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition und Abgrenzung wichtiger Begrifflichkeiten. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition von „Pop“, „Fan“ und „Jugendkultur“ diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Analyse zu schaffen.
Kapitel drei beleuchtet die Bedeutung von Popmusik für Jugendliche und die Entstehung musikalischer Präferenzen. Es werden verschiedene Erklärungsansätze vorgestellt, die die Entstehung von Musikpräferenzen im Jugendalter beleuchten.
Kapitel vier untersucht die Rolle von Eltern und Gleichaltrigen in der Adoleszenz und deren Einfluss auf den Musikgeschmack. Es wird die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung und der Peer-Group für die Entwicklung des Musikgeschmacks von Jugendlichen analysiert.
Kapitel fünf stellt Boygroups als typische Objekte weiblichen Fantums vor. Es werden die spezifischen Merkmale von Boygroups, wie ihre Zusammensetzung, ihr Image und ihre Musik, analysiert.
Kapitel sechs präsentiert verschiedene Theorien zur Erklärung des Fan-Seins. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die das Phänomen des Fan-Seins aus psychologischer und soziologischer Perspektive erklären.
Kapitel sieben präsentiert Fallinterpretationen, die auf Basis von Interviews mit weiblichen Pop-Fans das Phänomen des Fan-Seins veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen weibliche Pop-Fans, Jugendkultur, Popmusik, Fan-Sein, Boygroups, Adoleszenz, Eltern, Gleichaltrige, Medien, Theorien zur Erklärung des Fan-Seins, empirische Forschung, qualitative Interviews.
Häufig gestellte Fragen
Warum begeistern sich besonders Mädchen für Boygroups?
Boygroups dienen oft als "Übergangsobjekt" in der Adoleszenz, ermöglichen die Flucht in Traumwelten und bieten eine sichere Projektionsfläche für erste romantische Gefühle.
Welche Rolle spielen Gleichaltrige (Peers) beim Fantum?
Das gemeinsame Fantum stärkt die Bindung innerhalb der Peer-Group und dient der Abgrenzung gegenüber der Elternwelt sowie der Identitätsfindung.
Wie beeinflussen Medien das Bild weiblicher Pop-Fans?
Medien vermitteln oft ein negatives Bild von "hysterischen" Fans, nutzen diese Begeisterung aber gleichzeitig gezielt für die Vermarktung von Pop-Genres.
Was ist die psychologische Funktion von Popmusik für Jugendliche?
Musik dient als Orientierungshilfe, Mittel zur Opposition, Stimmungsregulator und als Vorlage für Tagträume in einer komplexen Lebensphase.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede im Fan-Verhalten?
Ja, während weibliches Fantum oft durch emotionale Bindung und kollektive Rituale geprägt ist, zeigen männliche Fans häufig andere Formen der Identifikation mit Stars.
Was versteht man unter Popmusik als "magischer Uterus"?
Diese Theorie beschreibt die Musik als einen schützenden Raum, in den sich Jugendliche zurückziehen können, um Geborgenheit und Regression zu erleben.
- Citar trabajo
- Harald Bögershausen (Autor), 2004, Weibliche Pop-Fans - Theoretische und empirische Zugänge zur Erklärung eines jugendkulturellen Phänomens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132949