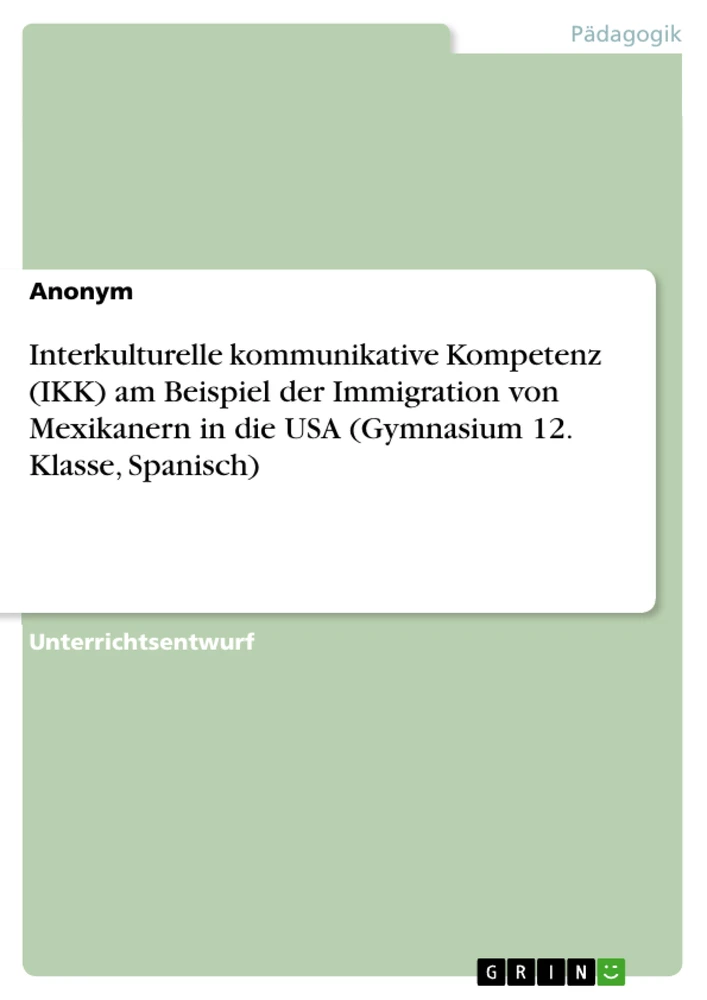Dieser vorliegende Unterrichtsentwurf für eine 12. Klasse Gymnasium thematisiert die Literaturdidaktik im Spanischunterricht und widmet sich der Fragestellung, wie die interkulturelle kommunikative Kompetenz gefördert werden kann. Das Hauptziel liegt darin, Verständnis für die Motive der Emigranten und die Konfliktsituation im Allgemeinen zwischen den beiden Staaten Mexiko und USA zu entwickeln.
Interkulturalität hat durch Migrationsprozesse und die zunehmende Globalisierung stark an Bedeutung gewonnen. Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, was das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und Sprachen zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, mit Menschen anderer Kulturen angemessen umzugehen. Dazu muss man in der Lage sein, sich in ihre kulturspezifischen Verhaltensweisen hineinzuversetzen. Dieser Fähigkeit verleiht innerhalb der Schule die interkulturelle kommunikative Kompetenz Ausdruck. Sie ist von großer Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht und kann insbesondere durch den Perspektivenwechsel erworben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interkulturelle Kommunikative Kompetenz
- Der interkulturelle Ansatz
- Entwicklung der Modelle
- Methoden und Verfahren
- Unterrichtsentwurf
- Rahmenbedingungen
- Zielsetzung
- Begründung der Themenwahl
- Verlauf der Unterrichtsstunde
- Tabellarischer Verlaufsplan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der interkulturellen kommunikativen Kompetenz im Spanischunterricht und untersucht, wie diese gefördert werden kann. Dazu werden verschiedene Modelle und Ansätze beleuchtet und eine Unterrichtsplanung zum Thema "Movimientos migratorios: Latinoamérica – España" erstellt.
- Interkultureller Ansatz im Fremdsprachenunterricht
- Entwicklung von Modellen zur interkulturellen Kompetenz
- Methoden und Verfahren zur Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz
- Unterrichtsplanung und -gestaltung im Spanischunterricht
- Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der interkulturellen Kommunikation im Kontext von Migration und Globalisierung heraus. Sie führt den Begriff der interkulturellen kommunikativen Kompetenz ein und beleuchtet ihre Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem interkulturellen Ansatz im Fremdsprachenunterricht. Es werden die konstruktivistischen Lerntheorien erläutert und die verschiedenen Phasen des interkulturellen Lernprozesses dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Entwicklung von Modellen zur interkulturellen Kompetenz. Es wird auf das 'Model of Intercultural Communicative Competence (ICC) von Michael Byram' eingegangen, welches in den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und in die Bildungsstandards aufgenommen wurde.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Methoden und Verfahren zur Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz im Spanischunterricht. Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie authentische Dokumente der spanischsprachigen Welt im Unterricht eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Interkulturelle kommunikative Kompetenz, interkultureller Ansatz, Fremdsprachenunterricht, Bildungsstandards, Modell von Byram, Perspektivenwechsel, Empathiefähigkeit, Unterrichtsplanung, authentische Materialien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Interkulturelle Kommunikative Kompetenz (IKK)?
IKK ist die Fähigkeit, in interkulturellen Situationen angemessen und erfolgreich zu kommunizieren. Dazu gehört das Wissen über andere Kulturen sowie die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und zur Empathie.
Warum ist die IKK im Spanischunterricht wichtig?
Durch Globalisierung und Migration treffen Schüler immer häufiger auf Menschen anderer Kulturen. Der Spanischunterricht nutzt Themen wie die Migration von Mexiko in die USA, um diese Kompetenz praxisnah zu schulen.
Was ist das Modell von Michael Byram?
Das „Model of Intercultural Communicative Competence“ (ICC) von Byram beschreibt Wissen, Einstellungen und Fertigkeiten, die für interkulturelles Handeln nötig sind. Es ist Basis für moderne Bildungsstandards.
Wie wird der Perspektivenwechsel im Unterricht gefördert?
Schüler setzen sich mit Motiven von Emigranten auseinander, analysieren literarische Texte und authentische Dokumente, um die Welt aus der Sicht der Betroffenen zu verstehen.
Welche Methoden eignen sich für interkulturelles Lernen?
Geeignet sind handlungsorientierte Methoden, die Arbeit mit authentischen Materialien (Filme, Zeitungsartikel) und Rollenspiele, die kulturelle Konfliktsituationen thematisieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Interkulturelle kommunikative Kompetenz (IKK) am Beispiel der Immigration von Mexikanern in die USA (Gymnasium 12. Klasse, Spanisch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1330489