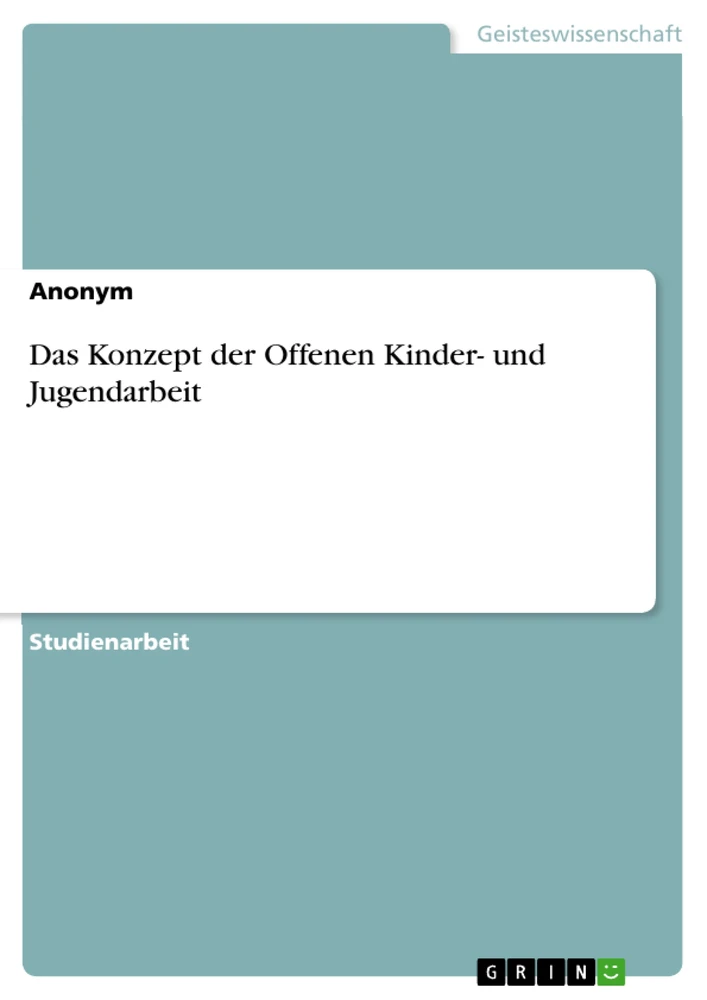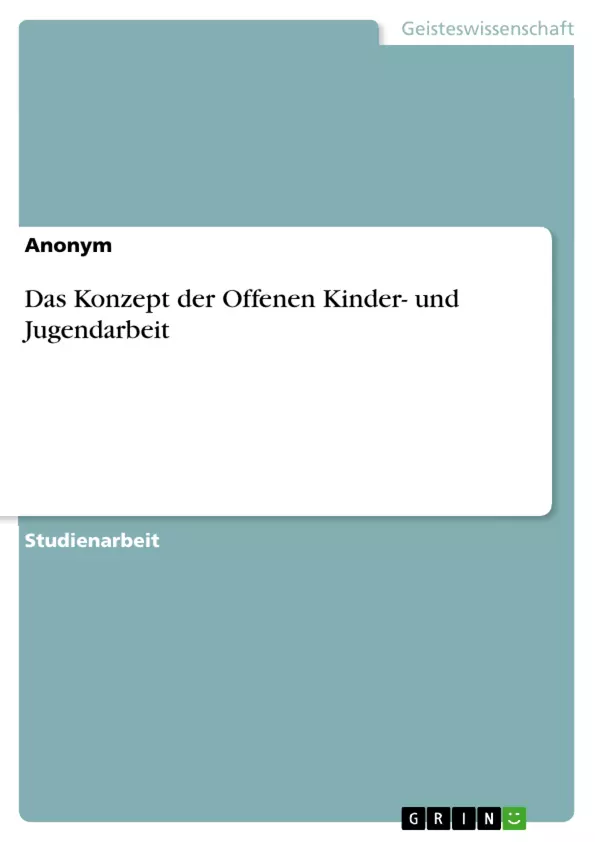Findet Offene Kinder- und Jugendarbeit heute noch so, wie angedacht, statt und ist dieses Konzept noch zeitgemäß?
In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Konzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und stelle dessen Inhalt vor. Dazu betrachte ich die rechtlichen, inhaltlichen und begrifflichen Grundlagen und die Ziele bzw. Aufgaben der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Im Anschluss daran nehme ich Bezug zur aktuellen Situation und diversen Einschätzungen, um somit Antworten auf die o.g. Fragen zu finden.
Deinet verweist in seinem Artikel „Zukunftsmodell Offene Kinder- und Jugendarbeit“ daraufhin, dass „das alte Konzept der offenen Arbeit, d.h. das Prinzip der Offenheit für alle und jeden, stilisiert im offenen Bereich eines jeden Jugendhauses, in dem sich alle Jugendlichen treffen sollen, schon lange an der Wirklichkeit vorbeigeht (Deinet).“
K. Mollenhauer, C.W. Müller, H. Kentler und H. Giesecke, Autoren der außerschulischen Jugendarbeit, fragten zudem Anfang der 60er Jahre „‚Was ist Jugendarbeit?‘ bzw. L. Böhnisch und R. Münchmeier Mitte der 80er Jahre ‚Wozu Jugendarbeit?‘, so scheint im Zuge fiskalpolitisch motivierter Überlegungen seit Mitte der 90er Jahre ‚Warum überhaupt noch Jugendarbeit?‘ zur alles entscheidenden Frage zu avancieren (Scherr/Thole, 1998 zit. n. Fimpler/Hannen, 2016).“
In meinen Betrachtungen zum Thema Offene Kinder- und Jugendarbeit möchte ich den beiden Aussagen wie auch den Fragen nachgehen und in einem abschließendem Fazit resümieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Rechtliche Grundlagen und Ziele
- Charakteristika und Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Aktuelle Situation und Einschätzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und analysiert dessen Inhalt, rechtliche Grundlagen, Ziele und Aufgaben. Die Arbeit beleuchtet zudem die aktuelle Situation und Einschätzungen, um die Relevanz und Zeitgemäßheit des Konzepts zu bewerten.
- Rechtliche Grundlagen und Ziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Charakteristika und Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Relevanz und Zeitgemäßheit des Konzepts
- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Offene Kinder- und Jugendarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Relevanz und Zeitgemäßheit des Konzepts. Sie beleuchtet den Wandel der Jugendarbeit im Laufe der Zeit und die Herausforderungen, denen sie sich heute gegenübersieht.
Das Konzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Dieses Kapitel erläutert das Konzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als Teilbereich der Sozialen Arbeit und beleuchtet dessen rechtliche Grundlagen, Ziele und Charakteristika. Es wird die Bedeutung des Prinzips der Freiwilligkeit hervorgehoben und die vielfältigen Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit beleuchtet.
Aktuelle Situation und Einschätzung
Dieser Abschnitt behandelt die aktuelle Situation der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, ihre Herausforderungen und die Frage, inwieweit sie ihren Zielen gerecht wird. Er beleuchtet kritisch die gesellschaftlichen Veränderungen, die auf die Jugendarbeit einwirken, und ihre Auswirkungen auf das Konzept.
Schlüsselwörter
Offene Kinder- und Jugendarbeit, Freiwilligkeit, Rechtliche Grundlagen, SGB VIII, Ziele, Charakteristika, Prinzipien, Aktuelle Situation, Einschätzung, Zeitgemäßheit, Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernprinzip der Offenen Kinder- und Jugendarbeit?
Das wichtigste Prinzip ist die Freiwilligkeit; Jugendliche entscheiden selbst, ob sie die Angebote wahrnehmen und wie sie ihre Zeit dort gestalten.
Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die Jugendarbeit?
Die gesetzliche Basis findet sich im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), das den Auftrag zur Förderung der Jugendarbeit definiert.
Ist das Konzept der "Offenheit für alle" noch zeitgemäß?
Die Arbeit diskutiert kritisch, ob das klassische Modell des Jugendhauses heute noch der Lebensrealität der Jugendlichen entspricht oder angepasst werden muss.
Was sind die Hauptziele der Offenen Jugendarbeit?
Ziele sind die Förderung der Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung, soziales Lernen und die Bereitstellung von Freiräumen ohne Konsumzwang.
Welche Rolle spielt die Fiskalpolitik für die Jugendarbeit?
Seit den 90er Jahren führen Sparzwänge oft zur Frage nach der Notwendigkeit von Jugendarbeit, was das Konzept unter Rechtfertigungsdruck setzt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Das Konzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331225