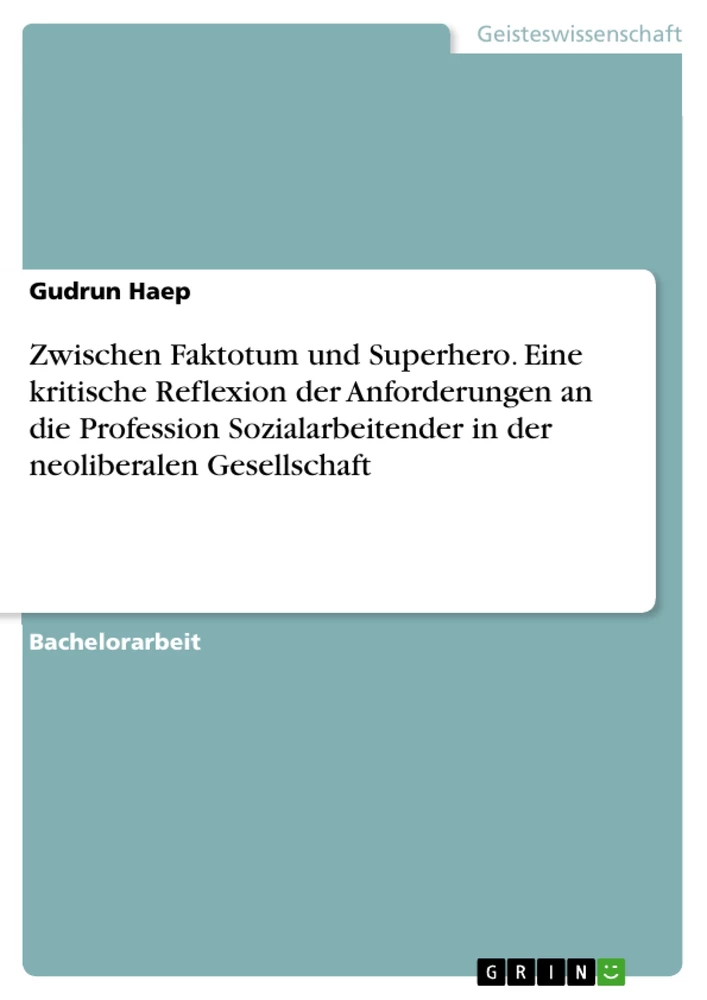Die vorliegende Arbeit legt dar, welche Auswirkungen schon die allgemeinen, traditionell existierenden Anforderungen an Sozialarbeitende haben und untersucht konkret die in der neoliberalen Gesellschaft hinzukommenden darauf, welche Mitarbeitenden gefordert werden. Mit dieser Frage beschäftigt sich diese Arbeit anhand wissenschaftlicher Quellenreflektion unterschiedlicher Autor*innen sowie der sokratischen Methode, Fragen zu stellen, statt vermeintliche Antworten zu kennen. Der Blick soll frei sein, auch für weitere Möglichkeiten, selbst wenn in manchen Textpassagen eine provokante oder polemische Zuspitzung liegen mag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Anforderungen an Sozialarbeitende
- Was tun Sozialarbeitende?
- Schlüsselkompetenzen
- Haltung und Rollendistanz
- Doppel- und Tripelmandat
- Die Profession „Soziale Arbeit“
- Bescheidene Semi-Profession
- Ermöglichungsprofession
- Identität Sozialarbeitender
- Faktotum und Superhero
- Der Begriff „Faktotum“
- Der Begriff „Superhero“
- Berufsaspekte
- Grenzenlos vielfältige Aufgaben
- Frauenquote
- Bezahlung
- Anerkennung
- Habitus
- Macht
- Corona
- Neoliberalismus
- Ökonomisierung
- Anforderungen durch den Neoliberalismus
- Studium nach dem Bolognaprozess
- Effizienz und Effektivität
- Qualitätssicherung
- Standardisierung
- Kontrolle
- Bürokratisierung
- Sponsoring und Fundraising
- VUCA-Kompetenzen
- Responsibilisierung
- Zwei Klassen von Klienten
- Hilfe und Strafe
- Beschäftigungsverhältnisse
- Salutogenese
- Chancen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit den Anforderungen an die Profession Sozialarbeitender in der neoliberalen Gesellschaft. Sie analysiert die komplexen Herausforderungen, denen Sozialarbeitende im Spannungsfeld zwischen idealistischen Zielsetzungen und pragmatischen Realitäten gegenüberstehen.
- Die sich wandelnden Anforderungen an die Profession Sozialarbeitender
- Der Einfluss des Neoliberalismus auf die Arbeitsbedingungen von Sozialarbeitenden
- Die Spannung zwischen Faktotum und Superhero im Berufsfeld der Sozialen Arbeit
- Die Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand in der Sozialen Arbeit
- Die Suche nach einer zukunftsfähigen Positionierung der Sozialen Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die vielfältigen Anforderungen an Sozialarbeitende in der heutigen Zeit. Kapitel 2 beschreibt die allgemeinen Anforderungen an Sozialarbeitende, wie zum Beispiel Schlüsselkompetenzen, Haltung und Rollendistanz sowie das Doppel- und Tripelmandat. Kapitel 3 analysiert die Profession „Soziale Arbeit“ und betrachtet sie als „bescheidene Semi-Profession“ und „Ermöglichungsprofession“. Kapitel 4 befasst sich mit der Identität Sozialarbeitender und stellt die Spannungsfelder zwischen „Faktotum“ und „Superhero“ dar.
Kapitel 5 erläutert die Begriffe „Faktotum“ und „Superhero“ im Kontext der Sozialen Arbeit. Kapitel 6 beleuchtet verschiedene Berufsaspekte wie die Vielfalt der Aufgaben, die Frauenquote, die Bezahlung, die Anerkennung, der Habitus, die Macht und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Kapitel 7 befasst sich mit dem Neoliberalismus und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Kapitel 8 untersucht die Ökonomisierung und ihre Folgen für die Soziale Arbeit. Kapitel 9 analysiert die Anforderungen durch den Neoliberalismus, wie zum Beispiel das Studium nach dem Bolognaprozess, die Effizienz- und Effektivitätsorientierung, die Qualitätssicherung, die Standardisierung, die Kontrolle, die Bürokratisierung, das Sponsoring und Fundraising, die VUCA-Kompetenzen, die Responsibilisierung, die Zwei-Klassen-Gesellschaft, die Verbindung von Hilfe und Strafe, die Beschäftigungsverhältnisse und die Salutogenese.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Sozialarbeit, der Neoliberalismus, die Ökonomisierung, die Anforderungen an die Profession, die Identität von Sozialarbeitenden, die Spannung zwischen Faktotum und Superhero, die Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand, die Herausforderung der Komplexität und die Suche nach einer zukunftsfähigen Positionierung der Sozialen Arbeit in der heutigen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das „Doppelmandat“ in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen dem Auftrag des Staates (Kontrolle/Hilfe) und den Bedürfnissen der Klienten (Unterstützung).
Wie beeinflusst der Neoliberalismus die Soziale Arbeit?
Durch Ökonomisierung, Effizienzorientierung und zunehmende Bürokratisierung wird die Arbeit oft auf messbare Standards reduziert.
Was ist mit den Begriffen „Faktotum“ und „Superhero“ gemeint?
Sie symbolisieren die überzogenen Erwartungen: Sozialarbeiter sollen einerseits Mädchen für alles (Faktotum) und andererseits allmächtige Problemlöser (Superhero) sein.
Welche Rolle spielt die Salutogenese in der Sozialarbeit?
Sie fokussiert auf Faktoren, die den Menschen trotz Belastungen gesund halten, anstatt nur auf die Defizite oder Krankheiten zu blicken.
Was sind VUCA-Kompetenzen?
Sie bezeichnen Fähigkeiten, um in einer Welt voller Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität professionell handlungsfähig zu bleiben.
- Quote paper
- Gudrun Haep (Author), 2022, Zwischen Faktotum und Superhero. Eine kritische Reflexion der Anforderungen an die Profession Sozialarbeitender in der neoliberalen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331701