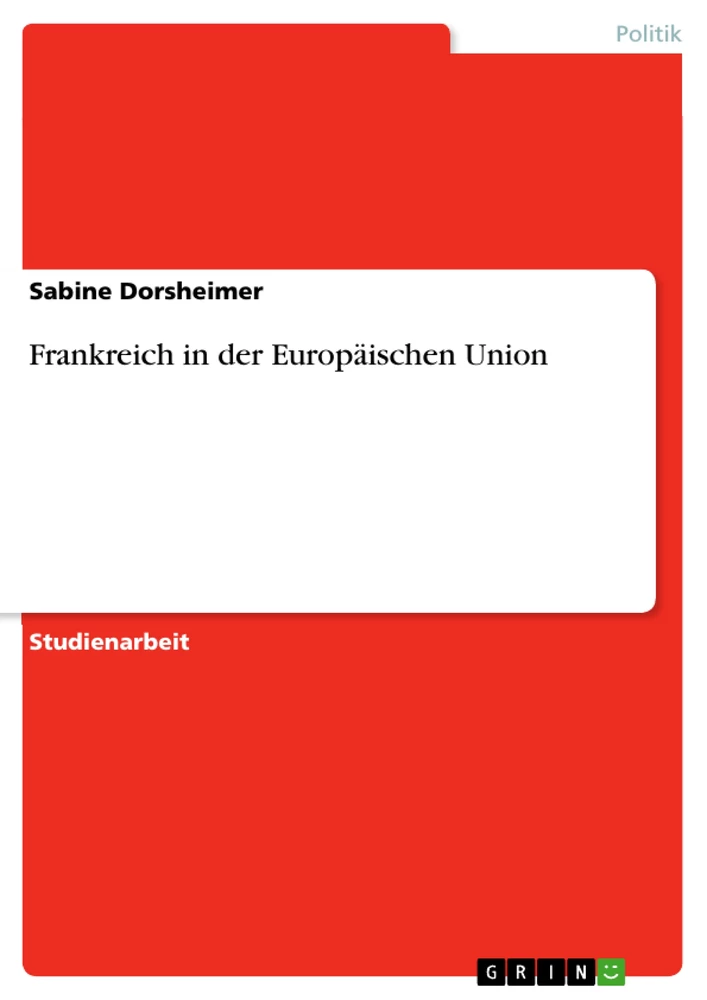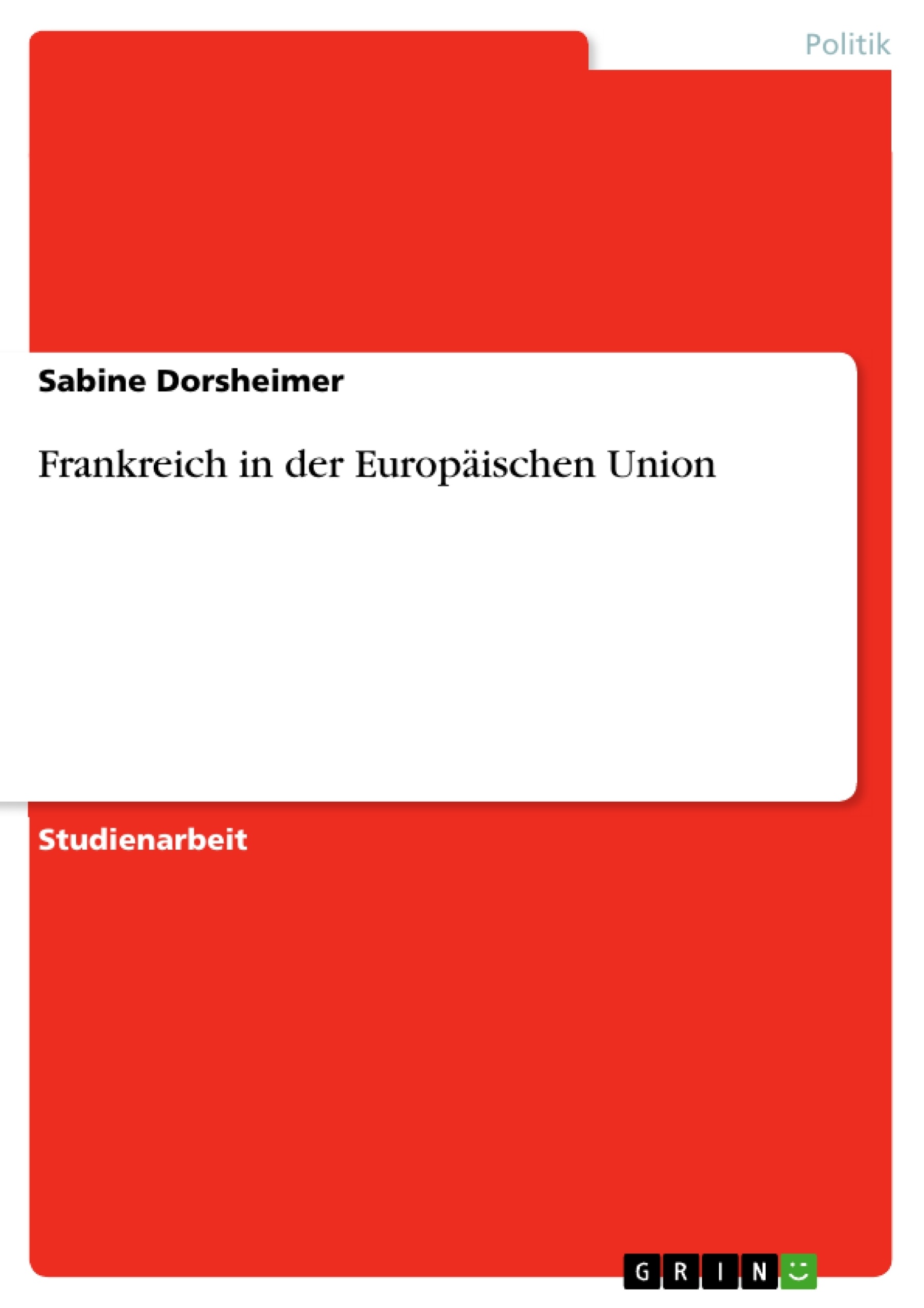„Arms Control is essentially a means of supplementing unilateral military strategy by
some kind of collaboration with countries that are potential enemies.
The aims of arms control and the aims of a national military strategy should be
substantially the same.” (Schelling/Halperin, 1961:142)
So wurde schon vor knapp fünfzig Jahren der Begriff der Rüstungskontrolle definiert.
Auch heute noch steht Rüstungskontrolle – nicht ohne Weiteres gleichzusetzen mit dem
Begriff der Abrüstung - für zwischenstaatliche Verträge oder einseitige Maßnahmen,
die u.a. eine Begrenzung oder Verringerung der militärischen Rüstung vorsehen (vgl.
Schubert/Klein, 2006), was häufig auch als kooperative Rüstungssteuerung (vgl.
Baudissin/Lutz, 1981:13) im Rahmen einer kooperativen Rüstungspolitik (vgl. Müller,
2008:167 und Schmidt, 2008:I) bezeichnet wird.
Vor allem die atomare Rüstungskontrolle ist immer wichtiger geworden, die Gefahr
nuklearer Angriffe und Kriege wird zunehmend gefürchtet.
Doch sind die kooperativen rüstungspolitischen Maßnahmen in den letzten Jahren
immer mehr ins Stocken geraten. Stellt diese Tatsache eine Gefahr für den weltweiten
Frieden, also eine gewaltfreie Konfliktaustragung (vgl. Bonacker/Imbusch, 2006:132)
dar?
Erst der kürzlicheM Machtwechsel in den USA stimmte die Befürworter der
Rüstungskontrolle wieder zuversichtlich.
Im Folgenden soll ein Überblick über die aktuelle Situation bzgl. der Rüstungskontrolle
gegeben werden. Außerdem soll erläutert werden, welche Hindernisse und Probleme es
zu überwinden gilt, damit eine wirksame Rüstungskontrolle fortgeführt werden kann.
Nach einem kurzen Ausblick, welche Veränderungen und Bewegungen des Status quo
hinsichtlich des neuen US-Präsidenten Barack Obama erwartet werden können, soll
schließlich eine Antwort auf die Frage möglich sein, ob die Fortführung der
Rüstungskontrolle gefährdet ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Beteiligung Frankreichs am Aufbau Europas
- 3. Die französische Beteiligung an Europa
- 3.1 Die Verknüpfung französischer Institutionen in der europapolitischen Praxis
- 3.2 Die Europa-Delegation
- 3.3 Das SGCI
- 3.4 Die Rolle des Conseil d'Etat
- 4. Europa in der aktuellen französischen Regierungspraxis
- 4.1 Scheitern des Verfassungsreferendums 2005
- 4.2 Zukünftige Entwicklung unter Sarkozy
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Koordinierung und Verankerung der französischen Beteiligung an der Europäischen Union innerhalb französischer Institutionen. Sie analysiert die Verfahren und Institutionen, die diese Beteiligung ermöglichen und unterstützen. Die Arbeit beleuchtet den Spagat zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration aus französischer Perspektive.
- Die historische Rolle Frankreichs beim Aufbau der EU
- Die Verknüpfung französischer Institutionen mit der EU
- Die Rolle spezifischer französischer Institutionen in der Europapolitik
- Das gescheiterte Verfassungsreferendum 2005
- Zukünftige Entwicklungen der französischen Europapolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Koordinierung und Verankerung der französischen Europa-Beteiligung in den französischen Institutionen und den dazugehörigen Verfahren. Sie führt in die Rolle Frankreichs als „Motor der EU“ ein und beschreibt die Notwendigkeit, den Spagat zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration zu analysieren. Der Aufbau der Arbeit mit einem historischen Überblick, der Analyse der beteiligten Institutionen und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung unter Sarkozy wird skizziert.
2. Die Beteiligung Frankreichs am Aufbau Europas: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die französische Beteiligung am Aufbau der EU nach dem Zweiten Weltkrieg. Es zeigt, wie das Sicherheitsbedürfnis Frankreichs nach der Niederlage 1940 und die Furcht vor Deutschland die europäische Integration vorantrieben. Die Entwicklung von der Idee einer Länderföderation bis hin zur Einbindung Deutschlands in europäische Strukturen wird beschrieben, wobei die Rolle Frankreichs als Initiator und die Bedeutung der EGKS und EWG hervorgehoben werden. Der schwierige Balanceakt zwischen nationaler Identität und europäischer Integration wird in diesem Kontext verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Frankreich, Europäische Union, Europapolitik, Institutionen, Regierungspraxis, nationale Souveränität, europäische Integration, Verfassungsreferendum, Grande Nation, intergouvernementale Methoden, EGKS, EWG.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Frankreichs Beteiligung an der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Koordinierung und Verankerung der französischen Beteiligung an der Europäischen Union innerhalb französischer Institutionen. Sie analysiert die Verfahren und Institutionen, die diese Beteiligung ermöglichen und unterstützen, und beleuchtet den Spagat zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration aus französischer Perspektive.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Rolle Frankreichs beim Aufbau der EU, die Verknüpfung französischer Institutionen mit der EU, die Rolle spezifischer französischer Institutionen (z.B. Conseil d'Etat, Europa-Delegation, SGCI) in der Europapolitik, das gescheiterte Verfassungsreferendum 2005 und zukünftige Entwicklungen der französischen Europapolitik unter Sarkozy. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Institutionen und Verfahren, die die französische Europa-Beteiligung ermöglichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Beteiligung Frankreichs am Aufbau Europas, Die französische Beteiligung an Europa (inkl. Unterkapitel zu verschiedenen Institutionen), Europa in der aktuellen französischen Regierungspraxis (inkl. Scheitern des Referendums 2005 und Ausblick auf die Entwicklung unter Sarkozy), Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselinstitutionen werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert die Rolle verschiedener französischer Institutionen in der Europapolitik, darunter die Europa-Delegation, das SGCI (Secrétariat général du Comité interministériel), und den Conseil d'Etat. Die Arbeit untersucht, wie diese Institutionen die französische Beteiligung an der EU koordinieren und unterstützen.
Welche Rolle spielte Frankreich beim Aufbau der EU?
Die Arbeit beschreibt die historische Rolle Frankreichs als wichtigen Akteur beim Aufbau der EU nach dem Zweiten Weltkrieg. Frankreichs Sicherheitsbedürfnisse und die Furcht vor Deutschland werden als wichtige Triebkräfte der europäischen Integration dargestellt. Die Entwicklung von der Idee einer Länderföderation bis zur Einbindung Deutschlands in europäische Strukturen wird im Kontext der Rolle Frankreichs als Initiator und der Bedeutung von EGKS und EWG beleuchtet.
Wie wird das Verhältnis zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration dargestellt?
Die Hausarbeit untersucht den Spagat zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration aus französischer Perspektive. Es wird analysiert, wie Frankreich versucht, seine nationale Identität zu bewahren, während es gleichzeitig eng in die europäischen Strukturen eingebunden ist. Das gescheiterte Verfassungsreferendum 2005 dient als Beispiel für die Herausforderungen dieses Spannungsfelds.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
(Der Inhalt des Fazit-Kapitels ist in der Vorschau nicht enthalten. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch einen Hinweis auf die behandelten Themen und die möglichen Schlussfolgerungen.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Frankreich, Europäische Union, Europapolitik, Institutionen, Regierungspraxis, nationale Souveränität, europäische Integration, Verfassungsreferendum, Grande Nation, intergouvernementale Methoden, EGKS, EWG.
- Arbeit zitieren
- Sabine Dorsheimer (Autor:in), 2008, Frankreich in der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133177