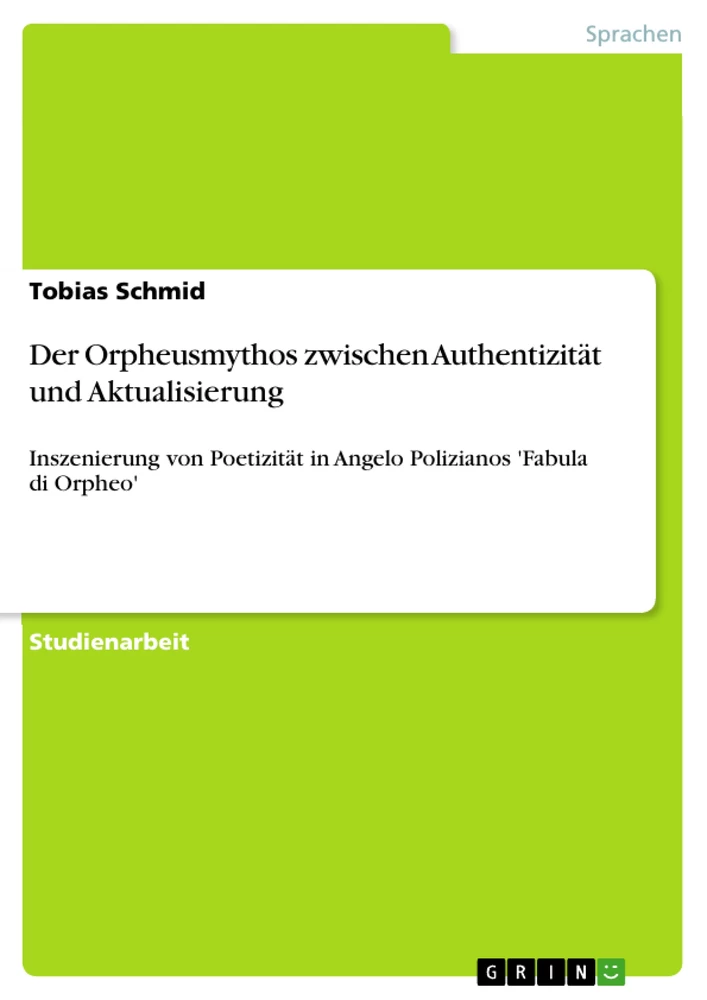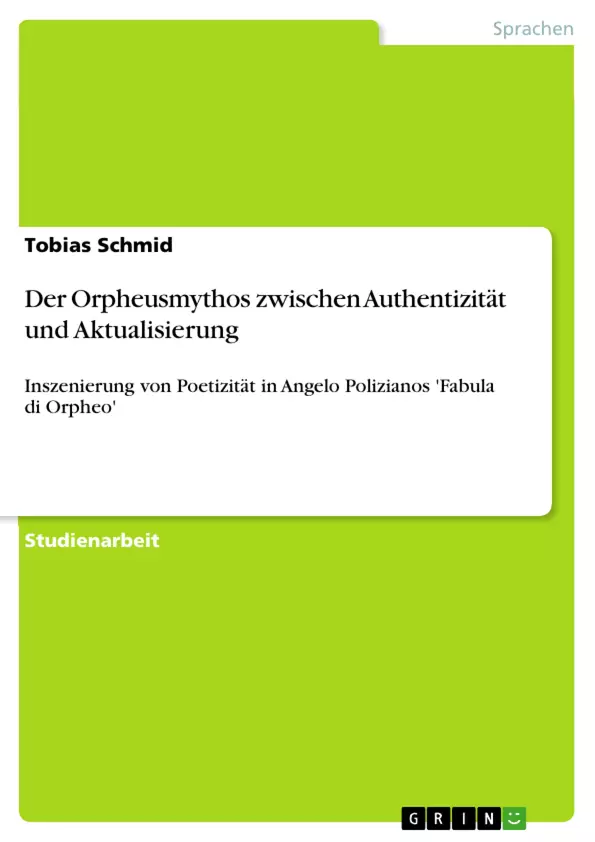[...] Die These, daß ein Text der Hochrenaissance, im Umkreis des Florentiner Neuplatonismus
entstanden, seine eigene Poetizität thematisiert, diese geradezu in den Vordergrund seiner eigenen
Gestaltung rückt, verschiebt den Kontext der Fragestellung. Denn bei aller Plausibilität können
pragmatische Erklärungen rhetorisch-strategischer Funktionen diesen Umstand nicht zureichend,
ja überhaupt nicht erklären. Angesichts der vorausgegangenen Epoche des Mittelalters
geht es hier um einen grundsätzlichen Wandel im Selbstverständnis des Künstlers und nicht zuletzt
des Kunstwerkes selbst. Diese These, deren Nachweis es hier zu führen gilt, wirft, und das
ist nicht zu weit gegriffen, einen epochalen Fragehorizont auf. Wie ist es möglich, daß ein solcher
Text im Kontext der Frühen Neuzeit, genauer im Kontext des rinascimentalen Neuplatonismus
verfaßt werden konnte? Es stellt sich hierbei nicht nur die Frage nach der Diskontinuität (und
Kontinuität) von Mittelalter und Neuzeit, sondern auch nach der Kontinuität und Diskontinuität
innerhalb der Renaissance selbst. Denn Poliziano selbst sah sich genötigt, ein epochales Kunstund
Textverständnis gegenüber der Philosophie eines Marsilio Ficino durchzusetzen, einen
Bruch innerhalb der Ästhetik der Renaissance zu forcieren, ein Bruch, der offenbar sowohl auf
theoretischer wie praktisch-ästhetischer Ebene eine gewisse polemische Haltung erforderte. Damit
allein wäre aber die Komplexität des Sachverhaltes nicht erfaßt. Das im Grunde vom Mittelalter
tradierte Textverständnis, das auch für Ficino noch grundlegend ist, wird erst durch Poliziano
problematisiert. Und doch, auch dies soll gezeigt werden, hat die Möglichkeit der Fabula di
Orpheo die neuplatonische Dichtungstheorie, die Konzeption des furor poeticus zur Voraussetzung. Wenn der Aufbau dieser Arbeit den literaturwissenschaftlichen Teil um eine theoretische Darstellung
ergänzt, ist dies keine unnötige Abschweifung. Vielmehr soll die kontinuierlichdiskontinuierliche
Bewegung, die die Fabula ermöglicht, auf zwei Diskursebenen veranschaulicht werden, derer sich Poliziano zu gleicher Zeit bedient hat. Und erst diese doppelte Analyse wird es
leisten können, diesen Einschnitt in der Ästhetik der Renaissance zu konturieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die theoretische Rehabilitierung des Textes
- Die Polemik der Lamia
- Von der Rhetorik zur Ästhetik
- Die Fabula di Orpheo
- Orpheus und die Poesie bei Ficino
- Die Fabula und ihre Quellen
- Die Struktur der Fabula
- Schluß
- Bibliographie
- Quellen
- Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Fabula di Orpheo von Angelo Poliziano im Kontext des Florentiner Neuplatonismus und der frühen Neuzeit. Sie analysiert die Poetizität des Textes und seine Beziehung zu den antiken Quellen sowie zur neuplatonischen Dichtungstheorie. Die Arbeit untersucht, wie Poliziano die Historizität des Orpheusmythos mit seiner Aktualität verbindet und wie er die ästhetische Eigenständigkeit des Textes gegenüber pragmatischen und philosophischen Interpretationen betont.
- Die Poetizität des Textes und seine Beziehung zu den antiken Quellen
- Die Rehabilitierung des Textes im Kontext der frühen Neuzeit
- Die Rolle der Rhetorik und der Ästhetik in der Fabula di Orpheo
- Die Bedeutung des Orpheusmythos für die Renaissance
- Die Aktualisierung des Antiken in der Fabula di Orpheo
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die These auf, dass die Fabula di Orpheo die eigene Poetizität thematisiert und diese in den Vordergrund ihrer Gestaltung rückt. Sie skizziert den historischen Kontext der Arbeit und die Bedeutung des Textes für die Ästhetik der Renaissance. Das zweite Kapitel analysiert die Polemik von Poliziano gegen die Florentiner Philosophen in seiner Lamia-Praelectio und untersucht, wie er die philologische Tätigkeit rehabilitiert und die Historizität des Textes betont. Im dritten Kapitel wird die Fabula di Orpheo im Kontext der neuplatonischen Dichtungstheorie von Ficino betrachtet. Es wird gezeigt, wie Poliziano die traditionelle Allegorese des Orpheusmythos transzendiert und die ästhetische Eigenständigkeit des Textes hervorhebt. Das vierte Kapitel analysiert die Struktur der Fabula di Orpheo und zeigt, wie Poliziano die antiken Quellen, insbesondere Vergil und Ovid, imitiert und zugleich aktualisiert. Das fünfte Kapitel untersucht die Rolle des Eros in der Fabula und die Verbindung von Affekt und Ästhetik im Text. Es wird gezeigt, wie die ästhetische Haltung des Textes zu einem Schweigen führt, das nicht als Einbruch der Realität in die Kunst verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Orpheusmythos, die Fabula di Orpheo, Angelo Poliziano, Florentiner Neuplatonismus, Renaissance, Poetizität, Rhetorik, Ästhetik, Historizität, Aktualität, Antike, Ovid, Vergil, Ficino, Eros, Affekt, Literatur, Mythos, Kunst, Interpretation, Text, Sprache, Form, Struktur, Traditionsbewusstsein, Selbstreferenz, Schweigen, Philosophie, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Fabula di Orpheo" von Angelo Poliziano?
Es ist ein bedeutendes literarisches Werk der italienischen Renaissance, das den Orpheusmythos im Kontext des Florentiner Neuplatonismus behandelt.
Welche Rolle spielt Marsilio Ficino für dieses Werk?
Ficinos neuplatonische Dichtungstheorie und sein Konzept des "furor poeticus" bilden die theoretische Voraussetzung für Polizianos Orpheus-Darstellung.
Was thematisiert Poliziano in Bezug auf die Poetizität?
Die Arbeit zeigt auf, dass der Text seine eigene poetische Gestaltung in den Vordergrund rückt und damit einen Wandel im Selbstverständnis des Künstlers markiert.
Wie geht Poliziano mit antiken Quellen um?
Er imitiert und aktualisiert Quellen wie Vergil und Ovid, bricht aber zugleich mit traditionellen, rein philosophischen Interpretationen des Mittelalters.
Was bedeutet der "Bruch innerhalb der Ästhetik der Renaissance"?
Poliziano forciert ein neues Textverständnis, das sich von der rein allegorischen Deutung löst und die ästhetische Eigenständigkeit des Kunstwerks betont.
- Quote paper
- Tobias Schmid (Author), 2006, Der Orpheusmythos zwischen Authentizität und Aktualisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133226