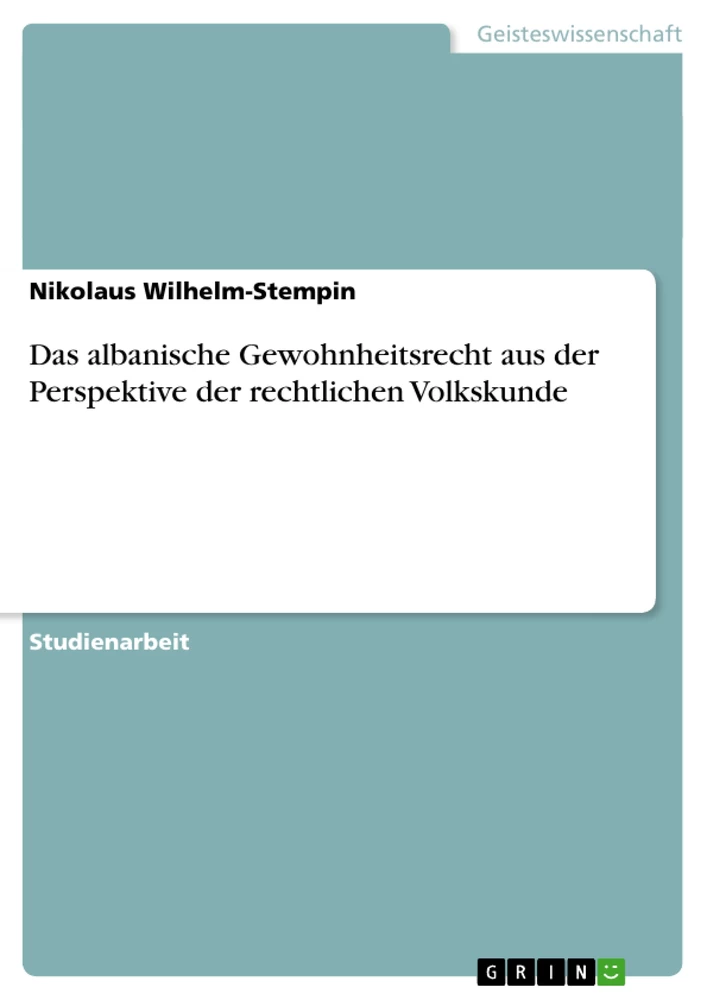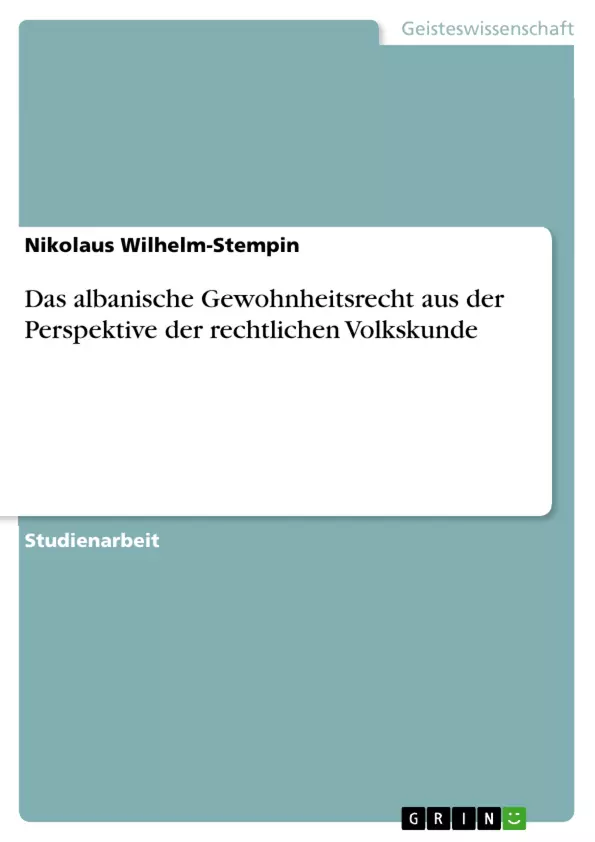Unter Einbeziehung des Ansatzes einer rechtlichen Volkskunde nach Karl-S. Kramer beschäftigt sich der Autor dieses Aufsatzes mit der Problematik der Unvereinbarkeit zwischen Gewohnheitsrecht und staatlichem Recht. Als Beispiel dient hier der "Kanun", der in den alpinen Regionen Nordalbaniens bis heute Gültigkeit hat. Auch im benachbarten Kosovo haben sich bis heute Reste eines alten tradierten Gewohnheitsrechtes bewahrt. Der Artikel aus dem Jahre 2001 ist auch heute noch aktuell, vor allem seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Jahre 2008 und den damit verbundenen internationalen Bemühungen, moderne Rechtsnormen für dsa Kosovo zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- A. Abgrenzung des Themas
- B. Allgemeines über das Gewohnheitsrecht
- I. Geographische Abgrenzung
- II. Herkunft des Kanun
- 1. Die Entwicklung des Gewohnheitsrechtes bei den Albanern
- 2. Der Kanun des Leka Dukagjin
- III. Die balkanische Patriarchalität
- IV. Teilaspekte des Kanun
- 1. Die Heirat
- 2. Die Ehre
- 3. Die Blutrache
- V. Kollisionen mit dem staatlichen Recht
- 1. Albanien
- 2. Die albanischen Gebiete Jugoslawiens und dessen Nachfolgestaaten
- VI. Lösungsansätze
- C. Ausblick für eine rechtliche Volkskunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das traditionelle Gewohnheitsrecht der Albaner auf dem Balkan, insbesondere den Kanun, und dessen Interaktion mit staatlichen Rechtssystemen. Es wird analysiert, wie dieses patriarchal geprägte System die Beziehungen zwischen der Bevölkerung und staatlichen Institutionen beeinflusst und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
- Das albanische Gewohnheitsrecht (Kanun) und seine historische Entwicklung
- Der Einfluss geographischer und sozialer Faktoren auf die Ausprägung des Kanun
- Konflikte zwischen dem Kanun und staatlichen Rechtsordnungen
- Die Rolle des Kanun im Kontext der albanischen Identität und des Nationalismus
- Lösungsansätze für die Koexistenz von traditionellem und staatlichem Recht
Zusammenfassung der Kapitel
A. Abgrenzung des Themas: Der Text kündigt eine Untersuchung der Überschneidung traditioneller Rechtsauffassungen und Bräuche der albanischen Bevölkerung mit staatlicher Gesetzgebung an. Besonders wird das patriarchale System und sein Verhältnis zu staatlichen Institutionen im Fokus stehen. Es wird jedoch auch auf den politischen Charakter des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Sekundärliteratur hingewiesen, um den jeweiligen politischen Standpunkt der Autoren zu berücksichtigen.
B. Allgemeines über das Gewohnheitsrecht: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das albanische Gewohnheitsrecht, dessen geographische Verbreitung (Norden Albaniens, Kosovo, Teile Montenegros) und seine unterschiedliche Bedeutung in verschiedenen Regionen beleuchtet werden. Es wird der Kanun i Lekë Dukagjinit als wichtigstes Beispiel genannt, wobei auf regionale Variationen und den Rückgang seiner Bedeutung in Süd-Albanien hingewiesen wird. Die räumliche Eingrenzung des „klassischen“ Gewohnheitsrechts wird ebenfalls thematisiert.
B.I. Geographische Abgrenzung: Dieser Abschnitt beschreibt die geographische Verbreitung der albanischen Bevölkerung im Westbalkan und die damit verbundenen Herausforderungen einer einheitlichen Betrachtung des Verhältnisses der Albaner zu den jeweiligen Staaten. Die politische Geschichte der albanischen Minderheiten in den Nachbarländern und deren Streben nach Unabhängigkeit werden kurz angerissen. Der Fokus liegt auf der räumlichen Eingrenzung des traditionellen Gewohnheitsrechts, welches vor allem in abgelegenen nördlichen Gebieten Albaniens und Teilen des Kosovo noch eine relevante Rolle spielt.
B.II. Herkunft des Kanun: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des albanischen Gewohnheitsrechts. Es wird auf Theorien verwiesen, die die Wurzeln des Kanun in der illyrischen Zeit sehen und die Bedeutung naturräumlicher Bedingungen für die Entstehung und Erhaltung des Systems hervorheben. Die Rolle des Kanun während der römischen, byzantinischen und osmanischen Herrschaft, sowie seine Bedeutung im Kontext der albanischen Selbstbehauptung werden detailliert beschrieben. Die Koexistenz des Kanun mit anderen Rechtssystemen wird hervorgehoben.
B.II.1. Die Entwicklung des Gewohnheitsrechtes bei den Albanern: Die Entwicklung des Gewohnheitsrechts wird im Kontext der geographischen und historischen Bedingungen des Balkans dargestellt. Die "Ordnung von Berg und Tal" und die "Logik des kurzen und langen Weges" werden als prägende Faktoren für die Entstehung und Persistenz des Gewohnheitsrechts beschrieben. Die Isoliertheit der Bergdörfer und der Widerstand gegen die Einmischung fremder Mächte in die traditionelle Ordnung werden als Gründe für die Erhaltung des Kanun bis in die heutige Zeit angeführt. Der Widerstand gegen die staatliche Macht nach der Unabhängigkeit Albaniens wird als Beispiel genannt.
B.II.2. Der Kanun des Leka Dukagjin: Dieser Abschnitt behandelt den Kanun des Leka Dukagjin, dessen genaue historische Einordnung ungeklärt ist. Es werden unterschiedliche Theorien zu seinem Ursprung und seiner Kodifizierung diskutiert, darunter der Einfluss des serbischen Gesetzbuches des Zaren Dušan. Die lange Zeit der ungeschriebenen Überlieferung und die Gründe dafür werden erläutert, wobei die Bedeutung des mündlichen Wissens und die Ablehnung einer schriftlichen Fixierung als Ausdruck der traditionellen Rechtskultur betont werden.
Schlüsselwörter
Kanun, Gewohnheitsrecht, Albanien, Balkan, Patriarchalität, Staat, Recht, Volkskunde, Blutrache, Ehre, Familie, Tradition, Moderne, Konflikt, Koexistenz, Leka Dukagjin, Geschichte, Nationalismus, Identität.
Häufig gestellte Fragen zum albanischen Gewohnheitsrecht (Kanun)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das traditionelle Gewohnheitsrecht der Albaner auf dem Balkan, insbesondere den Kanun, und dessen Interaktion mit staatlichen Rechtssystemen. Der Fokus liegt auf dem patriarchal geprägten System und dessen Einfluss auf die Beziehungen zwischen Bevölkerung und staatlichen Institutionen sowie den daraus resultierenden Herausforderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des albanischen Gewohnheitsrechts (Kanun), den Einfluss geographischer und sozialer Faktoren auf seine Ausprägung, Konflikte zwischen dem Kanun und staatlichen Rechtsordnungen, die Rolle des Kanun im Kontext der albanischen Identität und des Nationalismus, sowie Lösungsansätze für die Koexistenz von traditionellem und staatlichem Recht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Abschnitte A. Abgrenzung des Themas, B. Allgemeines über das Gewohnheitsrecht (mit Unterabschnitten zur geographischen Abgrenzung, Herkunft des Kanun inklusive der Entwicklung des Gewohnheitsrechts bei den Albanern und dem Kanun des Leka Dukagjin, der balkanischen Patriarchalität, Teilaspekten des Kanun wie Heirat, Ehre und Blutrache, Kollisionen mit dem staatlichen Recht in Albanien und den albanischen Gebieten Jugoslawiens und dessen Nachfolgestaaten sowie Lösungsansätzen) und C. Ausblick für eine rechtliche Volkskunde.
Was ist der Kanun und woher stammt er?
Der Kanun ist das wichtigste Beispiel für das albanische Gewohnheitsrecht. Seine Entstehung und Entwicklung werden im Kontext der geographischen und historischen Bedingungen des Balkans dargestellt. Es gibt Theorien, die seine Wurzeln in der illyrischen Zeit sehen. Der Kanun des Leka Dukagjin ist ein zentrales Thema, dessen genaue historische Einordnung jedoch ungeklärt ist. Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Theorien zu seinem Ursprung und seiner Kodifizierung.
Welche geographische Verbreitung hat der Kanun?
Der Kanun war vor allem in abgelegenen nördlichen Gebieten Albaniens und Teilen des Kosovo relevant. Die Arbeit beleuchtet die geographische Verbreitung der albanischen Bevölkerung im Westbalkan und die damit verbundenen Herausforderungen einer einheitlichen Betrachtung des Verhältnisses der Albaner zu den jeweiligen Staaten.
Welche Konflikte gibt es zwischen dem Kanun und staatlichem Recht?
Die Arbeit analysiert die Konflikte zwischen dem Kanun und staatlichen Rechtsordnungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Koexistenz des Kanun mit anderen Rechtssystemen während der römischen, byzantinischen und osmanischen Herrschaft. Der Widerstand gegen die staatliche Macht nach der Unabhängigkeit Albaniens wird als Beispiel für die anhaltende Relevanz des Kanun genannt.
Welche Rolle spielt der Kanun in Bezug auf albanische Identität und Nationalismus?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Kanun im Kontext der albanischen Identität und des Nationalismus. Es wird die Bedeutung des Kanun für die albanische Selbstbehauptung und die Herausforderungen seiner Koexistenz mit der staatlichen Ordnung behandelt.
Welche Lösungsansätze für die Koexistenz von traditionellem und staatlichem Recht werden vorgestellt?
Die Arbeit skizziert Lösungsansätze für die Koexistenz von traditionellem und staatlichem Recht. Dies umfasst eine detaillierte Analyse der Herausforderungen und möglichen Strategien zur Integration und Harmonisierung beider Rechtssysteme.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kanun, Gewohnheitsrecht, Albanien, Balkan, Patriarchalität, Staat, Recht, Volkskunde, Blutrache, Ehre, Familie, Tradition, Moderne, Konflikt, Koexistenz, Leka Dukagjin, Geschichte, Nationalismus, Identität.
- Quote paper
- Nikolaus Wilhelm-Stempin (Author), 2001, Das albanische Gewohnheitsrecht aus der Perspektive der rechtlichen Volkskunde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133353