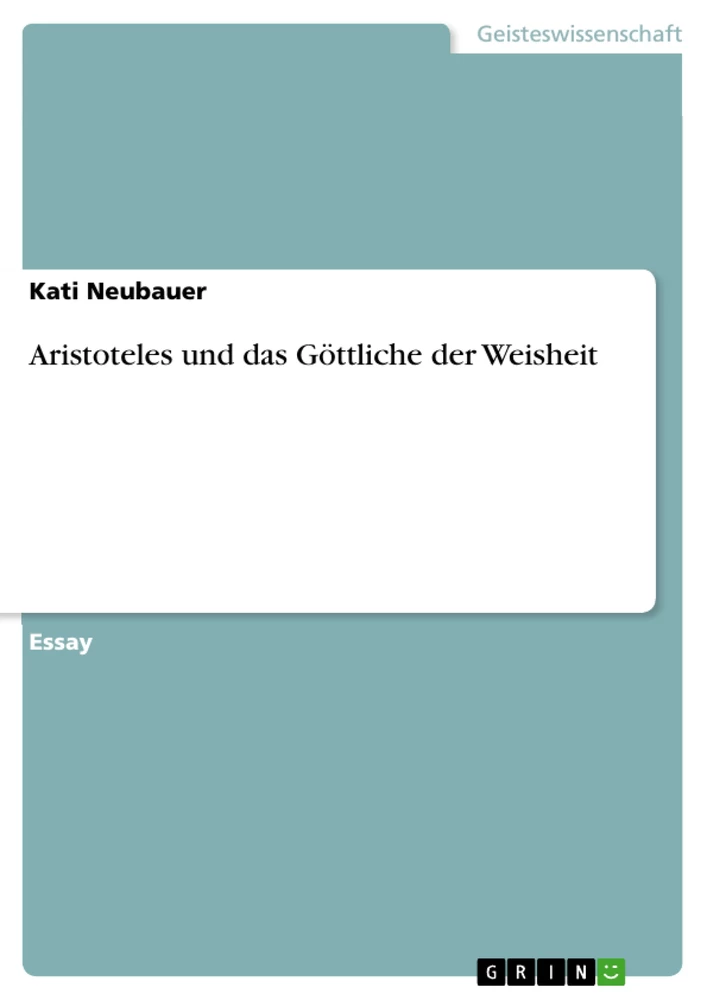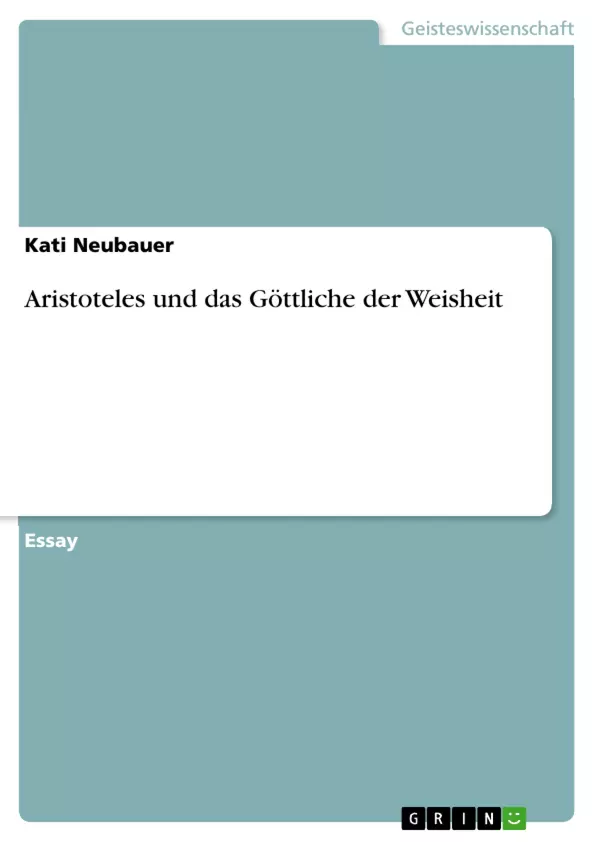Aristoteles untersucht im ersten Kapitel der Metaphysik was unter dem Begriff „Weisheit“ (sophia) zu verstehen und inwieweit sie göttlich ist. Diese Begriffliche Konstruktion soll in dem vorliegenden Kutzessay nachvollzogen werden.
Aristoteles und das Göttliche der Weisheit
Aristoteles: Metaphysik; Buch A; 1. Kapitel
Skizzierung, wie sich nach Aristoteles die Weisheit von anderen Arten des Wissens unterscheidet. Was versteht er unter Weisheit und inwiefern ist sie etwas „Göttliches“ für ihn?
Aristoteles untersucht im ersten Kapitel der Metaphysik (die im Ganzen aus 14 Büchern besteht) was unter dem Begriff „Weisheit“ (sophia) zu verstehen ist. Er selbst spricht nicht von der Metaphysik, sondern von der „Wissenschaft des Ersten“[1] in diesem Zusammenhang.
Aristoteles beginnt damit, Unterscheidungen zu formulieren, die den Begriff der „Weisheit“ im Anschluss abgrenzen sollen. Er erarbeitet, dass die Sinnenswahrnehmungen etwas den Lebewesen von Natur aus angeborenes sind. Sinneswahrnehmungen sind somit für ihn die erste Stufe de Wissens. Das Sehen sei dabei die beliebteste der Wahrnehmungen, da man mit Hilfe der Augen, im Vergleich zu den anderen Sinnen, am meisten erkennen und unterscheiden könnte. Diese Differenzierung lässt sich durch die Zeit, in der Aristoteles lebt, erklären, in der die Betrachtung der Dinge, ohne selbst involviert zu sein, besondere Bedeutung hatte. Dennoch hält er im späteren Verlauf fest, dass die Sinneswahrnehmungen nichts mit der Weisheit zu tun haben können, da sie, wie gesagt, angeboren und somit jedem eigen sind. Dadurch definiert er die Weisheit als etwas Besonderes und nicht alltägliches.
Aristoteles nähert sich im Folgenden dem Weisheitsbegriff „von unten“ her. Er erklärt, dass wenn allen Lebwesen die Sinneswahrnehmungen angeboren seien, nicht bei allen zwangsläufig eine Erinnerung entstehen würde, worin Aristoteles die erste Unterscheidung zu den gelehrigeren und einsichtigeren Lebewesen macht. Hinzu kommt eine Untergruppierung der Lebewesen, die den Schall nicht hören können und seiner Ansicht nach auch „ohne Lernen einsichtig sind […]“[2]. Alle anderen Lebewesen, „[…]die außer der Erinnerung auch die Wahrnehmung des Schalles haben“[3], seinen lernfähig. Die Lernfähigkeit ist damit als Umsetzung der Erinnerung und des Wissens zu verstehen. Somit ist auch hören für Aristoteles eine Voraussetzung, um zum Lernen in der Lage zu sein.
Aristoteles setzt in 980a, Zeile 27 voraus, dass Erfahrung aus Erinnerungen erwachse. Der Mensch habe dazu die Fähigkeit des schlussfolgernden Denkens und der „Kunst“. Er erklärt weiter, dass aus der Fähigkeit zur Erfahrung die Wissenschaft und die Kunst entstünden. Die Erfahrung ist damit eine weitere Stufe des Wissens, die aber lediglich die Bündelung von Vorstellungen beinhaltet.
[...]
[1] 982a; Zeile 27
[2] 980a; Zeile 23
[3] 980a; Zeile 26
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Aristoteles den Begriff "Weisheit" (sophia)?
Aristoteles versteht unter Weisheit das Wissen um die ersten Ursachen und Prinzipien der Dinge. Sie unterscheidet sich von bloßer Erfahrung dadurch, dass sie das "Warum" und nicht nur das "Dass" erklärt.
Inwiefern ist Weisheit für Aristoteles etwas "Göttliches"?
Sie ist göttlich, weil Gott als die erste Ursache aller Dinge angesehen wird. Das Streben nach dieser höchsten Form des Wissens ist somit eine Annäherung an das Göttliche.
Was ist der Unterschied zwischen Sinneswahrnehmung und Weisheit?
Sinneswahrnehmungen sind angeboren und allen Lebewesen eigen. Weisheit hingegen ist ein erworbenes, besonderes Wissen, das über die alltägliche Wahrnehmung hinausgeht und schlussfolgerndes Denken erfordert.
Welche Rolle spielt die Erinnerung im Erkenntnisprozess?
Aus der Wahrnehmung entsteht bei einigen Lebewesen Erinnerung. Aus der Bündelung vieler Erinnerungen erwächst beim Menschen die Erfahrung, welche die Grundlage für Kunst und Wissenschaft bildet.
Warum hält Aristoteles das Sehen für die wichtigste Wahrnehmung?
Laut Aristoteles ermöglicht das Sehen im Vergleich zu anderen Sinnen das meiste Erkennen und Differenzieren, was für die theoretische Betrachtung der Welt von zentraler Bedeutung ist.
- Citar trabajo
- Kati Neubauer (Autor), 2005, Aristoteles und das Göttliche der Weisheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133369