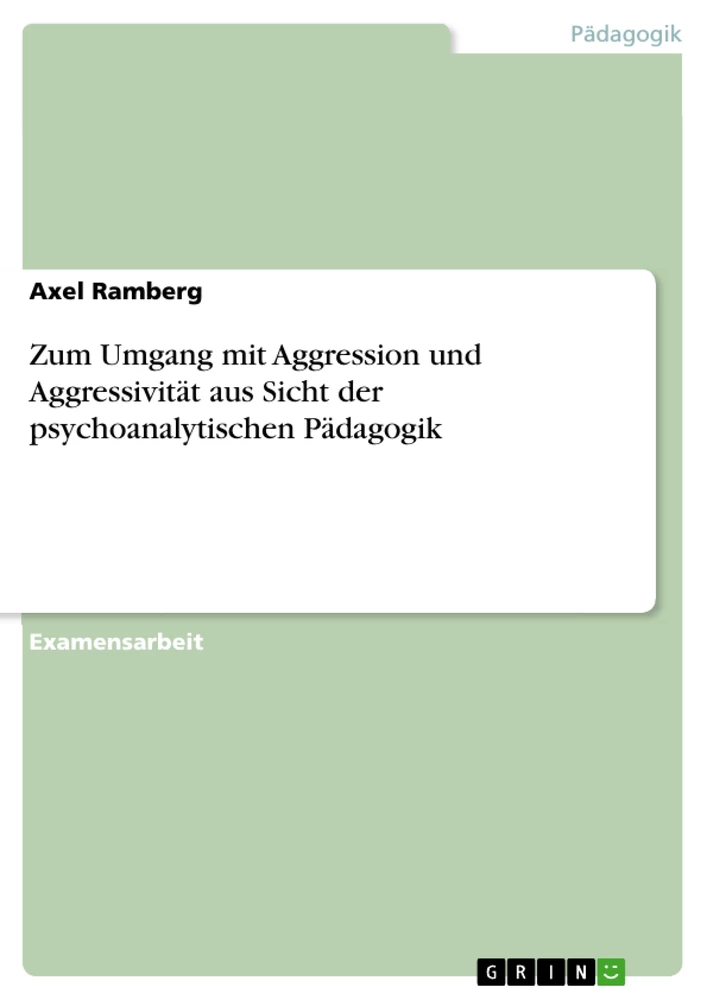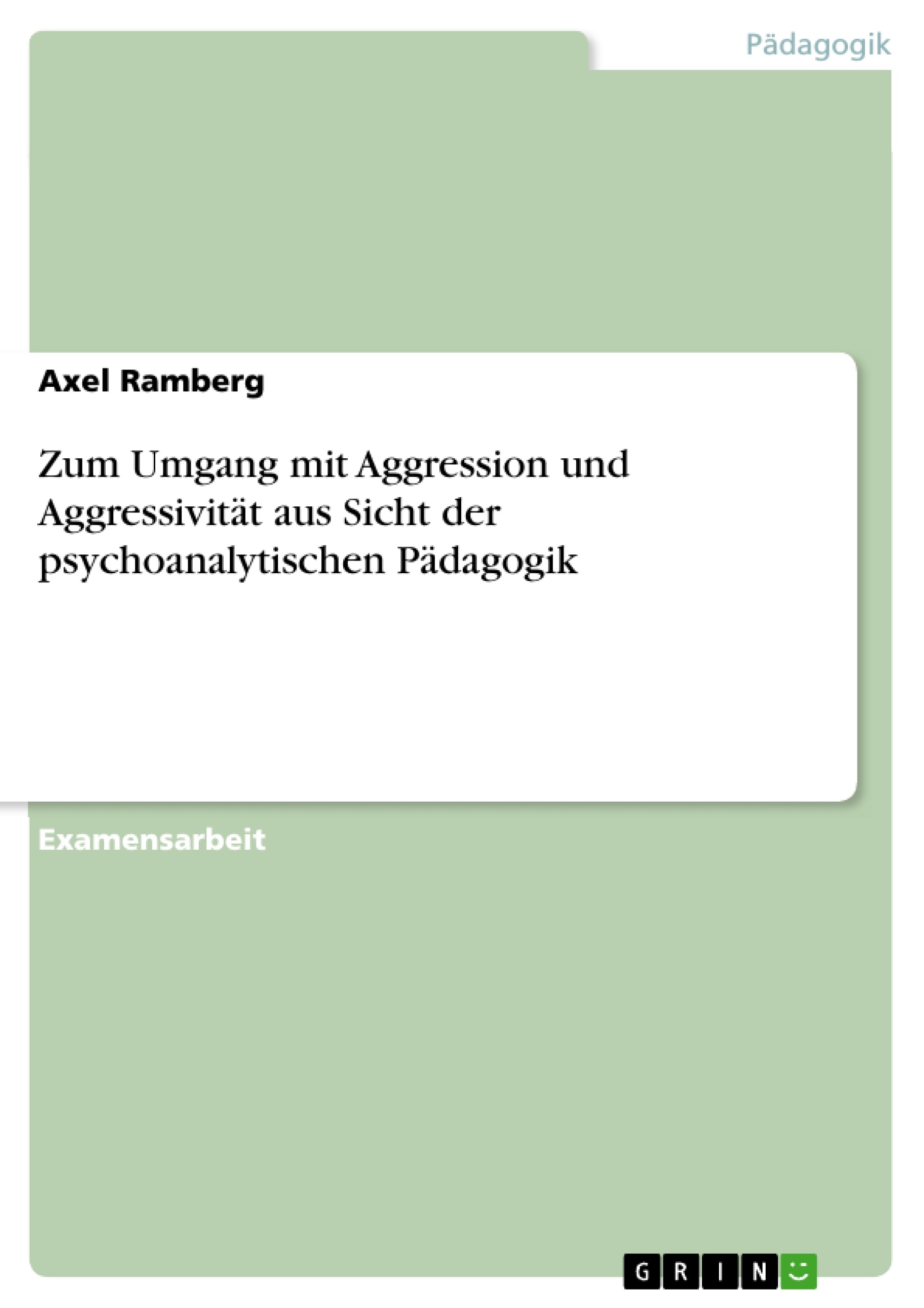Aggressives Verhalten von Menschen ist allgegenwärtig. Jeder von uns wird in unterschiedlichsten Situationen mit Aggressivität konfrontiert; ob in seinem privaten Umfeld, an seinem Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit oder – aufgrund von Kriegen - täglich in den Medien. Empörung wird wach. Es kommt zu Gedanken wie: „Wie können die nur?“ oder „Ich würde mich nie so verhalten“. Und doch hat es im Leben eines Jeden schon die ein oder andere Situation gegeben, in der auch er sich aggressiv verhalten hat; auf welche Art und Weise auch immer. Eine Welt ohne aggressive Handlungen ist nicht denkbar. Es scheint, als gehörten sie fest zum Menschen.
In der Literatur finden sich endlose Veröffentlichungen zum Thema Aggressivität. Es werden Theorien erörtert, verschiedene Erscheinungsformen thematisiert und Ursachen diskutiert, die für die Entstehung von aggressivem Verhalten maßgeblich sein sollen.
In dieser Arbeit soll einer dieser Aspekte untersucht werden: der Umgang mit Aggressivität aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik.
Dabei ist es zunächst wichtig, die Blickrichtung, aus welcher das Thema betrachtet wird, darzustellen. Die Sichtweise der psychoanalytischen Pädagogik, die sich (z.B. im Gegensatz zu einer auf der Lerntheorie begründeten Pädagogik) mit den Fragen nach Prozessen, frühen Erfahrungen oder anderen Ursachen für aggressives Verhalten beschäftigt. Am Beginn der Arbeit soll deshalb eine Auseinandersetzung mit dieser interdisziplinären Wissenschaft erfolgen. Hierbei werden Fragen nach Übereinstimmungen und Differenzen zwischen Psychoanalyse und Pädagogik erörtert. Auch die Historie der psychoanalytischen Pädagogik soll beleuchtet und Entwicklungen aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang wird ein Modell der psychoanalytisch- pädagogischen Arbeit beispielhaft vorgestellt, das zeigen soll, welche Möglichkeiten sich innerhalb dieser Wissenschaft für die Praxis bieten.
Danach werden definitorische Fragen und begriffliche Abgrenzungen diskutiert. Eine Vorstellung der Arbeit verschiedener psychoanalytisch orientierter Pädagogen schließt sich an, wobei der Schwerpunkt auf den Arbeiten Fritz Redls liegen wird, der sich intensiv mit aggressivem Verhalten auseinander gesetzt hat.
Daraufhin werden aktuelle Überlegungen zum Umgang mit Aggressivität erörtert. Insbesondere das szenische Verstehen und das dialogische Handeln stehen hier im Mittelpunkt. Letztlich wird auch noch das Problem des aggressiven Verhaltens im schulischen Kontext thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die psychoanalytische Pädagogik
2.1 Was ist psychoanalytische Pädagogik?
2.1.1 Differenzen zwischen Psychoanalyse und Pädagogik
2.1.1.1 Die Klienten
2.1.1.2 Die Methode
2.1.1.3 Das Setting
2.1.2 Das hierarchische Gefälle zwischen Psychoanalyse und Pädagogik
2.1.3 Die Geschichte der psychoanalytischen Pädagogik
2.1.4 Wesenszüge der psychoanalytischen Pädagogik
2.2 Ein aktuelles Beispiel für die mögliche Gestaltung der psychoanalytischen Pädagogik
2.2.1 Die Menschenmodelle
2.2.2 Schlussfolgerungen für die psychoanalytische Pädagogik auf der Grundlage der Menschenmodelle
2.2.3 Die praktische Umsetzung
2.2.3.1 Die Voraussetzungen
2.2.3.2 Die Durchführung
3. Aggressivität: Versuch einer Definition
3.1 Aggressivität gleich Aggression?
3.2 Etymologie des Wortes „Aggression“
3.3 Psychoanalytische Definition des Aggressionsbegriffs
3.4 Aggression und Gewalt – Eine Abgrenzung
4. Historische Entwicklung des Aggressionsbegriffs in der Psychoanalyse
4.1 Freuds Triebtheorie
4.2 Erste Abwandlungen der Triebtheorie
4.3 Ich-Psychologie
4.4 Heinz Kohut und die Selbst- Psychologie
4.5 Die Objektbeziehungstheorie
4.6 Otto F. Kernberg und die moderne Objektbeziehungstheorie
5. Aktuelle psychoanalytische Theorien zur Entstehung von Aggression
5.1 Konstruktive und destruktive Ausdrucksformen der Aggression
5.2 Säuglingsforschung und Aggression
5.2.1 Die motivationalen Systeme
5.2.1.1 Ist eine klare Trennung von Assertion und Aversion möglich?
5.2.2 Die Entwicklung der Aggression in den ersten Lebensmonaten
5.2.3 Die Bedeutung der ersten Beziehungen des Säuglings
5.2.4 Die Entwicklung der Aggressionslust
6. Traditionelle Umgangsformen mit Aggressivität aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik
6.1 Das Konzept der „Milde und Güte“ von August Aichhorn
6.2 Das Konzept der „Kameradschaftlichkeit“ von Siegfried Bernfeld
6.3 Das Konzept der „Gemeinschaft“ von Hans Zullinger
6.4 Das Konzept der „Aufklärung“ von Erik Homburger Erikson
6.5 Das Konzept des „Realitätsprinzips“ von Fritz Redl und David Wineman
6.5.1 Das „Life-Space-Interview“
6.5.1.1 Die Durchführung: Strategien und Techniken
6.6 Das Konzept des „Verstehens“ von Bruno Bettelheim
6.7 Gemeinsamkeiten der vorgestellten Ansätze
7. Aktuelle Überlegungen zum Umgang mit Aggressivität
7.1 Der Klärungsdialog
7.2 Kampfspiele und Körpererfahrung
7.3 Projektive Identifizierung und szenisches Verstehen
7.4 Der fördernde Dialog
7.5 Die Verbindung vom szenischen Verstehen und fördernden Dialog
7.6 Grenzen des Verstehens – Grenzsetzung als Erfordernis einer psychoanalytischen Pädagogik
7.6.1 Was bedeutet Grenzsetzung?
7.6.2 Die psychoanalytische Bedeutung der Grenzsetzung
7.6.3 Grenzsetzungen von kindlichen Erwachsenen für erwachsene Kinder?
7.7 Mehr als nur Grenzen: Die Konfrontation
7.7.1 Ziele der Konfrontationsmethode
7.7.2 Die Durchführung einer Konfrontation
7.7.3 Die Konfrontation als Grenzziehung
7.7.4 Pro und Contra der konfrontativen Methode
8. Konsequenzen für den Umgang mit Aggressivität in der Schule
8.1 Der Anteil der Schule an den Ursachen der Aggressivität
8.1.1 Die Rolle des Lehrers
8.1.2 Bildung von Strukturen
8.1.2.1 Strukturierung von Unterrichtsinhalten
8.2 Die Öffnung der Schule
8.3 Grundsätzliche Probleme der Schule als „Institution“
8.4 Zur Gewaltprävention in Schulen
8.5 Chancen und Grenzen der Schule im Umgang mit Aggressivität
9. Abschließende Bemerkungen
Literaturverzeichnis
„Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf.“
(Hermann Hesse, Demian)
1. Einleitung
Es ist Abend in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus. Kurz nachdem einige Mitarbeiter[1] mit zwölf Kindern von einem Spaziergang auf die Station zurückkehren, geschieht Folgendes:
Ein 13 jähriger Junge teilt einem der Mitarbeiter mit, dass er vergessen habe, sich eine Schachtel Zigaretten an der Tankstelle zu kaufen. Da er später aber noch eine Zigarette rauchen möchte, fragt er, ob die Möglichkeit bestehe, dass er sich gemeinsam mit einem Mitarbeiter noch mal auf den Weg machen könne, um die Zigaretten zu kaufen. Der Mitarbeiter hält diesbezüglich eine kurze Rücksprache mit seinen Kollegen. Es wird von allen entschieden, die Zigaretten am nächsten Tag zu kaufen, weil an diesem Abend die personelle Besetzung nicht gut sei und somit jeder Mitarbeiter am Abend auf Station bleiben müsse. Der Mitarbeiter geht zu dem Jungen, um ihm diese Entscheidung mitzuteilen. Dieser geht daraufhin in sein Zimmer und knallt laut die Tür zu. Kurz darauf steht er wieder auf dem Flur und verkündet lautstark, jetzt doch zur Tankstelle gehen zu wollen. Als sich ihm ein anderes Kind nähert und ihn fragt, warum er so laut schreie, greift der Junge das Kind an. Er schlägt, tritt und versucht, das Kind zu würgen. Zwei Mitarbeiter erscheinen und können den immer noch schlagenden Jungen von dem Kind trennen. Unter lautem Geschrei und um sich tretend wird der Junge in sein Zimmer gebracht, wo er sich im Gespräch mit einem der Mitarbeiter nur langsam wieder beruhigen kann.
Dieser Vorfall beschreibt eine von vielen Situationen, die ich in meiner Zeit als Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie erlebt habe. Nicht selten kam es vor, dass sich Kinder oder Jugendliche der Station plötzlich „aggressiv“ verhielten. Ihre Handlungen reichten vom Beschimpfen bis zum Schlagen. In solchen Situationen habe ich nicht nur die jeweilige Handlung der Kinder als emotional aufgeladen, bedrohlich und gewaltbereit erlebt, sondern auch bei mir selbst das Anschwellen emotionaler Spannungen gespürt. In der geschilderten Situation habe ich z.B. Wut darüber empfunden, dass der Junge ein unbeteiligtes Kind in die Situation hineinzieht. Aber nicht nur im Rahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt es zu aggressiven Handlungen.
Aggressives Verhalten von Menschen ist allgegenwärtig. Jeder von uns wird in unterschiedlichsten Situationen mit Aggressivität konfrontiert; ob in seinem privaten Umfeld, an seinem Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit oder – aufgrund von Kriegen - täglich in den Medien. Empörung wird wach. Es kommt zu Gedanken wie: „Wie können die nur?“ oder „Ich würde mich nie so verhalten“. Und doch hat es im Leben eines Jeden schon die ein oder andere Situation gegeben, in der auch er sich aggressiv verhalten hat; auf welche Art und Weise auch immer. Eine Welt ohne aggressive Handlungen ist nicht denkbar. Es scheint, als gehörten sie fest zum Menschen.
In diesem Zusammenhang wird das Eingangszitat von H. Hesse bedeutungsvoll. Es besagt nichts anderes, als dass Aggressivität in uns immer etwas mit unserem Gegenüber zu tun hat.
In der Literatur finden sich endlose Veröffentlichungen zum Thema Aggressivität. Es werden Theorien erörtert, verschiedene Erscheinungsformen thematisiert und Ursachen diskutiert, die für die Entstehung von aggressivem Verhalten maßgeblich sein sollen.
In dieser Arbeit soll einer dieser Aspekte untersucht werden: der Umgang mit Aggressivität aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik[2].
Dabei ist es zunächst wichtig, die Blickrichtung, aus welcher das Thema betrachtet wird, darzustellen. Die Sichtweise der psychoanalytischen Pädagogik, die sich (z.B. im Gegensatz zu einer auf der Lerntheorie begründeten Pädagogik) mit den Fragen nach Prozessen, frühen Erfahrungen oder anderen Ursachen für aggressives Verhalten beschäftigt. Am Beginn der Arbeit soll deshalb eine Auseinandersetzung mit dieser interdisziplinären Wissenschaft erfolgen. Hierbei werden Fragen nach Übereinstimmungen und Differenzen zwischen Psychoanalyse und Pädagogik erörtert. Auch die Historie der psychoanalytischen Pädagogik soll beleuchtet und Entwicklungen aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang wird ein Modell der psychoanalytisch- pädagogischen Arbeit beispielhaft vorgestellt, das zeigen soll, welche Möglichkeiten sich innerhalb dieser Wissenschaft für die Praxis bieten.
Danach werden Fragen, wie mit auftretendem aggressiven Verhalten umzugehen ist, diskutiert. Wie und warum reagieren Menschen in aggressiv gespannten Situationen? Was sind die Aufgaben von Pädagogen in solchen Situationen? Es soll versucht werden, sich diesen und ähnlichen Fragen dadurch zu nähern, dass zunächst der Begriff „Aggression“ definiert und mit den Begriffen „Gewalt“ und „Aggressivität“ verglichen wird. Weiter soll ein historischer Überblick über die Entwicklung des Aggressionsbegriffs in der Psychoanalyse bis hin zu den aktuellen Ergebnissen der Säuglingsforschung gegeben werden.
Unter psychoanalytischem Blickwinkel ergeben sich in diesem Zusammenhang weitere Fragen im Bezug auf den Umgang mit Aggressivität: Welches sind meine eigenen Anteile an der Entstehung von Aggressivität? Welche Faktoren spielen in der Entwicklung eines Kindes im Zusammenhang mit Aggressivität eine Rolle?
Insgesamt soll gezeigt werden, dass die Vorgehensweise der psychoanalytischen Pädagogik beim Umgang mit Aggressivität sich von vielen „Alltagsrezepten“ abhebt und ein eigenes Bild von diesem Problem entwirft. Dieses Bild soll durch Darstellung traditioneller Formen des Umgangs mit Aggressivität innerhalb der psychoanalytischen Pädagogik verdeutlicht werden. Hierzu werden psychoanalytisch orientierte Pädagogen und ihre Form des Umgangs mit Aggressivität vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird die Untersuchung der Arbeit Fritz Redls sein, der sich eingehend mit dem aggressiven Verhalten von Kindern auseinander gesetzt hat.
Daraufhin sollen aktuelle Modelle des Umgangs mit Aggressivität beschrieben werden. Dabei liegt das Augenmerk besonders auf dem sog. „szenischen Verstehen“ und der dialogischen Form des Handelns in konfliktträchtigen Situationen. Überlegungen zur Frage der Grenzsetzung in der pädagogischen Praxis schließen sich an. Es wird die Notwendigkeit, im pädagogischen Prozess Grenzen zu ziehen, untersucht und mit Prozessen des Verstehens verglichen. Bei der Darstellung neuester Methoden im Umgang mit Aggressivität soll auch die sog. „Konfrontationsmethode“ als stringente Form der Grenzsetzung und die Frage nach dem psychoanalytischen Wert dieser Methode untersucht werden.
Ein letzter Abschnitt stellt die Schule in den Mittelpunkt des Themas, insbesondere die Frage nach Konsequenzen für den praktischen Umgang von Lehrern mit aggressiven Schülern. Die präventive Arbeit wird in diesem Kontext besonders beleuchtet.
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Schlussbetrachtung sowie einem Ausblick zu Chancen und Grenzen der psychoanalytischen Pädagogik beim Umgang mit Aggressivität.
2. Die psychoanalytische Pädagogik
Wer sich mit Ursachen spontan auftauchender, aggressiver Handlungen auseinander setzen will, muss sich zunächst die Frage stellen, wie „Aggression“ entsteht und sich von Geburt an entwickelt. Nur dann sind Überlegungen, wie in speziellen Situationen mit Aggressivität umzugehen ist, wie man aggressiven Handlungen begegnen kann, wie man eingreifen soll, sinnvoll.
Sicher ist es verlockend, nach einem Patentrezept zu suchen, mit welchem man Aggressivität stoppen kann[3]. Ein solches Lösungsmuster entspräche allerdings nicht der anthropologischen Denkweise der psychoanalytischen Pädagogik. Um zu verstehen, warum es aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik unverzichtbar ist, sich mit Ursprüngen, Entstehungsbedingungen und Entwicklung der Aggression insbesondere durch frühkindliche Erfahrungen auseinander zu setzen, sollen im Folgenden zunächst die Grundgedanken der psychoanalytischen Pädagogik skizziert werden. Es sollen dadurch Möglichkeiten einer psychoanalytisch orientierten Pädagogik, aber auch deren Grenzen, die durch mögliche Unterschiede zwischen Pädagogik einerseits und Psychoanalyse andererseits gekennzeichnet sind, dargestellt werden.
2.1 Was ist psychoanalytische Pädagogik?
Die Frage scheint einfach zu beantworten: Psychoanalytische Pädagogik ist eine Pädagogik, welche die Grundzüge und Strukturen der Psychoanalyse in sich aufnimmt und sie als Leitlinie im pädagogischen Alltag versteht. Das ist sicher im Kern richtig; bei näherer Betrachtung zeigen sich allerdings Probleme, die an der Einfachheit der Antwort Zweifel aufwerfen.
2.1.1 Differenzen zwischen Psychoanalyse und Pädagogik
Diese Zweifel begründen sich in Differenzen, die zwischen den beiden Wissenschaften existieren und zunächst unüberbrückbar scheinen. Die größten Unterschiede gibt es dabei hinsichtlich der Klienten, der Methode und des Settings (vgl. Trescher 1985, S 61).
2.1.1.1 Die Klienten
Bei der psychoanalytischen Arbeit sind bestimmte Fähigkeiten des Klienten Grundvoraussetzung für ein Gelingen der Analyse. Hierzu gehören „Krankheitseinsicht und Heilungswunsch“ (ebd., S. 61). Es ist also wichtig, dass der Klient aus freien Stücken an der analytischen Arbeit teilnimmt. Seine Behandlung ist demnach keine Zwangsbehandlung, sondern eine selbst gesuchte und gewünschte (vgl. ebd., S 61). Dem gegenüber steht in der pädagogischen Arbeit meist ein gewisser Erziehungszwang. Es „(...) herrscht keine Freiwilligkeit, sondern eine sozial gesetzte Erziehungsnotwendigkeit“ (ebd., S 62). Pädagogen haben es z.B. im schulischen Bereich besonders schwer, wenn sie mit Schülern zu tun haben, deren primärer Grund in die Schule zu gehen der ist, dass sie es gesetzlich müssen. Körner und Ludwig-Körner weisen auf diesen Aspekt hin (vgl. Körner/ Ludwig-Körner 1997, S. 53). Für sie ist dieser Punkt allerdings nicht so sehr von Bedeutung, da sie trotz der aus genannten Gründen variierenden Motivation der Klienten (z.B. Schüler) bezüglich der Mitarbeit von einem gemeinsamen Nenner sprechen:
„Beide, Psychoanalytiker und Sozialpädagoge, beginnen ihre Arbeit stets mit einem Anlaß, der auf Veränderung drängt: Der Patient des Analytikers möchte gesund werden und der Klient des Sozialpädagogen möchte sich und seine Situation ändern; oder der Klient steht unter dem Druck, sich ändern zu sollen und der Sozialpädagoge soll ihm dabei unter die Arme greifen.“ (ebd., S. 53)
Für Körner und Ludwig-Körner ist dieser Unterschied weniger interessant als die Frage nach den Gemeinsamkeiten in der Arbeit des Analytikers und des Pädagogen. Dem ist entgegen zu halten, dass sich die Haltung der Klienten in der jeweiligen pädagogischen Situation gravierend unterscheiden kann, je nachdem, ob die gemeinsame Arbeit auf der Grundlage von Freiwilligkeit oder Druck stattfindet.
Rauchfleisch äußert in diesem Zusammenhang, dass mangelnde Motivation für ihn immer ein Symptom, also der Ausdruck eines unbearbeiteten Konflikts ist. Dieses Symptom kann durch verschiedene Faktoren (z.B. Ambivalenz gegenüber intensiven Beziehungen) determiniert sein (Rauchfleisch 2001, S. 29).
Die Fähigkeiten, die ein Patient nach Trescher als Voraussetzung für die analytische Arbeit haben sollte, sind „(...) relative Realitätstüchtigkeit, therapeutische Ich- Spaltung, Introspektion und Empathie, erhebliche Frustrationstoleranz, Kontrolle der Handlungsimpulse und Kanalisierung über Sprache und entsprechend hochdifferenzierte sprachliche Ausdrucksfähigkeit“ (Trescher 1985, S. 61 f.). Auch Reiser geht bei der Analysearbeit von einem Klientel aus, „(…) bei dem die Analyse eine vorhandene Substanz freilegt, die in sich bereits die Dynamik der selbst-tätigen Weiterentwicklung trägt“ (Reiser 1987, S. 185).
Bei der Fülle der geforderten Fähigkeiten stellt sich die Frage, inwieweit das Klientel im pädagogischen Bereich über ähnliche Fähigkeiten verfügt. Trescher sagt, dass es sich bei diesen Fähigkeiten um solche handelt, die in der Interaktion der pädagogischen Arbeit mit dem Klienten erst herzustellen sind[4]. Es sind für ihn demnach Erziehungsziele; keine schon vorhandenen Fähigkeiten (vgl. Trescher 1985, S 62).
Einen weiteren Unterschied sieht er darin, dass die Anforderungen der pädagogischen Arbeit zum einen von Institutionen, zum anderen vom Lebensalter des Klienten abhängen (vgl. ebd., S. 62). Es wird also in unterschiedlichen pädagogischen Bereichen unterschiedlich gearbeitet, während es in der Psychoanalyse keine Abhängigkeit von Institutionen in Bezug auf die beim Analysanden zu erreichenden Ziele gibt.
2.1.1.2 Die Methode
Auch hinsichtlich der Methode bestehen markante Unterschiede zwischen Psychoanalyse und Pädagogik. Während die analytische Arbeit in erster Linie damit beschäftigt ist, die aktuell bestehende Beziehung zwischen Analytiker und Analysand immer aufs Neue zu reflektieren, um sie im Endeffekt zu klären und Schlüsse daraus zu ziehen, sind die Lernziele in der Pädagogik nicht so sehr an das Individuum gebunden (vgl. ebd., S. 62). In der Pädagogik sind die Lernprozesse überindividuell konzipiert, d.h. sie müssen für viele Klienten gleichzeitig wirksam sein. Lernziele in der Pädagogik sind „(...) primär objekt orientiert“ (ebd., S. 62). In der Analyse dagegen steht das Subjektive im Vordergrund: „Die Arbeit an Übertragung und Widerstand“ (ebd., S. 62).
2.1.1.3 Das Setting
Durch die postulierte Freiwilligkeit des Patienten in der analytischen Arbeit (s. 2.1.1.1) entsteht ein Verhältnis zwischen Analytiker und Analysand, welches den „Gleichheitsgrundsatz“ berücksichtigt (vgl. ebd., S. 62). Dieser Gleichheitsgrundsatz wird durch verschiedene Abkommen wie z.B. Arbeitsbündnis oder Therapievertrag gesichert. In der Pädagogik zeigt sich stattdessen, bedingt durch institutionelle Rahmenbedingungen, ein hierarchisches Machtgefälle zwischen dem Pädagogen und dem Klienten. Der Pädagoge ist „(...) der Tendenz nach alleiniger Träger des „Arbeitsbündnisses““ (ebd., S. 62). Dadurch wird mit entstehenden Beziehungskonflikten unterschiedlich umgegangen. In der pädagogischen Arbeit werden diese weitgehend ausgeklammert und nicht wie in der analytischen Arbeit provoziert. Hinzu kommt noch, dass der Pädagoge gar nicht über Verfahrenstechniken verfügt[5], die es ihm erlauben, die „(...) unbewußte Bedeutung der Beziehungsstörung“ (ebd., S. 63) zu verstehen und dadurch Wege für eine Lösung der Konflikte zu finden. Hinzu kommt, dass sich die psychoanalytische Arbeit an der inneren Beziehungsrealität des Patienten orientieren muss, um einen Prozess in Gang zu bringen, der aus dem Konflikt heraus führt. Im Gegensatz dazu „(...) orientiert sich die pädagogische Praxis primär an der äußeren Realität“ (ebd., S. 63). Durch diese Ausrichtung der pädagogischen Arbeit entstehen klare, der Realität entsprechende Zielvorgaben, die mit Hilfe von realen Sanktionsmöglichkeiten erreicht werden sollen (vgl. ebd., S. 63).
Sicher gibt es noch weitere Differenzen, aber schon bei der Betrachtung dieser Unterschiede wird deutlich, dass es äußerst schwierig ist, das eigentliche „Wesen“ der psychoanalytischen Pädagogik zu bestimmen. So kommt Trescher zu dem Schluss:
„Psychoanalytische Pädagogik kann es nicht geben.“ (ebd., S. 63)
Da sich diese Aussage auf die beschriebenen Differenzen zwischen Psychoanalyse und Pädagogik bezieht, erscheint es erforderlich, die Frage nach Gemeinsamkeiten der beiden Wissenschaften zu stellen und zu untersuchen, ob es möglich ist, Aspekte zu finden, in denen sie sich konstruktiv ergänzen.
Das lässt sich allerdings nur unter Berücksichtigung des hierarchischen Gefälles zwischen beiden Wissenschaften beantworten.
2.1.2 Das hierarchische Gefälle zwischen Psychoanalyse und Pädagogik
Wenn in der Literatur von der psychoanalytischen Pädagogik die Rede ist, scheint es eine klare Vorstellung davon zu geben, inwieweit sich die beiden Teildisziplinen ergänzen. Interessant ist dabei, dass ausschließlich von psychoanalytischer Pädagogik gesprochen wird, nicht aber von pädagogischer Psychoanalyse (Ausnahme bei Bittner 1967). Der Begriff impliziert also den Aspekt, dass Pädagogik sich das Wissen der Psychoanalyse zu Eigen macht, um „aufgewertet“ zu werden. Diese Tatsache findet sich immer dort in den Werken zur psychoanalytischen Pädagogik, wo „(...) von dem „Beitrag“ oder „Leistung“ der Psychoanalyse „für die Aufgaben der Erziehung“ gesprochen“ (Fatke 1985, S. 47) wird. Durch solche Formulierungen wird ein „(...) Gefälle zwischen den beiden Gegenstandsbereichen“ (ebd., S. 48) deutlich. Für Fatke spiegelt sich dieses Gefälle auch in der Selbsteinschätzung der jeweiligen Berufsgruppen, der finanziellen Unterschiede im Einkommen und in der gesellschaftlichen Bewertung der jeweiligen Berufe wider (vgl. ebd., S. 48).
Die Ursachen für ein solches Gefälle liegen zunächst darin, dass die Psychoanalyse immer versucht hat, aus ihren Erfahrungen im klinischen Bereich[6] Schlüsse zu ziehen, die es ihr erlauben, „(...) recht dezidierte Aussagen über die Ziele und Mittel der Erziehung zu machen“ (ebd., S. 48). Dieser Trend bestand schon zu Zeiten Freuds. Er wehrte sich zwar grundsätzlich dagegen, aus seinen Erkenntnissen, Schlussfolgerungen für die Pädagogik zu ziehen, dennoch gab es immer wieder konkrete Überlegungen, wie Erziehung seiner Meinung nach auszusehen habe:
„Als Ziel der Erziehung könnte man im Sinne der Psychoanalyse die Überwindung von Vorlust bezeichnen. Mann muß das Kind durch den Hinweis auf große Endlust zum Verzicht auf die jeweilige Vorlust bewegen. Diese versprochene Endlust rückt dann immer weiter hinaus, um sich in das Wohl der Gesamtheit aufzulösen.“ (Freud zit. in: Fatke 1985, S. 49)
An dieser recht schlichten Aussage wird deutlich, dass auch Freud versuchte, der Pädagogik Vorschriften zu machen, die er aus der Psychoanalyse ableitete (vgl. ebd., S. 49).
Das Problem des hierarchischen Gefälles sieht Fatke nun weniger darin, dass von der Psychoanalyse viel an Vorschlägen oder gewollter Einflussnahme ausgeht, sondern vielmehr darin, dass die Pädagogik im Laufe der Jahre die Haltung eingenommen hat, die Sichtweise der Psychoanalyse einfach zu übernehmen (vgl. ebd., S. 49). Der Pädagogik fehle ein Maß an wissenschaftlichem Selbstverständnis, was dazu führe, dass auch andere Wissenschaften weit in die Pädagogik hineinreichten (z.B. die Soziologie, die Psychologie, die Medizin, die Kriminologie, etc.).
Zur Blütezeit der psychoanalytischen Pädagogik in den 30er Jahren war das noch nicht der Fall. Es bestand die Möglichkeit, psychoanalytische Aspekte ohne weiteres auf die Pädagogik zu übertragen und Ergebnisse der psychoanalytisch orientierten Pädagogik gleichberechtigt zwischen Pädagogen und Analytikern auszutauschen. Interessant daran ist, dass die wichtigsten Vertreter dieser Zeit nicht nur Analytiker waren, sondern alle aus der pädagogischen Praxis stammten und weitgehend auch weiter als Pädagogen arbeiteten (z.B. F. Redl, H. Zullinger, A. Freud, O. Pfister oder A. Aichhorn) (vgl. ebd., S. 50).
Ausgangspunkt für den starken, einseitigen Einfluss der Psychoanalyse auf die Pädagogik waren die 60er Jahre, in denen sich erneut ein breites Interesse an der Psychoanalyse einstellte (vgl. ebd., S. 50). Zu dieser Zeit hatte die Pädagogik bereits ihr Fundament – die Frage nach der Erziehung - weitgehend aufgegeben und sich anderen Wissenschaften geöffnet. Das brachte zwar eine starke Bereicherung mit sich, aber eben auch den endgültigen Verlust des eigenen Selbstverständnisses (vgl. ebd., S. 51):
„Kaum jemand traute sich noch, ja gravierender; kaum jemand sah sich noch in der Lage, das spezifisch Pädagogische zu benennen.“ (ebd., S. 52).
Was aber ist oder war das „spezifisch Pädagogische“ an der Pädagogik? Fest steht, dass sich diese Frage nicht anhand anderer Wissenschaften beantworten lässt, die sich ihrerseits als Grundlagenwissenschaft verstehen und demnach eigene Vorstellungen davon haben, wie Pädagogik auszusehen habe (vgl. ebd., S 52). Die Pädagogik muss selbst den Zweck ihres Gegenstandes bestimmen, nämlich die konkrete Erziehungssituation als eine „essentielle und existentielle Situation des Kindes“ (Langeveld zit. in: Fatke 1985, S. 53). Diese Erziehungssituation muss als ganzheitliche Situation interpretiert werden, in der immer die Dimension der Wechselseitigkeit der Erziehungsprozesse vorhanden ist und der eigene Beitrag des Klienten zum Erziehungsprozess beachtet werden muss (vgl. ebd., S 56). In solch einem Verständnis von Pädagogik ist es eben nicht genug, „(...) die Triebentwicklung bei Kindern zu kennen oder Aufschlüsse über das psychodynamische Beziehungsgeflecht in den (dyadischen oder triadischen) Objektbeziehungen zu erhalten oder sich in den Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen zwischen Schüler und Lehrer auszukennen“ (ebd., S 53).
Fatke kommt aus den genannten Gründen zu einer Standortbestimmung des Verhältnisses zwischen Psychoanalyse und Pädagogik, welches die Pädagogik als Grundwissenschaft voraussetzt, der die Psychoanalyse zwar zur Klärung oder kritischen Prüfung ihrer Grundlagen behilflich sein kann, aber keine Sonderstellung mehr einnimmt, und in welchem nur die Pädagogik bestimmen kann, was die Psychoanalyse für sie zu leisten vermag (vgl. ebd., S. 53).
Im Gegensatz dazu versteht Trescher die psychoanalytische Pädagogik als Teil der Psychoanalyse (vgl. Trescher 1985, S. 65).
Bei der Unterschiedlichkeit der Positionen wird deutlich, dass die Grundsatzfrage nach dem Verhältnis von Psychoanalyse und Pädagogik letztlich unbeantwortet bleiben muss (vgl. Göppel 1985, S. 185)
2.1.3 Die Geschichte der psychoanalytischen Pädagogik
Die Ursprünge der psychoanalytischen Pädagogik gehen auf Freud zurück. Seine Theorie der kindlichen Sexualität, die er in seinem Werk: „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905) darlegte, stellt einen Zusammenhang zwischen dem neurotischen Konflikt und der kindlichen Sexualität her (vgl. Bittner/ Rehm 1966, S. 9). Freuds Verständnis vom Kind als geschlechtlichem Wesen, in welchem der Geschlechtstrieb dauerhaft wirksam ist, „(...) schuf die Basis für den Ausbau einer psychoanalytischen Erziehungslehre“ (ebd., S. 9). Es ergab sich dabei die Frage, „(...) wie sich der Erzieher zu den kindlichen Trieben einzustellen habe“ (Bittner 1967, S. 9). Diese Frage wurde von Freud erweitert, indem er sich mehr und mehr der Kultur und deren Zusammenhang mit der Erziehung widmete:
„Unsere Kultur übt einen fast unerträglichen Druck auf uns aus, sie verlangt nach einem Korrektiv. Ist es zu phantastisch zu erwarten, daß die Psychoanalyse trotz ihrer Schwierigkeiten zur Leistung berufen sein könnte, die Menschen für ein solches Korrektiv vorzubereiten?“ (Freud 1926, S. 340)
Für Freud besaß die Kulturerziehung triebfeindliche Elemente, was dazu führte, dass er die Erziehung als „Nachhilfe“ zur Überwindung des Lustprinzips verstand:
Das Kind sollte an die Realität angepasst werden, um neurotische Gefährdungen zu überwinden; dies führte bei Freud zur Theorie der „Sublimierung“ (ebd. 1905a, S. 85).
Zu dieser Zeit versuchten einige von Freuds Schülern, das Verhältnis von Psychoanalyse und Pädagogik zu bestimmen (Ferenczi 1908; Jones 1910/12). Da sich gleichzeitig die psychoanalytische Technik – die Anwendung der Psychoanalyse in der Therapie - weiterentwickelte, „(...) stellte sich die Frage nach der erzieherischen Komponente im therapeutischen Prozeß“ (Bittner/ Rehm 1966, S. 11).
Da nach psychoanalytischer Auffassung das Kindliche immer wirksam bleibt, geht es in der Therapie zunächst darum, unbewusste Vorgänge, die zu Konflikten führen können, aufzudecken:
„In diesen Konflikt im Seelenleben des Kranken greifen Sie nun ein; gelingt es Ihnen, den Kranken dazu zu bringen, daß er aus Motiven besserer Einsicht etwas akzeptiert, was er zufolge der automatischen Unlustregulierung bisher zurückgewiesen (verdrängt) hat, so haben Sie ein Stück Erziehungsarbeit an ihm geleistet. Es ist ja schon Erziehung, wenn Sie einen Menschen, der nicht gern frühmorgens das Bett verläßt, dazu bewegen, es doch zu tun. Als eine solche Nacherziehung zur Überwindung innerer Widerstände können sie nun die psychoanalytische Behandlung ganz allgemein auffassen.“ (Freud 1905b, S. 118)
Ab 1912 widmete sich die Psychoanalyse immer mehr der Pädagogik, weil auch in dieser Wissenschaft das Kind im Mittelpunkt der Forschungen stand (vgl. Bittner/ Rehm 1966, S. 11). Es sollten pädagogische Methoden entwickelt werden, die auf psychoanalytischen Grundlagen beruhen (vgl. Bittner 1967, S. 10). Zu den Ersten, die sich mit diesen Ideen beschäftigten, gehörten O. Pfister und H. Hug- Hellmuth. Für sie sollte Erziehung eine prophylaktische Wirkung haben, um Neurosen oder Perversionen zu verhindern (vgl. Bittner/ Rehm 1966, S. 12).
Da das Interesse am Zusammenhang zwischen Psychoanalyse und Pädagogik immer größer wurde, entstand 1926 die erste Ausgabe der „Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik“, welche von H. Meng und E. Schneider herausgegeben wurde. In dieser Zeitschrift wurden Anwendungsergebnisse des psychoanalytischen Verfahrens bei Kindern und Jugendlichen veröffentlicht und Erfahrungsberichte psychoanalytisch eingestellter Erzieher bekannt gemacht (vgl. ebd., S. 15). Auch Freud äußerte sich in dieser Zeit über die Zusammenhänge von Psychoanalyse und Pädagogik:
„Eine Behandlung, die analytische Beeinflussung mit erzieherischen Maßnahmen vereinigt, von Personen ausgeführt, die es nicht verschmähen, sich um die Verhältnisse des kindlichen Milieus zu bekümmern, und die es verstehen, sich den Zugang zum Seelenleben des Kindes zu bahnen, bringt in einem beides zustande, die nervösen Symptome aufzuheben und die beginnende Charakterveränderung rückgängig zu machen.“ (Freud 1926, S. 340)
Die Lebensdauer der „Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik“ war begrenzt, denn sie „(…) mußte im Jahre 1937 infolge der widrigen Zeitumstände ihr Erscheinen einstellen.“ (Bittner 1967, S. 10)
Das Charakteristische der damaligen psychoanalytischen Pädagogik bestand darin, dass sie sich ihre Anwendungsgebiete „(…) durch Beobachtung und pädagogisches Experimentieren“ (Bittner/ Rehm 1966, S. 16) erschloss. Aus den gemachten Erfahrungen wurden Schlussfolgerungen gezogen, die die Grundlage für eine Gesamttheorie bildeten. Psychoanalytische Pädagogik bezog sich vorrangig auf Bereiche wie die Familie, den Kindergarten und die Schule (vgl. ebd., S. 17).
Nach 1945 wurde die Tradition der psychoanalytischen Pädagogik wieder aufgenommen, jedoch zeigt sich in dieser Zeit eine „(…) Ausweitung des Interesses von ausschließlich pädagogischen Fragen zu einer umfassenden analytischen Wissenschaft vom Kinde“ (Bittner 1967, S 10 f.).
Nach Bittner bildeten sich in der psychoanalytischen Pädagogik im Laufe der Zeit fünf Interessenschwerpunkte heraus (vgl. ebd., S. 11 f.):
1. Die Frage nach Problemen und Aufgaben der Kleinkindererziehung und der Familienerziehung.
2. Der Bereich einer psychoanalytischen Pädagogik im Kindergarten.
3. Die Schulerziehung, wobei hier auch Fragen wie die Psychohygiene des Lehrers behandelt wurden.
4. Die Jugendfürsorge und die Verwahrlostenerziehung.
5. Die Verbindung der psychoanalytischen Pädagogik mit soziologischen Fragestellungen und den Zusammenhängen von Kindheit und Gesellschaft.
2.1.4 Wesenszüge der psychoanalytischen Pädagogik
Da es verschiedene Vorstellungen gibt, wie eine psychoanalytische Pädagogik auszusehen habe, welches ihre Aufgaben, Ziele und Inhalte sind, ist es wichtig, Merkmale zu nennen, die zu ihrem Verständnis unabdingbar sind.
Zunächst einmal ist es in der psychoanalytischen Pädagogik wichtig, „(…) die Mehrbödigkeit pädagogischer Situationen“ (Göppel 1985, S. 185) zu erkennen. Durch ein psychoanalytisches Verstehen können „(…) Untergrundphänomene im Erziehungsprozess“ (ebd., S. 185) beschrieben und erklärt werden. Die psychoanalytische Pädagogik ist demnach eine Pädagogik, die sich nicht mit der Oberfläche jeweiliger Situationen beschäftigt, sondern sich um „(…) ein vertieftes Verständnis für die Ausdrucksformen der kindlichen Innenwelt“ (ebd., S. 185) bemüht.
Von großer Bedeutung ist die psychoanalytische Pädagogik im Bereich der Schule. „Psychoanalytische Bedeutungslehre von Unterrichtsinhalten und Unterrichtsgeschehen kann im didaktischen Bereich Kriterien für die Auswahl und Aufarbeitung von Themen liefern“ (ebd., S. 185). Prozesse können mit Hilfe der psychoanalytischen Sichtweise erfasst und für den Unterricht nutzbar gemacht werden.
Dabei ist auch die psychoanalytische Selbstreflexion von Belang. Durch sie kann der Pädagoge „(…) das Kind in sich“ (ebd., S. 185) verstehen und so in der konkreten Erziehungssituation besser auf unterschiedliche Konflikte reagieren.
Ebenso wichtig wie die Selbstreflexion ist die Praxisreflexion, die, soweit sie psychoanalytisch vollzogen wird, der psychischen Entlastung des Erziehers dienen kann. Durch diese Reflexion wird „(…) die Sensibilität für die Dynamik in pädagogischen Beziehungen“ (ebd., S. 185) erhöht. Letztendlich kann die Psychoanalyse dem Erzieher die Bausteine „(…) für eine pädagogische Anthropologie“ (ebd., S. 185) liefern. Reiser betont in diesem Zusammenhang, dass psychoanalytische Therapie und psychoanalytische Pädagogik die gleichen Zielsetzungen haben:
„Entfaltung, Wachstum, Befreiung, Selbstfindung.“ (Reiser 1987, S. 195)
2.2 Ein aktuelles Beispiel für die mögliche Gestaltung der psychoanalytischen Pädagogik
Wie eine pädagogische Anthropologie auf der Grundlage der Psychoanalyse aussehen kann, haben J. Körner und C. Ludwig-Körner 1997 aufgezeigt. Anhand von verschiedenen praktischen pädagogischen Situationen entwickeln sie ein Bild von drei verschiedenen Menschenmodellen, von welchen jeder Mensch, der in irgendeiner Form mit den Sozialwissenschaften in Berührung kommt, eines verinnerlicht hat. Für Körner und Ludwig-Körner liegen die Differenzen in der Diskussion innerhalb der psychoanalytischen Pädagogik in der Unterschiedlichkeit der zugrunde liegenden Menschenbilder (vgl. Körner/ Ludwig-Körner 1997, S. 11).
Die entsprechenden Menschenmodelle nennen Körner und Ludwig-Körner „das Handlungsmodell“, „das Maschinenmodell“ und „das Erzählermodell“ (vgl. ebd., S. 13).
2.2.1 Die Menschenmodelle
In der Vorstellung des Maschinenmodells fungiert der Mensch als Maschine, die komplett determiniert ist, und zwar sowohl durch seine Lebenserfahrungen als auch durch aktuelle Gegebenheiten. Menschliches Verhalten entsteht durch funktionale Abhängigkeiten:
„Der Mensch ist ein im Grunde passives Wesen, das von spezifischen Reizen aktiviert wird; es verarbeitet Informationen und reagiert nach einem hochkomplexen Schema- aber doch auf eine Weise, die prinzipiell und unter Angabe von Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar ist.“ (ebd., S 16)
Pädagogische Arbeit, die diesem Modell folgt, wird besonders darauf angelegt sein, Zusammenhänge des momentanen Verhaltens eines Klienten und den dazugehörigen Ursachen zu finden. Es geht in diesem Modell also in erster Linie um „Ursache- Wirkungs- Zusammenhänge“ (ebd., S. 17).
Das Handlungsmodell ist nach Ansicht von Körner und Ludwig-Körner das meist diskutierte (vgl. ebd., S. 13). Dabei geht es darum, Handlungsgründe und Handlungsziele des Klienten zu ergründen (vgl. ebd., S. 13) Das Modell geht davon aus, dass jeder Handlung eine Intention zugrunde liegt:
„Auch wenn diese Intentionalität des Verhaltens nicht erkennbar ist, bleibt es sinnvoll diese Maxime zu verfolgen, daß Menschen ihre Probleme auf rationaler Ebene lösen sollten, und es ist sowohl in der Pädagogik als auch in der Psychotherapie vernünftig, Menschen zur Einsicht in eigene, zuvor nicht bewußte Ziele und Handlungsabsichten zu verhelfen.“ (ebd., S. 14)
Beim Handlungsmodell können in der Beziehung zum Klienten Konflikte entstehen, weil er - besonders in problematischen Situationen - mit der Frage konfrontiert wird, warum er sich so oder anders verhält. Die Frage beispielsweise, was er mit seinem „Zug-Spät-Kommen“ ausdrücken will, wird er ablehnen, weil es aus seiner Sicht ja praktische Gründe für sein Verhalten gibt (vgl. ebd., S. 14). Das Handlungsmodell fragt also nicht nur nach den Handlungen selbst, sondern nach der eigenen Verantwortlichkeit des Klienten hierfür (vgl. ebd., S. 14), wobei sich dieser oft überfordert fühlen kann.
Körner und Ludwig-Körner gehen davon aus, dass das Handlungsmodell und seine Vorstellung von den intentionalen Handlungen von Pädagogen oft nicht ernst genommen wird (vgl. ebd., S. 16). Dies liege daran, dass sich Pädagogen oftmals mit ihren Klienten identifizierten und diesen deshalb „(…) in solchen kritischen Fällen eine intentionale Beschreibung nicht zumuten“ (ebd., S. 16). Es bestehe die Tendenz, das „(…)Opfer von aller Schuld (…) zu befreien“ (ebd., S. 16). Hierbei werde dann schnell übersehen, dass auch der Klient seine eigene Handlungsfreiheit besitze und von dieser auch seinen Vorstellungen nach Gebrauch mache (vgl. ebd., S. 16).
In der Idee des Erzählermodells können in den Aussagen der Klienten tiefere Bedeutungen gefunden werden, als sie sich auf den ersten Blick feststellen lassen. Körner und Ludwig-Körner beschreiben das Verständnis des Erzählermodells als vergleichbar mit dem Verständnis einer Novelle (vgl. ebd., S. 20). Jede „Erzählung“ des Klienten, so sehr sie auch auf Tatsachen beruht, hat demnach einen wichtigen Bedeutungshintergrund:
„Im Erzählermodell versuchen wir, die Anspielungen auf diesen Hintergrund zu verstehen; die erzählten Tatsachen verlieren dabei nicht an Wirklichkeitsgehalt, aber ihre Beschreibung gewinnt an „Tiefe“, sie deutet über sich selbst hinaus auf wesentliche Phantasien, ohne die die Situation, (…), in ihrer subjekthaften Bedeutung nicht verständlich wäre.“ (ebd., S. 20)
Das Erzählermodell versucht also, das „unbewusst Absichtsvolle“[7] in einer Handlung zu erkennen, was mit dem Handlungsmodell deshalb nicht zu erreichen ist, weil es nicht möglich ist, Ziele zu beschreiben, derer sich der Klient nicht bewusst ist. Dies gelingt nur, wenn man, wie im Erzählermodell, Andeutungen oder auch Metaphern, die vom Klienten geäußert werden, versteht (vgl. ebd., S. 21). Wenn ein Klient beispielsweise seine Biographie erzählt, sollten nicht nur die vordergründigen Fakten interessieren. Es sollte vielmehr versucht werden, „(…) in jedem Detail dieser Geschichte das interpretierende Subjekt im Erzähler wiederzuerkennen“ (ebd., S 22). Das Erzählermodell eignet sich besonders gut im Bereich der Kommunikation, da besonders im Dialog viele Anspielungen und Metaphern enthalten sind, deren Interpretation zum Verständnis einer konkreten (evtl. konflikthaften) Situation beitragen kann (vgl. ebd., S 25). Dadurch ist es möglich, die Fiktionalität des Gesprochenen als konkreten subjekthaften Beziehungsentwurf zu verstehen und dementsprechend darauf einzugehen (vgl. Körner 2001, S. 54 ff.).
2.2.2 Schlussfolgerungen für die psychoanalytische Pädagogik auf der
Grundlage der Menschenmodelle
Für Körner und Ludwig- Körner stellt sich die Frage, wie wissenschaftliche Hindernisse „(…) einer Verschränkung von Psychoanalyse und Pädagogik (oder wenigstens von psychoanalytischem und pädagogischem Handeln) im Wege stehen“ (Körner/ Ludwig-Körner 1997, S. 51). Dabei stellen sie die klassische Methodik der jeweiligen Fachrichtungen in Frage.
Im klassischen Sinne ist die psychoanalytische Arbeit im Gegensatz zur pädagogischen Arbeit, immer in die Vergangenheit gerichtet, d.h. sie entwirft ein Menschenbild, welches dem Maschinenmodell am nächsten kommt (vgl. ebd., S 56). Der Patient ist von seinen bisherigen Lebenserfahrungen determiniert und hat keine Chance, sich aus diesen Determinanten zu befreien. Erlebtes bleibt dauerhaft wirksam und äußert sich als Wiederholungszwang[8], der mit Hilfe der psychoanalytischen Therapie durchbrochen werden soll (vgl. ebd., S. 56). Ein psychoanalytisches Verständnis im Sinne des Handlungsmodells würde sich mit dieser Tatsache nicht begnügen, sondern nach den eigenen Anteilen spezieller Handlungen des Patienten fragen:
„Die „Herrschaft der Vergangenheit“ ist dann nicht mehr- wie in der Trauma-Theorie – ein Konditionierungsprozeß, dem der Patient unterliegt, sondern ein aktueller Versuch, eine vielleicht schmerzhafte, aber doch vertraute Situation herbeizuführen.“ (ebd., S. 57).
Im Erzählermodell wäre die Aussage, dass eine psychoanalytische Arbeit immer in die Vergangenheit gerichtet ist, bedeutungslos (vgl. ebd., S. 58). In diesem Modell bringt sich der Analytiker selbst in die Beziehung zum Patienten ein und versucht durch weiterführende Interpretationen der sich wiederholenden Handlungen des Patienten, diesem neue Beziehungsangebote und andere Konfliktlösungen zu unterbreiten[9] (vgl. ebd., S. 57 f.). Damit wird die Beziehung in der konkreten Situation zum Hauptgegenstand der Auseinandersetzung; ein Umstand, der pädagogischer Arbeit gleicht. Um sich nicht in dieser Beziehung zu verstricken oder in ihr „gefangen“ zu bleiben, ist es nach Körner und Ludwig-Körner wichtig, dass der Analytiker sich immer wieder aus ihr löst und sie „(…) wie von einem äußeren, „exzentrischen“ Standpunkt aus“ (ebd., S. 60) betrachtet. Nur so wird es ihm möglich, die Beziehung, seine Rolle darin und den Patienten zu verstehen. Eine Aufgabe, die Körner und Ludwig –Körner auch für den Pädagogen voraussetzen: auch der Pädagoge soll eine „schwebende“ Haltung einnehmen (vgl. ebd., S. 47). Nach Ansicht von Körner und Ludwig-Körner lässt sich hier gleichzeitig die „Verträglichkeit“ von Psychoanalyse und (Sozial-) Pädagogik ableiten:
„Psychoanalytisch orientierte Sozialpädagogik ist ja weder eine Arbeit, die sich an quasi- kausalen, funktionalen Zusammenhängen oder an bestimmten Zielen orientiert. Denn das Zukünftige läßt sich erst im Verständnis für die Gegenwart erkennen, und die Macht der Vergangenheit läßt sich doch nur dadurch verstehen, daß wir uns klar machen, wie und wieso wir heute an zurückliegenden Erfahrungen so gern festhalten.“ (ebd., S. 71)
2.2.3 Die praktische Umsetzung
Im Folgenden soll dargestellt werden, wie sich die theoretischen Ideen von Körner und Ludwig-Körner in die pädagogische Praxis übertragen lassen.
2.2.3.1 Die Voraussetzungen
Körner und Ludwig-Körner stellen zunächst Aspekte vor, die die „Statik“[10] der psychoanalytisch-pädagogischen Situation bilden (vgl. ebd., S. 73).
Der erste Aspekt ist der des „Settings“. Neben den unter 2.1.1.3 dargestellten Aspekten fallen auch Vereinbarungen bezüglich der Örtlichkeiten, Räumlichkeiten oder Zeiträume der gemeinsamen Arbeit unter diesen Begriff.
Körner und Ludwig-Körner weisen darauf hin, dass es in der pädagogischen Arbeit genauso wichtig ist, mit einem festen Setting zu arbeiten, wie in der analytischen, in welcher das Setting heute nicht mehr nur in seiner klassischen Form (Couch-Sessel-Anordnung) zu finden ist (vgl. ebd., S. 74 f.).
Als nächstes wird der Rahmen der Situation genannt (vgl. ebd., S. 77). Er ist weiter gefasst als das Setting:
„Zum Rahmen einer Situation gehören die vielfältigen Regeln, die festlegen, welche Handlungen hier angemessen und welche unangemessen sind, auf welche Weise wir unser Verhalten gegenseitig interpretieren, wie wir unser Sprechen verstehen, und in welcher Weise wir hier füreinander wirksam werden.“ (ebd., S. 77)
Weitere Aspekte sind Übertragung und Gegenübertragung[11]. Sie sind grundsätzliche Bausteine für den Aufbau einer Beziehung, sowohl zwischen Therapeut und Patient als auch zwischen Pädagoge und Klient. Körner und Ludwig-Körner verstehen den Prozess der Übertragung nicht als Disposition des Patienten (respektive Klienten), sondern als Teil der Interaktion:
„Nunmehr sind Übertragung und Gegenübertragung von vornherein ineinander verschränkt, sowohl Patient als auch Psychoanalytiker gestalten die gemeinsame Situation, und jeder antwortet auf die Beiträge des anderen und nimmt, noch weitgehend, die erwarteten Reaktionen des anderen in seinem eigenen Beitrag schon vorweg.“ (ebd., S. 84).
Im Folgenden weisen Körner und Ludwig-Körner auf die Punkte der Ich- Spaltung und die Fähigkeit zur Exzentrizität hin (vgl. ebd., S. 88). Ich- Spaltung „(…) bezeichnet die Fähigkeit des Patienten, einerseits sehr subjekthaft seine Beziehungsphantasien in der therapeutischen Situation zum Ausdruck zu bringen, andererseits aber in der Lage zu sein, über diese Phantasien selbst nachzudenken“ (ebd., S. 90 f.). Für sie ist der Begriff der Ich- Spaltung zwar „(…) nicht sehr glücklich gewählt“ (ebd., S. 91), allerdings lasse sich durch den Begriff der Exzentrizität heute ein neues Verständnis von Ich- Spaltung entwickeln, welches das gespaltene Ich als eine Einheit, die sich der Patient (Klient) von einem äußeren Standpunkt aus betrachten kann, versteht (vgl. ebd., S. 92). Oftmals sei die Fähigkeit zur Exzentrizität beim Patienten (Klienten) nicht vorhanden oder nur mangelhaft ausgebildet; in diesem Fall werde die Fähigkeit einen exzentrischen Standpunkt einzunehmen, ein vorrangiges Ziel der pädagogischen (psychoanalytischen) Arbeit (vgl. ebd., S. 96).
Der letzte Aspekt, der von Körner und Ludwig-Körner im Zusammenhang mit den statischen Faktoren genannt wird, ist der des Arbeitsbündnisses. Ein Arbeitsbündnis, welches zwischen dem Therapeut (Pädagogen) und dem Patienten (Klienten) besteht, soll dazu beitragen, in kritischen Situationen, in denen der Klient die Arbeit in Frage stellt und ein Beziehungsabbruch droht, die Beziehung aufrecht zu erhalten (vgl. ebd., S. 97). Im Arbeitsbündnis werden z.B. Zeiten zwischen beiden Parteien verhandelt oder Methoden, mit denen ein Ziel der Arbeit erreicht werden soll:
„Ein stabiles Arbeitsbündnis zeigt sich nicht nur darin, daß der Patient/ Klient regelmäßig zu den vereinbarten Sitzungen kommt und bis zum Ende auch dableibt, sondern auch darin, daß er versucht, seinen Teil an der gemeinsamen Arbeit beizutragen.“ (ebd., S. 100)
2.2.3.2 Die Durchführung
Um in konkreten pädagogischen Situationen psychoanalytisch orientiert arbeiten zu können, muss der Pädagoge zunächst einen Zugang zum inneren Konflikt, der dem Problem des Klienten zugrunde liegt, finden. Hierzu gibt es nach Ansicht von Körner und Ludwig-Körner drei Wege (vgl. ebd., S. 114):
1. Das Betrachten des Anlasses, welcher den Klienten zum Pädagogen führt.
2. Die Untersuchung der Biographie des Klienten.
3. Die Betrachtung der aktuellen Beziehung zwischen Klient und Pädagogen.
Der erste Weg ist in der Praxis am häufigsten anzutreffen, weil hierbei der leichtesten Zugang zum Klienten herzustellen ist. „Das liegt schon daran, daß sich der Klient oft selber wünscht, über den Anlaß zu sprechen oder zumindest damit rechnet, daß dieser zum Thema des Gespräches wird“ (ebd., S. 115). Der Aspekt, dass der Klient durch das Aufsuchen (oder Vermeiden) einer pädagogischen Situation zu einer Lösung seines Problems kommen möchte, wird also vom Pädagogen, der psychoanalytisch arbeitet, vorausgesetzt.
Da es für den Klienten oft nicht leicht ist, über seine gesamte Lebensgeschichte zu sprechen, gestaltet sich der zweite Ansatz schon schwieriger (vgl. ebd., S. 115). Bei diesem geht es darum, dass der Pädagoge in der Biographie des Klienten Gesichtspunkte findet, die sich im Laufe seines Lebens wiederholen[12] (vgl. ebd., S. 119). Diese stehen dann für einen großen, unbewältigten Konflikt, der „(…) das Handeln eines Menschen auf immer wieder ähnliche Weise prägt“ (ebd., S. 119). Die persönliche Bedeutung von frühen Erfahrungen soll erfasst werden. Das ist allerdings oftmals nicht ganz einfach, weil sich objektive Fakten der Vergangenheit mit eigenen Phantasien zur Vergangenheit vermischen (vgl. ebd., S. 122).
Der dritte Ansatz ist nach Meinung von Körner und Ludwig-Körner der schwierigste. Das liegt daran, dass sich die Beziehung zwischen Pädagoge und Klient nicht nur auf gesprochene Dialoge oder (ausgetauschte) sachliche Angaben beziehe, sondern dass sich beide darauf einigen müssten, den Sinn ihrer Beziehung zu ergründen und zu verstehen (vgl. ebd., S. 124). Um sich diesem Sinn zu nähern, kann der Pädagoge nach Körner und Ludwig-Körner auf drei verschiedene Methoden zurückgreifen (vgl. ebd., S. 126 f.):
1. Er kann sich auf den Aspekt des Wiederholungszwanges (ausgedrückt durch die Übertragung) konzentrieren; allerdings besteht hier die Gefahr der Fehlinterpretation.
2. Der Sinn kann mit Hilfe der Gegenübertragung erfasst werden; diese Arbeitsweise ist als introspektiv zu bezeichnen, denn der Pädagoge konzentriert sich hierbei auf seine in der Beziehung erlebten Gefühle und Gedanken (auch hier besteht die Gefahr der Fehlinterpretation der Beziehungsangebote des Klienten).
3. Die hermeneutische Methode, die nicht versucht, eine Wahrheit zu ergründen, sondern die Interpretation der gesprochenen Sprache in den Mittelpunkt stellt und evtl. Fehlinterpretationen zu verstehen versucht. „Nicht einmal die Bestätigung des Klienten kann als sicheres Zeichen für die Triftigkeit einer Deutung genommen werden, denn es kann leicht sein, daß dieser einer falschen Deutung aus Anpassungsgründen zustimmt oder eine triftige Deutung ablehnt, um seine Unabhängigkeit zu demonstrieren“ (ebd. S. 127). Diese Methode ist die schwierigste und fordert vom Pädagogen ein hohes Maß an Selbstreflektiertheit und Unbefangenheit gegenüber seinem Klienten.
Wenn ein Zugang zum Konflikt des Klienten gefunden wurde, sollte als Nächstes eine zentrale Fragestellung für die gemeinsame pädagogische Arbeit entworfen werden. Die Entwicklung eines Fokus’ ist bereits ein Stück der pädagogischen Arbeit (vgl. ebd., S. 138). Der Fokus zielt auf den inneren Konflikt, der durch oberflächliche Auseinandersetzungen ausgedrückt wird:
„Der Fokus nennt ein Interpretationsschema, das nicht nur das bisher Erfahrene zentriert und ordnet, sondern auch für die weitere Arbeit als Deutungshorizont wirksam wird.“ (ebd., S. 138)
Da oftmals die Fähigkeit zur Entwicklung eines Fokus’ oder die Fähigkeit, Ideen für die pädagogische Arbeit anhand eines solchen zu entwickeln, beim Klienten nicht gegeben ist, sollte es auch hier zunächst das Ziel der pädagogischen Arbeit sein, „(…) diese Fähigkeit, den Fokus produktiv zu nutzen, entwickeln zu helfen“ (ebd., S. 139).
Sobald ein Fokus entstanden ist, stellt sich die Frage, wie weit und auf welche Art und Weise der Pädagoge interveniert[13].
Körner und Ludwig-Körner schlagen drei Interventionsformen vor (vgl. ebd., S. 140 ff.):
1. Die Klärung: hier geht es um die Beantwortung der Frage, was in der aktuellen Situation zwischen Pädagoge und Klient geschieht.
2. Die Konfrontation: durch eine Konfrontation soll die Frage nach den unbewussten Absichten einer Handlung („Wozu?“) geklärt werden. Solche Konfrontationen können den Klienten belasten, bergen aber zugleich die Chance auf neue Erkenntnisse für denselben.
3. Die Deutung: diese Intervention geht noch weiter als eine Klärung oder Konfrontation. „Sie zielt auf eine Antwort nach den unbewußten Gründen für diejenigen Phänomene, die zuvor in der Klärung oder Konfrontation fokussiert wurden“ (ebd., S. 143). Deutungen sind in der pädagogischen Arbeit eher selten, aber nach Ansicht von Körner und Ludwig-Körner unerlässlich (vgl. ebd., S. 144).
Letzter praxisrelevanter Punkt für eine psychoanalytisch orientierte, pädagogische Arbeit ist für Körner und Ludwig-Körner die gemeinsame Arbeit von Pädagoge und Klient am Rahmen (vgl. ebd., S. 144). Die vordergründige Funktion des Rahmens (z.B. Regeln einhalten) tritt aus diesem Blickwinkel in den Hintergrund. In der direkten pädagogischen Situation geht es darum, den Rahmen immer wieder neu auszuhandeln und der Situation anzupassen (vgl. ebd., S. 145). Hierbei sind zwei Gesichtspunkte zu beachten. Zum einen ist es wichtig, die Dialektik des Rahmens zu erkennen. „Einerseits bestimmt der Rahmen, wie das Sprechen und Handeln innerhalb der Situation verstanden werden soll, andererseits definieren wir mit unserem Sprechen den Rahmen immer wieder neu usw.“ (ebd., S. 145). Dieser dynamische Prozess muss sowohl dem Pädagogen als auch dem Klienten bewusst sein. Zudem ist jede Situation und deren dazugehöriger Rahmen immer in einen größeren Rahmen eingebettet. Auch gesellschaftliche Wirklichkeit wird so zu einem übergeordneten Rahmen:
„Jede Erziehung zielt darauf, den Zögling mit den Merkmalen des sozialen Rahmen zu konfrontieren: Wer nicht lernt, den sozialen Rahmen von Situationen zu erkennen und wer diesen Rahmen nicht als gültige Hintergrundannahme berücksichtigt, gerät unvermeidlich in schwere soziale Konflikte; sein Handeln wird innerhalb seiner sozialen Situation deviant.“ (ebd., S. 145)
Sowohl in der Psychoanalyse als auch in der Pädagogik soll nach Ansicht von Körner und Ludwig-Körner ein situativer Veränderungsprozess als Arbeit am Rahmen verstanden werden (vgl. ebd., S. 146). Es muss dem Klienten gestattet sein, bei der Aushandlung des Rahmens seine subjektiven Anteile mit einzubringen. Auch der Pädagoge soll seine Vorstellung des Rahmens darlegen, sie aber dem Klienten nicht, im Sinne einer Anpassung, „überstülpen“ (vgl. ebd., S. 146).
3. Aggressivität: Versuch einer Definition
Nachdem geklärt wurde, welches die Ziele und Aufgaben der psychoanalytischen Pädagogik sind, soll sich im Folgenden dem Phänomen der Aggressivität genähert werden. Dazu stellt sich zu Beginn die Frage, was eigentlich Aggressivität ist; was Aggression.
3.1 Aggressivität gleich Aggression?
Schon die Frage alleine wirft erste Probleme auf. Man könnte nach verschiedenen Theorien zu diesem Thema fragen oder versuchen, die Begriffe von anderen abzugrenzen.
In den diagnostischen Leitlinien des ICD- 10- Systems, dem internationalen Klassifikationsraster psychischer Störungen, sind sowohl der Begriff „Aggressivität“ als auch der der „Aggression“ nicht explizit als Störung zu finden (vgl. Hopf 1998, S. 42). Es wird z.B. im Zusammenhang mit Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F 60) unter F 60.2 (dissoziale Persönlichkeitsstörungen) von einer niedrigen Schwelle für aggressives Verhalten gesprochen (vgl. Mombour/ Zaudig/ Mittelhammer/ Hiller/ Rummler 2000, S. 149.ff). Außerdem lassen sich unter „Störungen des Sozialverhaltens“ (F 91) eine Vielzahl von Symptomen finden (G1), die scheinbar aggressive Handlungen beinhalten (vgl. Quaschner/ Remschmidt 2000, S. 188 f.).
Aggression und Aggressivität sind komplexe Begriffe, in welche oftmals nicht nur verschiedene wissenschaftliche Theorien einfließen, sondern die auch aus persönlicher Einstellung heraus verwendet werden.
Dabei wird in der Literatur unterschiedlich mit den Begriffen umgegangen. Hier spiegelt sich der Umstand wider, dass schon der allgemeine Sprachgebrauch der Begriffe uneinheitlich ist. Für den Einen ist die angeborene Fähigkeit des Menschen zur Durchsetzung individueller Interessen „Aggression“, für den Anderen „Aggressivität“; für den Einen ist „Aggression“ das gezielte Verhalten, um anderen Menschen zu schaden (z.B. bei körperlicher Gewalt[14] ), Andere bezeichnen dies als „Aggressivität“. Wiederum für andere bedeuten die Begriffe undifferenziert jegliche Form der Normabweichung innerhalb der Gesellschaft oder einer beliebigen Gruppe.
Bei der Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die sich zur Definition anbieten, wird es unmöglich sein, eine solche zu finden, die allgemeine Gültigkeit hat. Dieser Umstand wird durchgängig in der Literatur betont und zwar unabhängig davon, welcher theoretischen Grundlinie ein Autor folgt.
Festzuhalten ist, dass der Begriff „Aggression“ aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik nicht vorrangig ein beobachtbar schädigendes Verhalten beschreibt. Ein solches Verhalten würde dort am Ehesten als „aggressiv“ bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu wird in vielen Bereichen der Psychologie gerade dann von „Aggression“ gesprochen, wenn es um beobachtbares, verletzendes Verhalten geht, und von „Aggressivität“, wenn die Bereitschaft zur Aggression beschrieben werden soll (vgl. Zimbardo/ Gerrig 1999, S. 334). Von einigen Vertretern der Lerntheorie[15] wird deshalb gefordert, den Begriff „Aggression“ ganz zu streichen und durch Begriffe wie „aggressives Verhalten“ oder „aggressive Emotionen“ zu ersetzen (vgl. Nolting 1997, Seite 30 f.). Bei einer derartigen Definition würden allerdings im Sinne der psychoanalytischen Pädagogik wichtige Teilbereiche (z.B. Gewalt-Phantasien oder Durchsetzungsvermögen) unberücksichtigt bleiben. Es erscheint deshalb schon sinnvoll, eine begriffliche Trennung der Begriffe „Aggression“ und „Aggressivität“ vorzunehmen, weshalb im Folgenden von „Aggressivität“ gesprochen wird, wenn eine beobachtbare Verhaltensform (aggressives Verhalten) gemeint ist, die die intentionale Schädigung einer Sache oder einer Person beinhaltet. Sie wird dabei als Teil der Aggression verstanden, wie weiter unten (s. 3.3) noch dargelegt wird.
Das beantwortet aber noch nicht die Frage nach der Definition des Begriffs „Aggression“.
3.2 Etymologie des Wortes „Aggression“
Das Wort „Aggression“ hat seinen Ursprung im Lateinischen. Aus der lateinischen Präposition ad (heran; hinzu) und der singulären Verbform gradi (schreiten; gehen) bildete sich die Form ag-gredi, was soviel bedeutet wie: „herangehen, heranschreiten“. Das Wort „Aggression“ wurde erst im 18. Jahrhundert aus dem gleichbedeutenden, lateinischen „aggressio“ entlehnt. In diesem Wortstamm ist zusätzlich noch die Bedeutung des „hostes“ (Feind) vorhanden, woraus sich weiter gehend die Bedeutung des „kriegerischen Angriffs“ ableitet.
Das Adjektiv „aggressiv“ wurde erst später (im 19. Jahrhundert) neulateinisch gebildet und zwar orientiert am französischen „agressif“ (herausfordernd) (vgl. Duden: Band 7 2001, S. 24).
3.3 Psychoanalytische Definition des Aggressionsbegriffs
Ausgehend von dem Ursprung des Wortes wird Aggression in der Psychoanalyse meist als „(…) jegliche positive wie negative Bewegung hin auf Personen oder Gegenstände in der Außenwelt“ (Rauchfleisch 1996, S. 11) verstanden. Auch Ratzke verbindet mit dem Aggressionsbegriff „(…) sowohl positive als auch negativ bewertete Verhaltensmuster“ (Ratzke 1999, S. 16). Aggression ist hiernach also ein umfangreicher, weit gefasster Begriff, der vorrangig durch Aktivität gekennzeichnet ist.
Allerdings kann sich diese „Kraft“ auch „(…) in destruktiver Weise entwickeln“ (Rauchfleisch 1996, S. 36), weshalb in der Psychoanalyse auch von Aggression gesprochen, wenn ein schädigendes Verhalten vorliegt. Dieses kann sich unterschiedlich ausdrücken:
„Die Aggression kennt andere Modalitäten als die heftige und zerstörerische motorische Aktion; es gibt keine Verhaltensweise, weder eine negative (z.B. Verweigerung von Hilfeleistung) noch eine positive, symbolische (z.B. Ironie) noch eine effektiv ausgeführte, die nicht aggressiv sein könnte.“ (Laplanche/ Pontalis 1998, S. 40)
Aggression kann demnach negativ gekennzeichnet sein. Im Übrigen zeigt das Zitat, dass der Begriff der Aggression durchaus mit der unter 3.1 beschriebenen Aggressivität verknüpft ist, und dass sich Aggression konkret auf sehr unterschiedliche Weise äußern kann. Viele Autoren, die nicht dem Bereich der Psychoanalyse angehören, sträuben sich gegen diese Definition von Aggression, weil sie der Ansicht sind, dass hiernach die Begriffsverwirrung noch beträchtlicher wird (vgl. Selg 1982, S. 46). Richtig ist, dass es bei dieser Definition schwierig wird, konkrete Strategien für den Umgang mit „negativer“ Aggression (Aggressivität) zu entwickeln; andererseits ist es nur mit diesem Verständnis möglich, aggressives Verhalten auf seine Ursprünge zu untersuchen, ohne zu lediglich oberflächlichen Aussagen zu kommen. Das ist besonders für ein psychoanalytisch orientiertes Verstehen aggressiven Verhaltens wichtig.
[...]
[1] Ich bin mir darüber im Klaren, dass es angebracht wäre, sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu wählen. Allerdings halte ich es für schwierig, diese jeweilige Verdoppelung stringent durchzuführen. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit nur die maskuline Form benutzt.
[2] Die Schreibweise dieser Wissenschaft ist in der Literatur unterschiedlich. Zum Teil werden beide Wörter groß geschrieben, zum Teil nur das der „Pädagogik“. Ich habe mich dazu entschlossen in meiner Arbeit das Wort „psychoanalytisch“ als Adjektiv zu verstehen und schreibe es demzufolge klein.
[3] Im Bereich der Lerntheorie gibt es viele solcher Versuche. Eine konkrete Anleitung für spezielle Situationen findet sich z.B. bei Nolting (1997), bei Petermann/ Petermann (1991) oder bei Dutschmann (1999/ 2000).
[4] Besonders im Bezug auf aggressive Kinder muss die Frage nach den genannten Fähigkeiten gestellt werden: „Die Psychoanalyse hatte sich vor allem mit den gehemmten, neurotischen Kindern beschäftigt und bei diesen viele therapeutische und pädagogische Erfolge erzielt. Vor den „enthemmten“ dagegen, bei denen es galt, innere Kontrollen erst aufzubauen, zeigte sie sich etwas hilflos.“ (Bittner 1994, S. 176)
[5] Über die Unterschiedlichkeit der Ausbildung soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, obwohl sich hier bei näherer Betrachtung zentrale Differenzen eröffnen (zu denken sei z.B. nur an die vorgeschriebene eigene Lehranalyse, die jeder Analytiker in seiner Ausbildung durchläuft).
[6] Der Umstand, dass die Psychoanalyse sich von Anfang an „(…) als ein ärztliches Heilverfahren empfohlen hat“ (Trescher 1987, S. 199) und somit Prozesse der Entwicklung in den Hintergrund stellte, führt auch heute noch dazu, dass die Psychoanalyse vorrangig im klinischen Kontext zu finden ist.
[7] Diese Begriffe neutralisieren sich umgangsprachlich. Unbewusst absichtsvolles Handeln bedeutet hier, dass unbewusste Prozesse zu einer Handlung führen, die eine Situation hervorruft, die sich der Klient wünscht.
[8] Dieser Begriff wurde von Freud eingeführt (vgl. Freud 1920, S. 229)
[9] Wie oft diese teilnehmende Haltung in der Psychoanalyse zu finden ist, soll hier nicht weiter hinterfragt werden; allerdings hält Wiesse in diesem Zusammenhang fest: „Wie schwer tun sich Psychoanalytiker mit dem Tun, mit dem Einmischen und Streiten“ (Wiesse 1994, S. 7).
[10] Körner und Ludwig-Körner benutzen den Begriff der „Statik“ deshalb, weil er bestimmte, feststehende Voraussetzungen beschreibt, die für eine gelingende psychoanalytische Pädagogik wichtig sind (vgl. ebd., S. 73)
[11] Diese Begriffe gehen auf Freud zurück und sollen hier nicht näher erläutert werden (s.: Freud 1905c, S. 180/ Freud 1910a, S. 126)
[12] Dies ist der unter 2.2.2 beschriebene „Wiederholungszwang“.
[13] Intervenieren heißt hier nicht nur sich sprachlich zu äußern, sondern einen Prozess der pädagogischen Arbeit zu unterbrechen und etwas Neues (z.B. eine neue Perspektive) hinzu zu fügen (vgl. Körner und Ludwig-Körner 1997, S. 139)
[14] Diese Vorstellung von den Begriffen Aggression, bzw. Aggressivität ist heute im Alltagssprachlichen am häufigsten anzutreffen.
[15] Auf die einzelnen Richtungen innerhalb der Lerntheorie und deren Erklärungen für die Entstehung von Aggression soll im weiteren Verlauf nicht näher eingegangen werden
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die psychoanalytische Pädagogik von anderen Ansätzen?
Sie fokussiert sich auf unbewusste Prozesse, frühe Kindheitserfahrungen und die emotionale Beziehung zwischen Pädagoge und Kind.
Wer war Fritz Redl und was ist sein Beitrag zum Thema Aggression?
Fritz Redl war ein Pionier, der Konzepte wie das "Life-Space-Interview" entwickelte, um akut aggressives Verhalten im pädagogischen Alltag zu bearbeiten.
Was versteht man unter "szenischem Verstehen"?
Es ist eine Methode, bei der das Verhalten eines Kindes als Inszenierung innerer Konflikte begriffen wird, um die zugrunde liegende Botschaft zu verstehen.
Warum ist Grenzsetzung in der Erziehung laut diesem Ansatz notwendig?
Grenzsetzung dient nicht der Bestrafung, sondern bietet dem Kind Struktur und Sicherheit, um mit eigenen destruktiven Impulsen umzugehen.
Welchen Anteil hat die Institution Schule an aggressiven Verhaltensweisen?
Die Arbeit untersucht, wie starre Strukturen und die Rolle der Lehrkraft unbewusst Aggressionen bei Schülern fördern oder mildern können.
- Quote paper
- Axel Ramberg (Author), 2003, Zum Umgang mit Aggression und Aggressivität aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133373