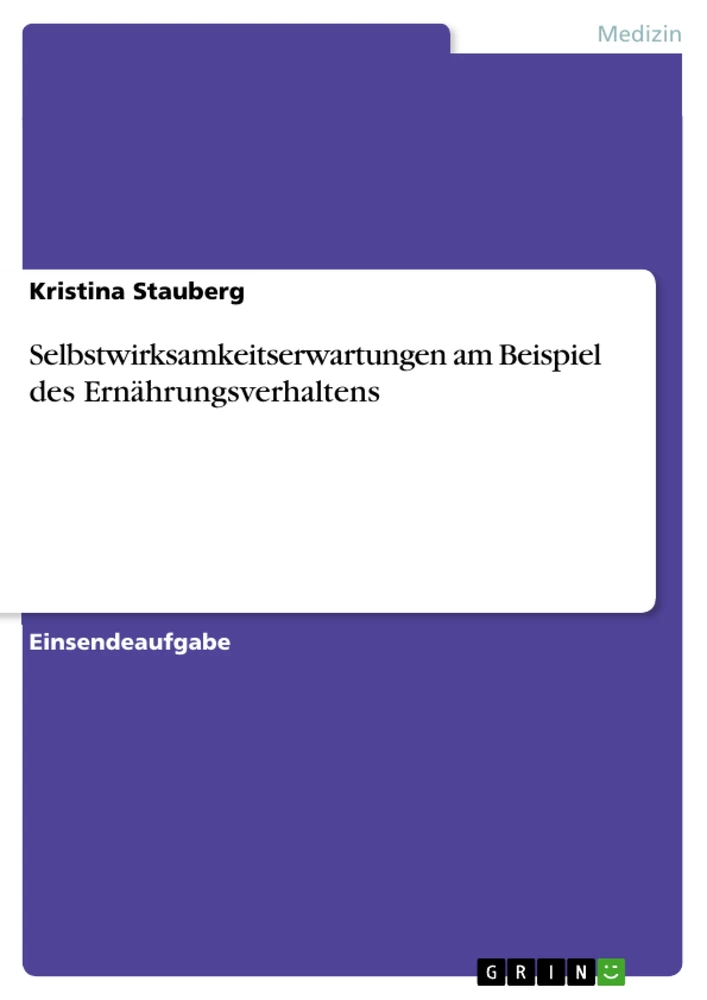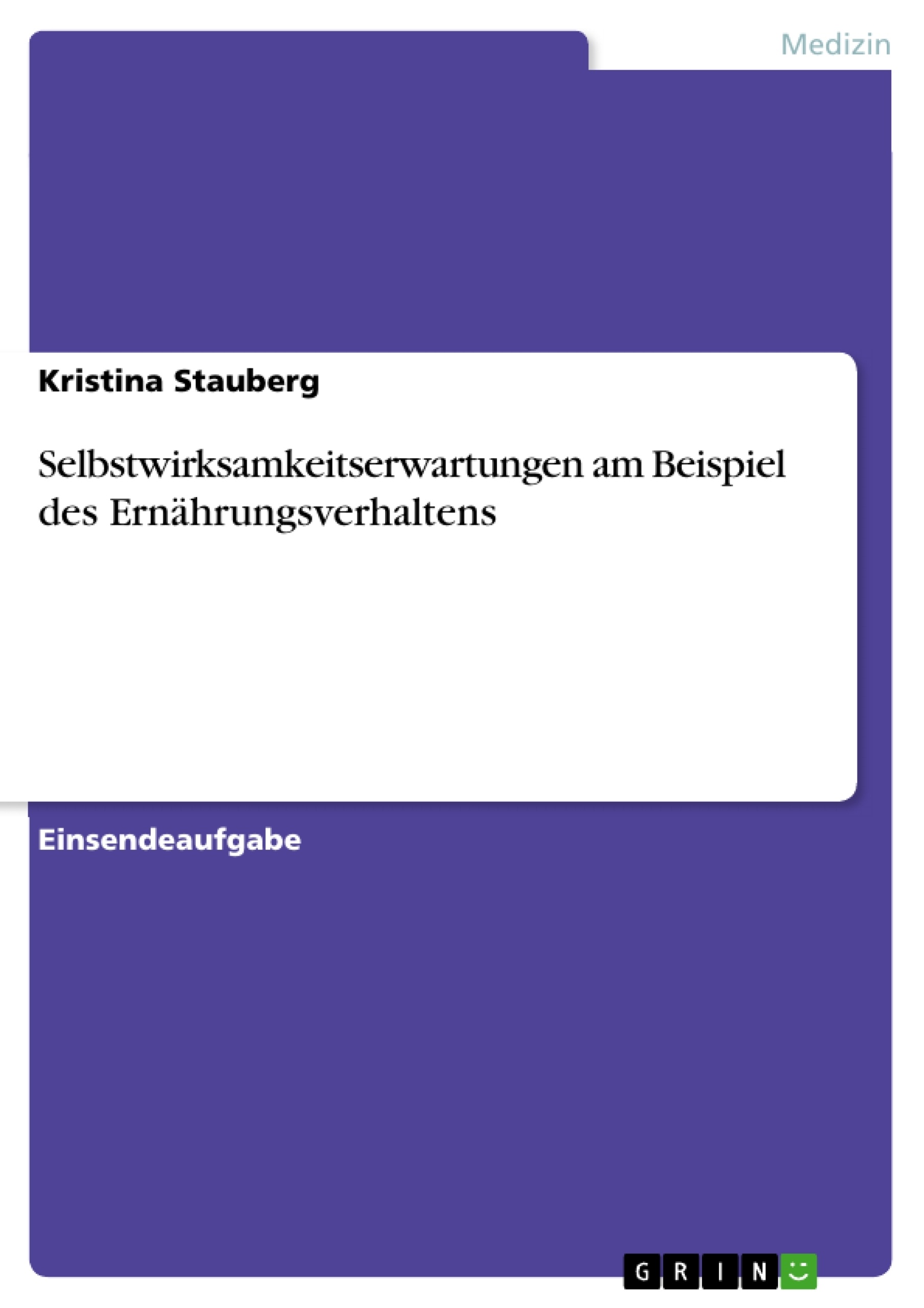Diese Arbeit beschäftigt sich mit Selbstwirksamkeitserwartungen am Beispiel des Ernährungsverhaltens. Ernährung unterteilt sich in Genuss und Kultur und sie ist neben der Bewegung und dem Stressmanagement der Hauptteil, um ein gesundes Leben führen zu können. Die vorliegende Studie zeigt, wie Deutschland mit dem Thema umgeht und sich ernährt. Zusätzlich zeigt sie, welche Faktoren ihnen dabei wichtig sind und wie es sich auf ihre Gesundheit auswirkt.
Durch psychologische, soziale und biologische Einflussfakten wird unser Ernährungsverhalten bestimmt und gesteuert. Zu den sozialen Einflussfaktoren zählt die soziale Unterstützung innerhalb des Freundes- und Familienkreises. Schon früh ist das Ernährungsverhalten des Kindes in der Familie oder der sozialen Umgebung entscheidend für das Essverhalten. Die Hunger- und Sättigungsregulation, die hormonelle Steuerung des Körpergewichts und der Nahrungsmengen, sowie die individuelle Aufnahmefähigkeit des Magens gehören zu den biologischen Einflussfaktoren. Die psychologischen Einflussfaktoren sind emotionale und kognitive Faktoren. Diese können positive und negative Auswirkung auf die Essgewohnheit nehmen. Andererseits wird bei einem gemeinsamen Essen unbewusst mehr Nahrung aufgenommen und verstärkt sich durch die sozialen Kontakte. Die eigene Wahrnehmung, die Vorstellung von Ernährung und das Denken, sowie die Risikoeinschätzung von gesunder und ungesunder Nahrungsaufnahme entspringen den kognitiven Faktoren.
Inhaltsverzeichnis
- Selbstwirksamkeitserwartung
- Definition „Selbstwirksamkeitserwartung“ (auch bekannt als Kompetenzerwartung)
- Fragebogen zur Messung der spezifischen Selbstwirksamkeit zum Thema „gesunde Ernährung“
- Wissenschaftliche Studien zum Thema „,,Selbstwirksamkeitserwartung“
- Beratungsgespräch
- Einordnung des Kunden in den Prozess der Verhaltensänderung
- Wesentliche Aspekte in einem Beratungsgespräch
- Darstellung des Gesprächsverlaufs
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung und ihrer Anwendung im Bereich der Gesundheitsförderung. Sie beleuchtet insbesondere die Rolle der Selbstwirksamkeitserwartung bei der Verhaltensänderung, insbesondere im Kontext von gesunder Ernährung.
- Definition und Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung
- Methoden zur Messung der Selbstwirksamkeitserwartung
- Die Rolle der Selbstwirksamkeitserwartung in der Gesundheitsförderung
- Anwendungsbeispiele im Bereich der Ernährung
- Die Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung im Rahmen von Beratungsgesprächen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Selbstwirksamkeitserwartung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung und erklärt die Theorie von Albert Bandura. Es beschreibt die Auswirkungen einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung auf das menschliche Verhalten, die Leistung und das Wohlbefinden.
- Kapitel 2: Fragebogen zur Messung der spezifischen Selbstwirksamkeit zum Thema „gesunde Ernährung“: Dieses Kapitel präsentiert einen Fragebogen zur Messung der spezifischen Selbstwirksamkeitserwartung im Bereich der gesunden Ernährung. Es beinhaltet eine Tabelle mit den Items des Fragebogens und die Interpretation der Ergebnisse anhand von Normwerten.
- Kapitel 3: Beratungsgespräch: Dieses Kapitel behandelt die Integration der Selbstwirksamkeitserwartung in ein Beratungsgespräch. Es beschreibt die Einordnung des Klienten in den Prozess der Verhaltensänderung und die wesentlichen Aspekte eines erfolgreichen Gesprächs.
Schlüsselwörter
Selbstwirksamkeitserwartung, Kompetenzerwartung, Gesundheitsverhalten, Verhaltensänderung, gesunde Ernährung, Beratung, Motivation, Gesundheitsförderung, Albert Bandura
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Selbstwirksamkeitserwartung“?
Es ist der Glaube einer Person an die eigene Fähigkeit, schwierige Aufgaben zu bewältigen und Ziele (z.B. eine Ernährungsumstellung) aus eigener Kraft zu erreichen.
Wie beeinflusst die Selbstwirksamkeit das Ernährungsverhalten?
Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit halten gesunde Essgewohnheiten eher durch, setzen sich höhere Ziele und gehen besser mit Rückschlägen um.
Welche Faktoren bestimmen unser Ernährungsverhalten?
Das Verhalten wird durch soziale Faktoren (Unterstützung), biologische Faktoren (Hungerregulation) und psychologische Faktoren (Emotionen, Kognition) gesteuert.
Wie kann man Selbstwirksamkeit messen?
In der Forschung werden hierzu spezielle Fragebögen verwendet, die die kognitive Einschätzung der eigenen Kompetenz in Bezug auf gesunde Ernährung abfragen.
Was ist die Rolle des Beraters bei einer Verhaltensänderung?
Der Berater ordnet den Kunden in den Prozess der Verhaltensänderung ein und stärkt gezielt dessen Selbstwirksamkeit durch motivierende Gesprächsführung.
Wer entwickelte die Theorie der Selbstwirksamkeit?
Die Theorie geht maßgeblich auf den Psychologen Albert Bandura zurück und ist ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsförderung.
- Arbeit zitieren
- Kristina Stauberg (Autor:in), 2017, Selbstwirksamkeitserwartungen am Beispiel des Ernährungsverhaltens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1333840