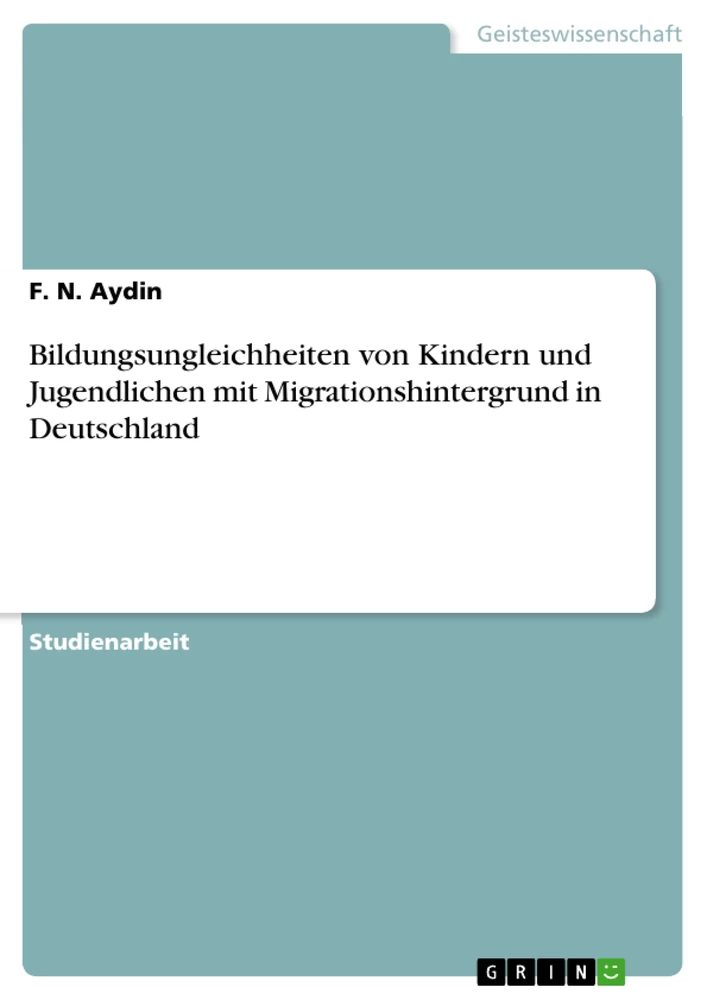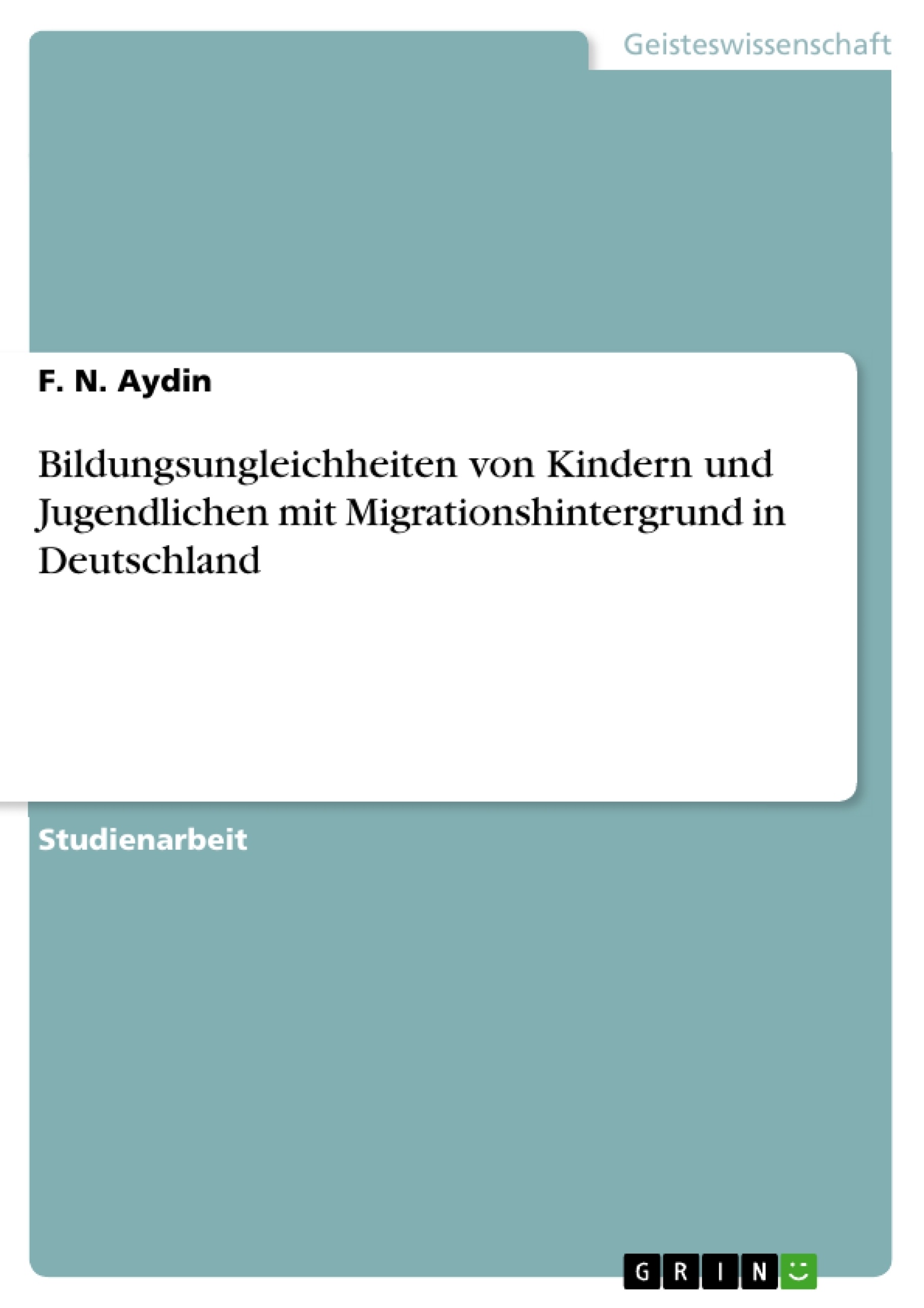Die folgende Arbeit beschäftigt sich intensiv mit der Problematik des deutschen Bildungssystems in Bezug auf benachteiligte gesellschaftliche Schichten. Hierbei wird spezifisch die migrantischen Bildungsungleichheiten in Deutschland herangezogen und analysiert. Es ist wichtig, die gesellschaftlichen und theoretischen Ursachen und Mechanismen zu untersuchen, die zu Bildungsungleichheiten führen, um zu verhindern, dass individualisierende, oft rassistisch geprägte Erklärungen in der öffentlichen Debatte Oberhand gewinnen und außerdem die tatsächlichen Ursachen identifiziert werden müssen, um langfristig tatsächliche Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.
Einführend werden in der vorliegenden Arbeit die Begrifflichkeiten wie Migration, Migrationshintergrund und Bildungsungleichheit explizierter vorgestellt, um einen Ausblick auf die schwierigen Begriffserläuterungen darzustellen. Daraufhin wird die deutsche Migrationsgeschichte in Deutschland angeknüpft und bearbeitet. Anschließend werden auf die Bildungssituation von Migrant*innen in Deutschland näher eingegangen und herausgearbeitet. Der nächste Teil beschäftigt sich mit den theoretischen Begründungen der Bildungsungleichheiten nach Bourdieu und Boudon und ebenfalls mit den Erklärungsansätzen der Problematik der migrantischen Bildungsungleichheiten. Die Handlungsmöglichkeiten und somit möglichen Lösungsansätze werden anschließend dargestellt und mit dem Fazit wird die Arbeit folglich beendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BEGRIFFSERKLÄRUNG
- 2.1 MIGRATION
- 2.2 MIGRATIONSHINTERGRUND
- 2.3 BILDUNG
- 2.4 BILDUNGSUNGLEICHHEIT
- 3. DIE DEUTSCHE MIGRATIONSGESCHICHTE
- 3.1 DIE NACHKRIEGSMIGRATION
- 3.2 DIE ARBEITSMIGRATION (BIS 1975)
- 3.3 DIE FLUCHTBEWEGUNG (SEIT 2015)
- 4. DIE BILDUNGSSITUATION VON MIGRANTENKINDERN IN DEUTSCHLAND
- 4.1 TEILHABE DER MIGRANT*INNEN IM BILDUNGSSYSTEM
- 4.1.1 TEILHABE AN DER VORSCHULISCHEN BILDUNG
- 4.1.2 TEILHABE AN DEN SCHULFORMEN DER SEKUNDARSTUFE
- 4.1.3 TEILHABE AN FÖRDERSCHULEN
- 4.2 BENACHTEILIGUNGEN DER MIGRANT*INNEN AUF IHREM BILDUNGSWEG
- 4.3 DIE INTERNATIONAL VERGLEICHENDE SCHULLEISTUNGSSTUDIE PISA
- 5. ERKLÄRUNGSANSÄTZE FÜR MIGRATIONSSPEZIFISCHE BILDUNGSBENACHTEILIGUNGEN
- 6. THEORETISCHE BEGRÜNDUNGEN DER BILDUNGSUNGLEICHHEITEN NACH BOURDIEU UND BOUDON
- 7. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Problem der Bildungsungleichheiten von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die Ursachen und Mechanismen, die zu diesen Ungleichheiten führen, und beleuchtet die gesellschaftlichen und theoretischen Hintergründe.
- Die Bedeutung von Migration und Migrationshintergrund für die Bildungslandschaft in Deutschland
- Die Herausforderungen der Teilhabe von Migrant*innen im Bildungssystem
- Die Ursachen und Folgen von Bildungsbenachteiligungen für Migrant*innen
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheiten nach Bourdieu und Boudon
- Handlungsmöglichkeiten und Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungssituation von Migrant*innen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Bildungsungleichheiten von Migrant*innen in Deutschland vor und skizziert die zentralen Forschungsfragen. Im Anschluss werden die Begriffe Migration, Migrationshintergrund und Bildungsungleichheit definiert. Die deutsche Migrationsgeschichte wird im dritten Kapitel betrachtet, wobei die Nachkriegsmigration, die Arbeitsmigration und die Fluchtbewegung seit 2015 thematisiert werden.
Das vierte Kapitel analysiert die Bildungssituation von Migrant*innen in Deutschland, insbesondere die Teilhabe an verschiedenen Bildungsstufen und die Benachteiligungen auf dem Bildungsweg. Anschließend werden verschiedene Erklärungsansätze für migrationsbedingte Bildungsungleichheiten vorgestellt.
Das Kapitel 6 widmet sich den theoretischen Begründungen von Bildungsungleichheiten nach Bourdieu und Boudon. Abschließend werden Handlungsmöglichkeiten und Lösungsansätze diskutiert, die die Chancengleichheit im Bildungssystem verbessern sollen.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Migration, Migrationshintergrund, Teilhabe, Benachteiligung, Integration, Schulsystem, Bourdieu, Boudon, Bildungssituation, Chancengleichheit, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es Bildungsungleichheiten für Migrantenkinder?
Die Ursachen sind komplex und liegen oft in strukturellen Benachteiligungen, institutioneller Diskriminierung sowie sozialen und ökonomischen Mechanismen.
Was besagt die Theorie von Bourdieu zur Bildung?
Bourdieu erklärt Bildungsungleichheit durch das unterschiedliche kulturelle, soziale und ökonomische Kapital, das Kinder aus ihrem Elternhaus mitbringen.
Welche Rolle spielt die vorschulische Bildung?
Die Teilhabe an vorschulischer Bildung ist entscheidend für den späteren Schulerfolg, jedoch haben Migrantenkinder hier oft geringere Teilhabequoten.
Was zeigte die PISA-Studie in Bezug auf Migration?
PISA verdeutlichte, dass in Deutschland der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft (bzw. Migrationshintergrund) und Schulerfolg besonders stark ausgeprägt ist.
Was ist der Unterschied zwischen primären und sekundären Herkunftseffekten?
Nach Boudon sind primäre Effekte die direkten Einflüsse des Elternhauses auf die Leistung, während sekundäre Effekte die Bildungsentscheidungen (z. B. Wahl der Schulform) trotz gleicher Leistung beschreiben.
- Arbeit zitieren
- F. N. Aydin (Autor:in), 2023, Bildungsungleichheiten von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1333843