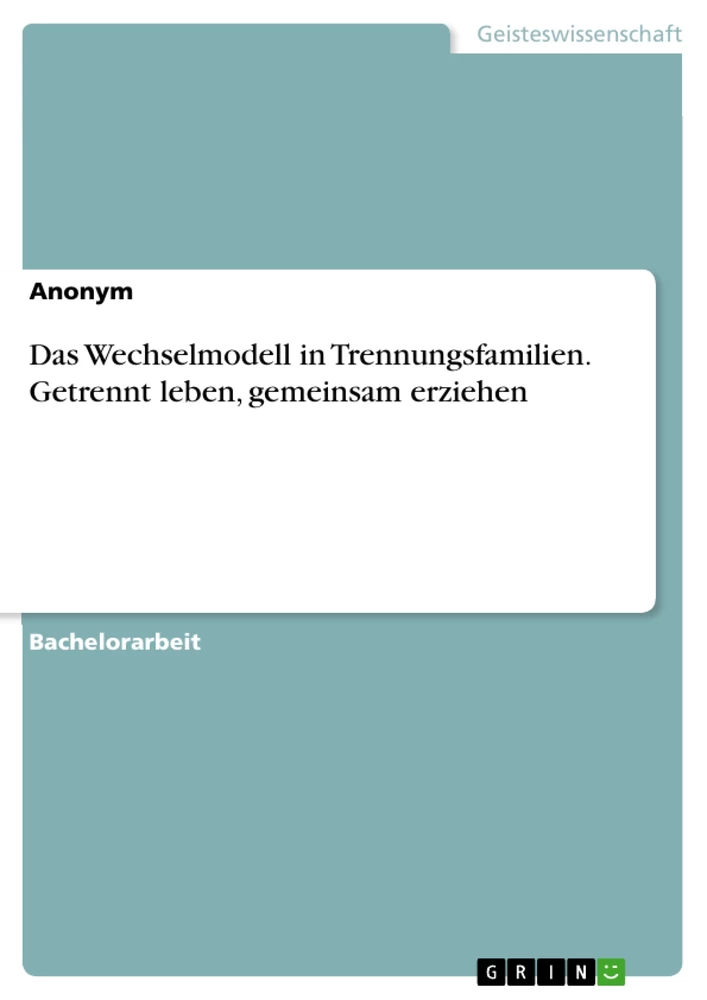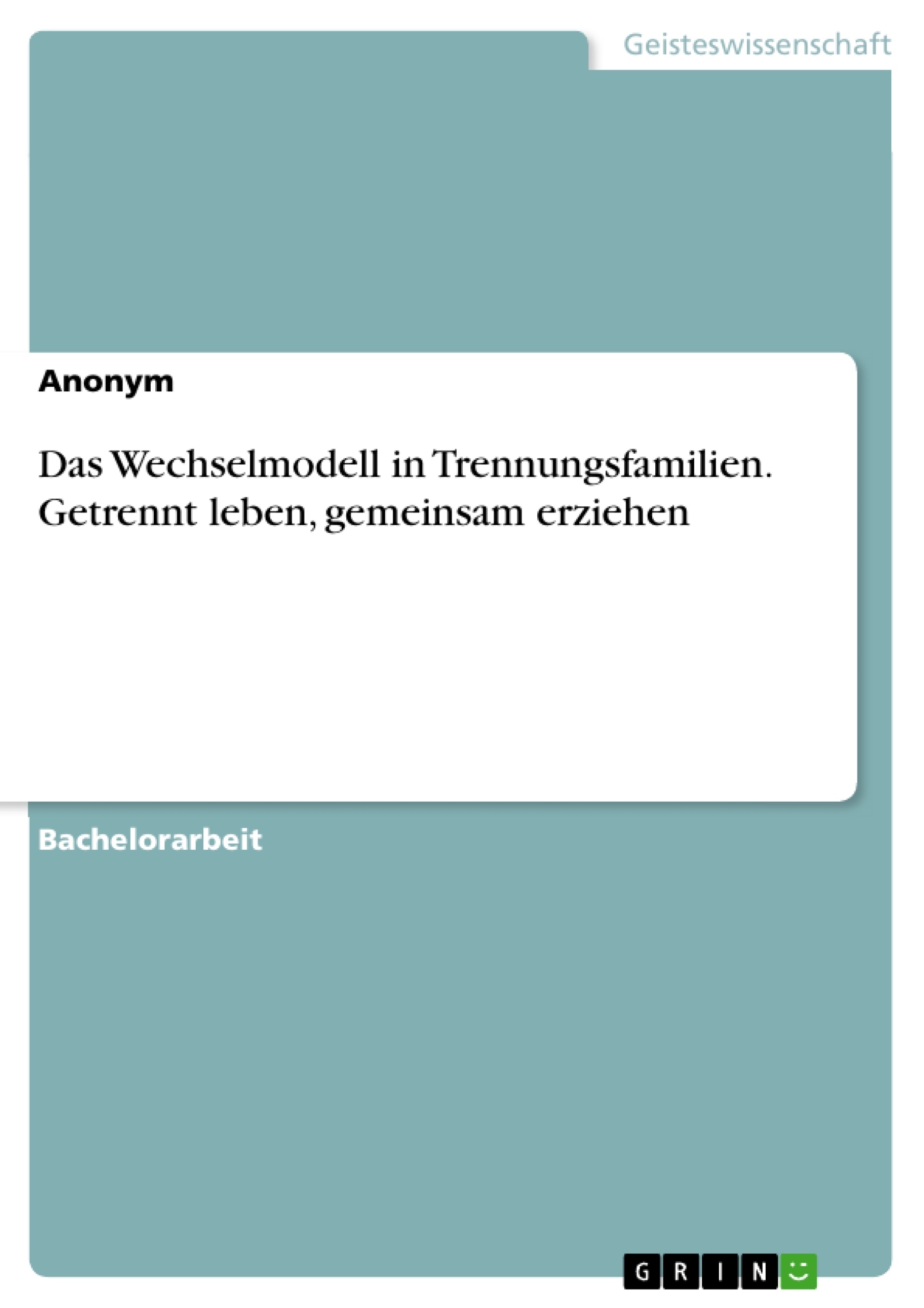In dieser Arbeit möchte ich zunächst mit der Kontinuität und dem Wandel der Familie zeigen, dass sich ihre Funktion und Ausgestaltung schon immer in einem Änderungsprozess befindet, der die Vielfalt der heutigen Familienformen erklärt. Aus dieser Perspektive zerstören Trennungen nicht nur Familie, sondern strukturieren sie zugleich um. Auch wenn das Ideal der Kernfamilie weiterhin für viele Menschen prägend und erfüllend ist, sind inzwischen auch andere Lebensmodelle akzeptiert. Die geänderten Normvorstellungen gegenüber der Ehe und der Scheidung, ein neues Eltern- und Vaterverständnis, aber auch die Fokussierung auf das Kindeswohl in und nach der Partnerschaft, erklären die Entstehung des neuen Betreuungsmodells. Begleitet wurden diese Änderungsprozesse durch juristischen Reformen, die wiederum unser Bild von Familie prägen, auch diese sollen erwähnt werden.
Am Kindeswohl anknüpfend wird im letzten Teil das Wechselmodell und die Studienlage zu ihm auch kritisch hinterfragt. Ob es tatsächlich ein neues Leitmodell für alle Trennungsfamilien werden sollte, wie bereits von einigen gefordert wird, und für wen es überhaupt realisierbar ist, wird hier genauer beleuchtet.
In vielen Ländern Europas bekommt das klassische Betreuungsarrangement für Kinder nach der elterlichen Trennung inzwischen Konkurrenz: statt Mütter und Väter in ein bestreuendes und ein zahlendes Elternteil zu trennen, fördert das Wechselmodell die Elternschaft auf Augenhöhe. Die Eltern teilen sich sowohl die Verantwortung für das gemeinsame Kind, als auch die Betreuungszeit. Das Kind lebt zu etwa gleichen Anteilen ab-wechselnd in beiden Haushalten und hat somit zwei Zuhause. Diese Art der Betreuung ermöglicht sowohl der Mutter als auch dem Vater eine intensive Beziehung zum Kind beizubehalten und fortzuführen, da ein gemeinsamer Alltag erlebt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familie
- Trennung und Elternschaft
- Exkurs: Familie im Recht
- Trennungsforschung
- Das Wechselmodell
- Bedingungen für das Wechselmodell
- Argumente für und gegen das Wechselmodell
- Empirische Befunde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Wechselmodell in Trennungsfamilien. Sie untersucht, inwiefern dieses Modell als Alternative zum klassischen Betreuungsmodell nach der elterlichen Trennung betrachtet werden kann und welche Auswirkungen es auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind hat.
- Der Wandel der Familienformen und die Bedeutung des Kindeswohls
- Die Funktionsweise und die Bedingungen für das Wechselmodell
- Argumente für und gegen das Wechselmodell
- Empirische Befunde zur Wirksamkeit des Wechselmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Familie und zeigt, wie sich ihre Funktion und Ausgestaltung im Laufe der Zeit verändert haben. Es wird deutlich, dass das Familienbild im Wandel ist und die traditionellen Strukturen zunehmend in Frage gestellt werden. Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Thema Trennung und Elternschaft. Hier werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Familien im Wandel sowie die Ergebnisse der Trennungsforschung beleuchtet. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das Wechselmodell. Es werden die Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung dieses Betreuungsmodells sowie die Argumente für und gegen seine Anwendung diskutiert. Die empirischen Befunde zum Wechselmodell werden im vierten Kapitel analysiert.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beleuchtet die Themen der Familienforschung, der Trennung und Elternschaft, sowie des Wechselmodells als Betreuungsform in Trennungsfamilien. Sie konzentriert sich dabei auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die empirische Forschung und die Auswirkungen auf das Kindeswohl. Weitere zentrale Aspekte sind die Veränderungen des Familienbildes, die Entwicklung neuer Familienformen sowie die Diskussion um die Gleichberechtigung von Eltern in der Erziehungsarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Wechselmodell in Trennungsfamilien?
Beim Wechselmodell teilen sich die Eltern die Betreuung des Kindes zu etwa gleichen Anteilen. Das Kind lebt abwechselnd in beiden Haushalten und hat somit zwei Zuhause.
Welche Vorteile bietet das Wechselmodell für Väter?
Es ermöglicht Vätern eine intensivere Beziehung zum Kind und eine Erziehung auf Augenhöhe, statt nur ein „Besuchselternteil“ zu sein.
Ist das Wechselmodell für jede Familie geeignet?
Nein, es erfordert eine hohe Kooperationsbereitschaft der Eltern, räumliche Nähe der Wohnorte und eine gute Kommunikation, um das Kindeswohl nicht zu gefährden.
Wie wirkt sich das Wechselmodell auf das Kindeswohl aus?
Studien zeigen oft positive Ergebnisse, da die Bindung zu beiden Elternteilen erhalten bleibt, jedoch kann es bei hohem elterlichem Konfliktpotenzial belastend sein.
Welche rechtlichen Reformen beeinflussen das Wechselmodell?
Juristische Reformen im Familienrecht zielen zunehmend darauf ab, die gemeinsame elterliche Sorge und alternative Betreuungsmodelle nach der Scheidung zu fördern.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Das Wechselmodell in Trennungsfamilien. Getrennt leben, gemeinsam erziehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1334002