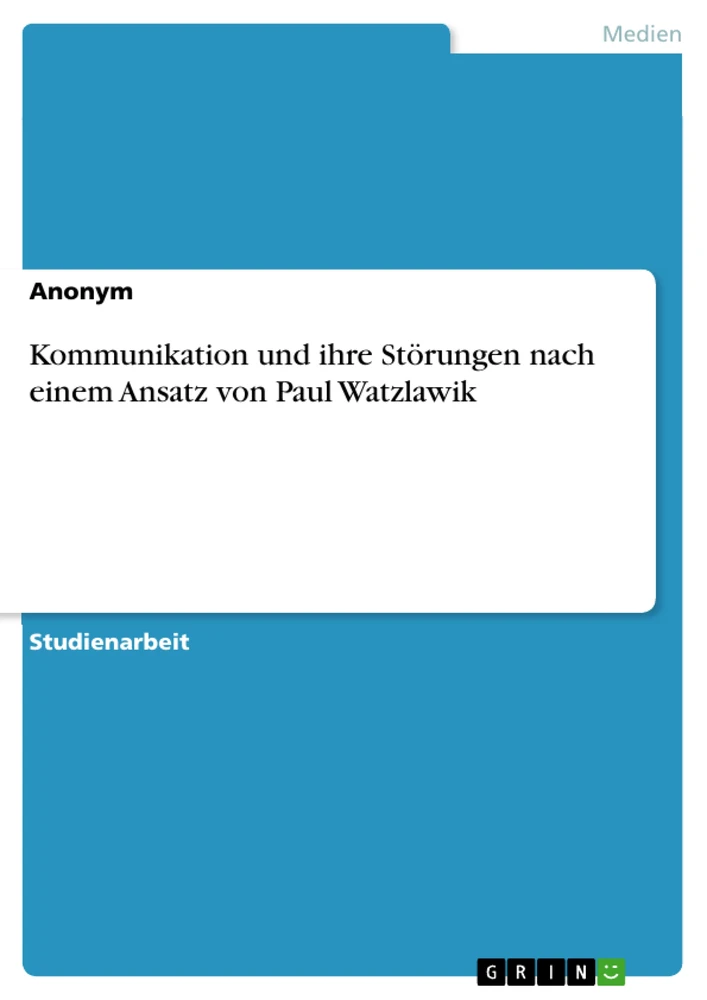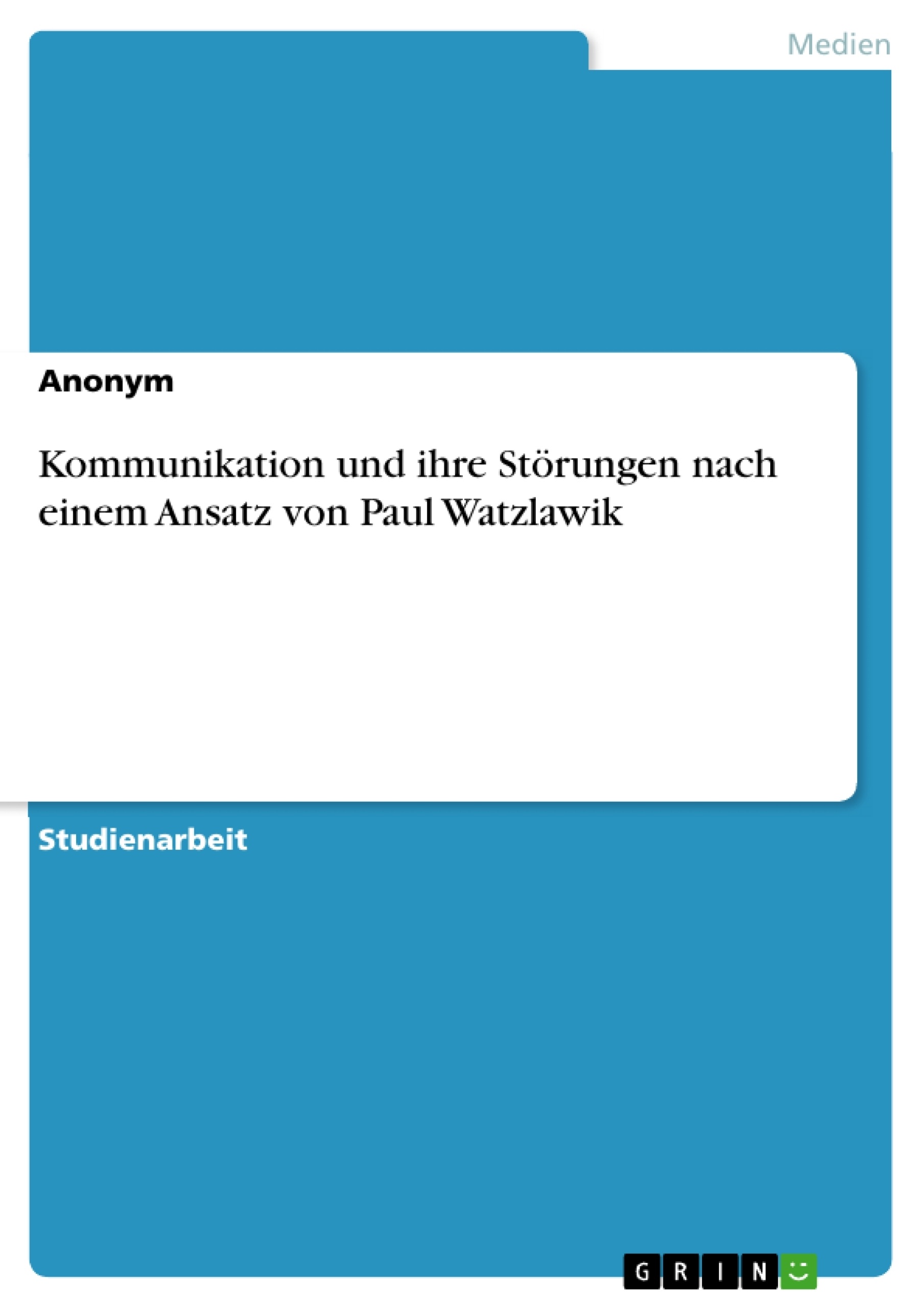Paul Watzlawick (1921-2007) entwickelte entsprechend des konstruktivistischen Ansatzes eine Reihe von Axiomen zur menschlichen Kommunikation. Entlang dieser wird in der Hausarbeit Kommunikation beschrieben, Axiome erläutert sowie (Kommunikations-)Störungen aufgegriffen. Dabei liegt das erste Axiom "Man kann nicht nicht kommunizieren" allem zu Grunde. Mit anschaulichen Beispielen erläutert, ist diese Arbeit für jedes Niveau verständlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schematische Auseinandersetzung mit den Axiomen Watzlawicks
- Erstes Axiom: Über die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren
- Zweites Axiom: Über den Inhalts- und Beziehungsaspekt einer Kommunikation
- Drittes Axiom: Über die Interpunktion der Kommunikationsabläufe
- Viertes Axiom: Über digitale und analoge Modalitäten
- Fünftes Axiom: Über symmetrische und komplementäre Kommunikationsabläufe
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die fünf Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick und deren Störungen. Ziel ist es, Watzlawicks Modell zu beschreiben und kritisch zu hinterfragen, sowohl allgemein als auch im Kontext des schulischen Alltags. Die Arbeit basiert auf der Originalliteratur Watzlawicks und relevanter Sekundärliteratur.
- Beschreibung der fünf Axiome der Kommunikation nach Watzlawick
- Analyse von Kommunikationsstörungen im Kontext der Axiome
- Kritische Auseinandersetzung mit den Axiomen und deren Anwendung
- Relevanz des Modells für den pädagogischen Kontext
- Untersuchung von Kommunikationsbeispielen aus dem Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kommunikationsstörungen ein und veranschaulicht deren Relevanz anhand eines Beispiels aus Loriots „Das Ei“. Sie erläutert die Bedeutung von Kommunikationsverständnis für Lehrkräfte und stellt Paul Watzlawicks axiomatischen Ansatz vor. Der Text definiert den Begriff „Kommunikation“ anhand verschiedener Merkmale und hebt die Bedeutung von Metakommunikation für gelingende Kommunikation hervor. Die Arbeit gliedert sich nach den fünf Axiomen Watzlawicks, wobei jedes Axiom beschrieben, mit zugehörigen Kommunikationsstörungen in Verbindung gebracht und kritisch beleuchtet wird.
Schematische Auseinandersetzung mit den Axiomen Watzlawicks: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Watzlawicks Axiome. Es betont den provisorischen Charakter der Axiome und ihre praktische Nützlichkeit. Es werden die einzelnen Axiome nicht im Detail behandelt, sondern als Grundlage für die folgende Analyse der Axiome und Störungen eingeführt. Der Fokus liegt darauf, den Rahmen für die detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Axiomen und ihren Störungen in den nachfolgenden Kapiteln zu legen.
Erstes Axiom: Über die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren: Dieses Kapitel beschreibt das erste Axiom Watzlawicks, wonach man nicht nicht kommunizieren kann. Jedes Verhalten, auch Nichthandeln oder Schweigen, wird als Kommunikation interpretiert. Anhand des Beispiels von zwei Personen, wobei eine Person versucht, einem Kollegen zu helfen der schweigt, wird veranschaulicht, dass auch Schweigen eine Botschaft übermittelt. Das Axiom wird durch den Loriots Sketch „Das Ei“ veranschaulicht.
Störungen: Dieses Kapitel analysiert Kommunikationsstörungen, die im Zusammenhang mit dem ersten Axiom auftreten. Es werden verschiedene Reaktionen auf Kommunikationsversuche beschrieben: Abweisung, Annahme, Entwertung und Symptom. Der Loriots Sketch wird analysiert und die Reaktionen der Frau werden im Kontext der vier Reaktionen eingeordnet.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Kommunikationsstörungen, Paul Watzlawick, Axiome, Metakommunikation, Inhaltsaspekt, Beziehungsaspekt, Interpunktion, digitale und analoge Modalitäten, symmetrische und komplementäre Kommunikation, Konflikt, Schulalltag, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der fünf Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die fünf Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick und untersucht, wie diese im Kontext von Kommunikationsstörungen, insbesondere im schulischen Alltag, relevant sind. Die Arbeit beschreibt das Modell, hinterfragt es kritisch und stützt sich auf die Originalliteratur Watzlawicks und relevante Sekundärliteratur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Beschreibung der fünf Axiome, eine Analyse von Kommunikationsstörungen im Kontext der Axiome, eine kritische Auseinandersetzung mit den Axiomen und ihrer Anwendung, die Relevanz des Modells für die Pädagogik und die Untersuchung von Kommunikationsbeispielen aus dem Alltag. Der Loriots Sketch "Das Ei" dient als illustratives Beispiel.
Welche Axiome werden untersucht?
Die Arbeit untersucht alle fünf Axiome von Watzlawick: 1. Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren; 2. Der Inhalts- und Beziehungsaspekt der Kommunikation; 3. Die Interpunktion von Kommunikationsabläufen; 4. Digitale und analoge Kommunikationsmodalitäten; 5. Symmetrische und komplementäre Kommunikationsabläufe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die das Thema einführt und die Relevanz von Kommunikationsverständnis für Lehrkräfte herausstellt. Es folgt eine schematische Auseinandersetzung mit den Axiomen, bevor jedes Axiom einzeln detailliert beschrieben und auf mögliche Kommunikationsstörungen untersucht wird. Ein Fazit und ein Literaturverzeichnis schließen die Arbeit ab.
Welche Kommunikationsstörungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Kommunikationsstörungen im Zusammenhang mit den Axiomen, insbesondere Reaktionen auf Kommunikationsversuche wie Abweisung, Annahme, Entwertung und Symptom. Diese werden anhand von Beispielen und unter Bezugnahme auf den Loriots Sketch "Das Ei" illustriert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kommunikation, Kommunikationsstörungen, Paul Watzlawick, Axiome, Metakommunikation, Inhaltsaspekt, Beziehungsaspekt, Interpunktion, digitale und analoge Modalitäten, symmetrische und komplementäre Kommunikation, Konflikt, Schulalltag, Pädagogik.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Originalliteratur von Paul Watzlawick und relevanter Sekundärliteratur. Die genauen Quellenangaben finden sich im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit.
Welche praktische Relevanz hat die Arbeit?
Die Arbeit ist besonders relevant für Pädagogen und alle, die sich mit Kommunikation und Kommunikationsstörungen im schulischen und beruflichen Kontext befassen. Sie bietet ein tiefergehendes Verständnis für die Dynamik von Kommunikation und deren Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen.
Wie wird das erste Axiom erläutert?
Das erste Axiom, "Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren", wird erklärt, indem gezeigt wird, dass jedes Verhalten, einschließlich Schweigen und Nichthandeln, als Kommunikation interpretiert werden kann und eine Botschaft übermittelt. Der Loriots Sketch dient als anschauliches Beispiel für diese These.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Kommunikation und ihre Störungen nach einem Ansatz von Paul Watzlawik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1334479