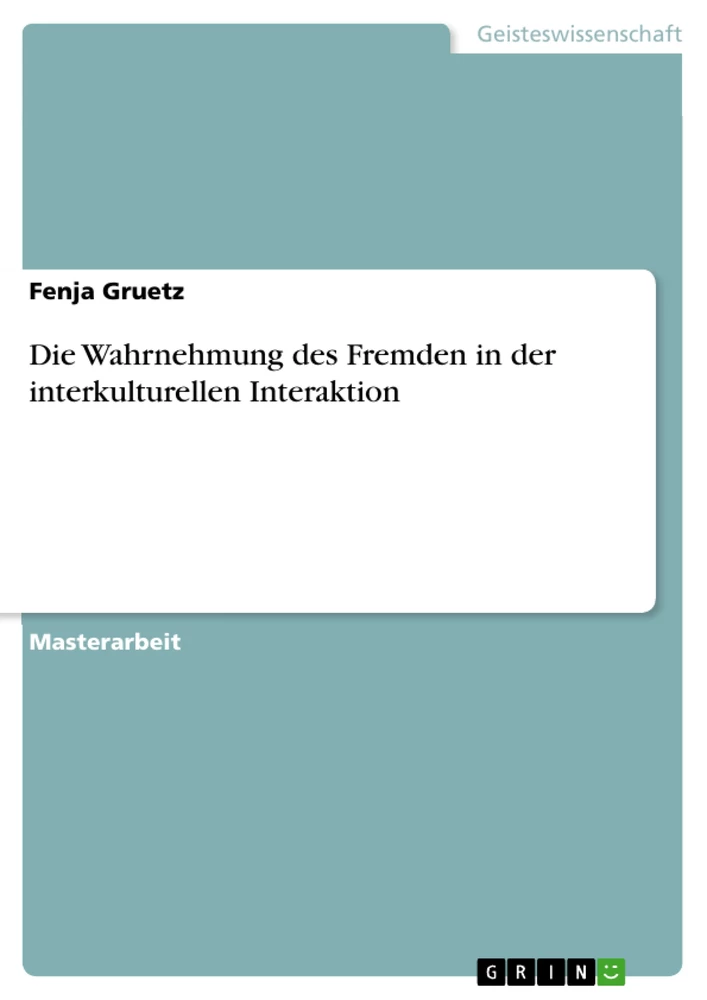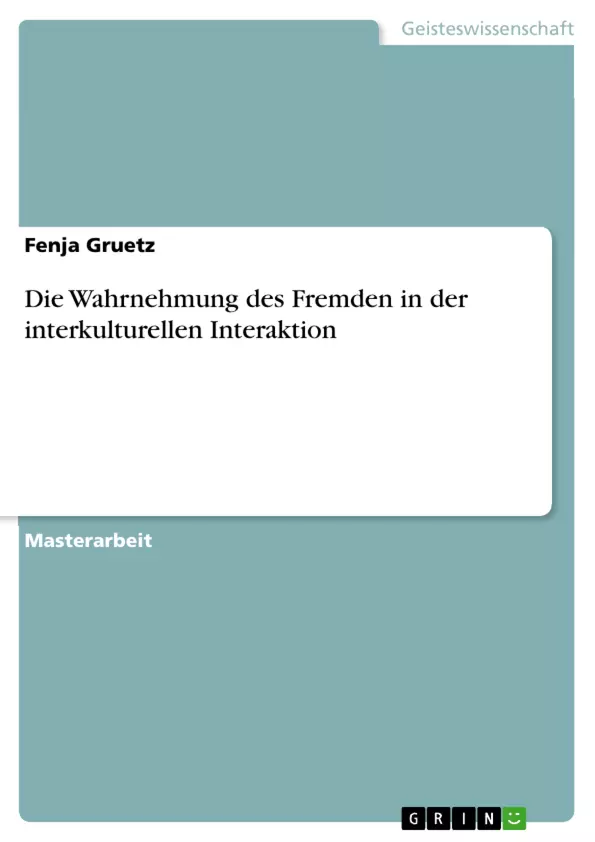Die Forschungsthese der vorliegenden Arbeit lautet: Je mehr Kontakt zu Angehörigen von Fremdgruppen besteht, desto weniger Stereotype und Vorurteile werden vertreten.
Im Laufe der Arbeit wird die These durch eine schriftliche Befragung empirisch untersucht. Sie stützt sich auf die Kontakthypothese von Gordon Willard Allport, der als Begründer der Persönlichkeitspsychologie gilt und an der Harvard University lehrte. Im Kontext der Begegnung mit Fremdheit sollen auch Stereotype thematisiert werden. Im Alltag findet eine Auseinandersetzung mit fremden Personen und Inhalten fremder Kulturen statt, die zu Problemen bezüglich des gegenseitigen Verständnisses und der kulturellen Verständigung führen kann. Welche Prozesse die Konfrontation mit Fremden auslösen und welche gesellschaftlichen Konsequenzen die Begegnungen haben, ist relevant für die Interaktion zwischen Kulturen.
Wer oder was als der, die oder das Fremde gilt, stellt ein sehr vielschichtiges und komplexes Thema dar. Fremdheit an sich ist ein sehr umfangreiches Thema, doch aus kulturwissenschaftlicher Perspektive steht sie vor allem mit dem Ethnozentrismus in Verbindung. Daher wird das Fremde im Zusammenhang der Arbeit als der „Fremde im eigenen Land“ definiert. Der Fremde erscheint als ein Individuum, das aufgrund seiner Angehörigkeit einer Fremdgruppe und der äußeren Erscheinung als anders beziehungsweise fremd eingeordnet wird. Als Kriterium gilt hierbei die angenommene Nicht-Zugehörigkeit zur eigenen Kultur. Diese abwehrende Haltung resultiert häufig aus der Angst vor dem Unbekannten, der in der interkulturellen Interaktion eine bedeutsame Rolle zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der, die, das Fremde
- Definition des Fremden
- Begriffsbestimmung: Die Fremdheit
- Wer oder was ist „der, die, das Fremde“?
- Das Eigene und das Fremde
- Identität
- Personale, soziale und kulturelle Identität
- Theorie der sozialen Identität …...
- Interkulturelle Interaktion mit dem Fremden
- Die Wahrnehmung des Fremden
- Wahrnehmungsmuster
- Abwehr versus Exotismus
- Interaktion mit kulturell Fremden....
- „Der Stachel des Fremden“ versus „Verstehen, Kritik, Anerkennung“
- Voraussetzungen für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation
- Die Kontakthypothese.....
- Die Kontakthypothese nach Gordon W. Allport
- Weiterentwicklung und Studien zur Kontakthypothese
- Stereotype
- Begriffsbestimmung: Das Stereotyp
- Definition und Abgrenzung
- Entstehung von Stereotypen
- Wirkungen von Stereotypen.....
- Automatische Aktivierung versus kontrollierte Regulierung
- Verzerrungseffekte
- Stigmatisierung
- Empirischer Teil
- Untersuchungsmethode
- Forschungsfrage.....
- Forschungsmethode
- Datenerhebung....
- Fragebogenkonstruktion...
- Erläuterung der Aussagen
- Durchführung der Befragung
- Datenauswertung
- Ergebnisse der Befragung
- Ergebnisse nach Migrationshintergrund
- Ergebnisse nach Kontakt......
- Ergebnisse der Mitarbeiter
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Wahrnehmung und Stereotypisierung von Fremden und untersucht in diesem Kontext den Zusammenhang zwischen Kontakt zu Fremden und deren Wahrnehmung. Sie analysiert, wie die eigene selektive Wahrnehmung, häufig unbewusst, die Verbreitung von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Fremden begünstigt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Forschungsfrage „Je mehr Kontakt zu Angehörigen von Fremdgruppen besteht, desto weniger Stereotype und Vorurteile werden vertreten“ empirisch zu untersuchen.
- Die Definition von Fremdheit und die Analyse der eigenen und fremden Identität
- Die Bedeutung der Interkulturellen Interaktion und die Herausforderungen in der Kommunikation mit kulturell Fremden
- Die Entstehung und Wirkung von Stereotypen sowie deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Fremdgruppen
- Die Kontakthypothese von Gordon W. Allport und deren Relevanz für die Reduzierung von Stereotypen und Vorurteilen
- Die empirische Untersuchung der Forschungsfrage mithilfe einer schriftlichen Befragung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition des Fremden und analysiert die Entstehung von Fremdheit im Kontext der eigenen und fremden Identität. Kapitel 3 beleuchtet die Herausforderungen der interkulturellen Interaktion und untersucht die Bedeutung der Wahrnehmung und des Kontakts mit kulturell Fremden. Kapitel 4 beleuchtet die Entstehung und Wirkung von Stereotypen und analysiert deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Fremdgruppen. Das Kapitel "Empirischer Teil" stellt die Methodik der Untersuchung und die Ergebnisse der Befragung dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Fremdheit, interkulturelle Interaktion, Stereotype, Vorurteile, Kontakthypothese, empirische Forschung, Befragung und Migrationshintergrund. Sie analysiert, wie die eigene selektive Wahrnehmung die Verbreitung von Stereotypen gegenüber Fremden beeinflusst und untersucht den Zusammenhang zwischen Kontakt zu Fremden und deren Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Kontakthypothese von Allport?
Sie besagt, dass Vorurteile und Stereotype gegenüber Fremdgruppen abgebaut werden, je mehr positiver Kontakt zwischen den Gruppen besteht.
Wie entstehen Stereotype über "das Fremde"?
Stereotype entstehen oft durch selektive Wahrnehmung und die Angst vor dem Unbekannten, um Komplexität zu reduzieren und die eigene Gruppe abzugrenzen.
Was ist der Unterschied zwischen Abwehr und Exotismus?
Abwehr ist die feindselige Ablehnung des Fremden, während Exotismus das Fremde oberflächlich bewundert und romantisiert, ohne es wirklich als gleichwertig anzuerkennen.
Was versteht man unter kultureller Identität?
Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, das durch die Abgrenzung zum "Anderen" oder "Fremden" oft erst scharf definiert wird.
Welche Voraussetzungen müssen für erfolgreiche interkulturelle Kommunikation erfüllt sein?
Notwendig sind die Reflexion eigener Vorurteile, Empathie, Anerkennung von Differenz und die bewusste Regulierung automatischer Stereotyp-Aktivierungen.
- Citar trabajo
- Master Fenja Gruetz (Autor), 2020, Die Wahrnehmung des Fremden in der interkulturellen Interaktion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1334913