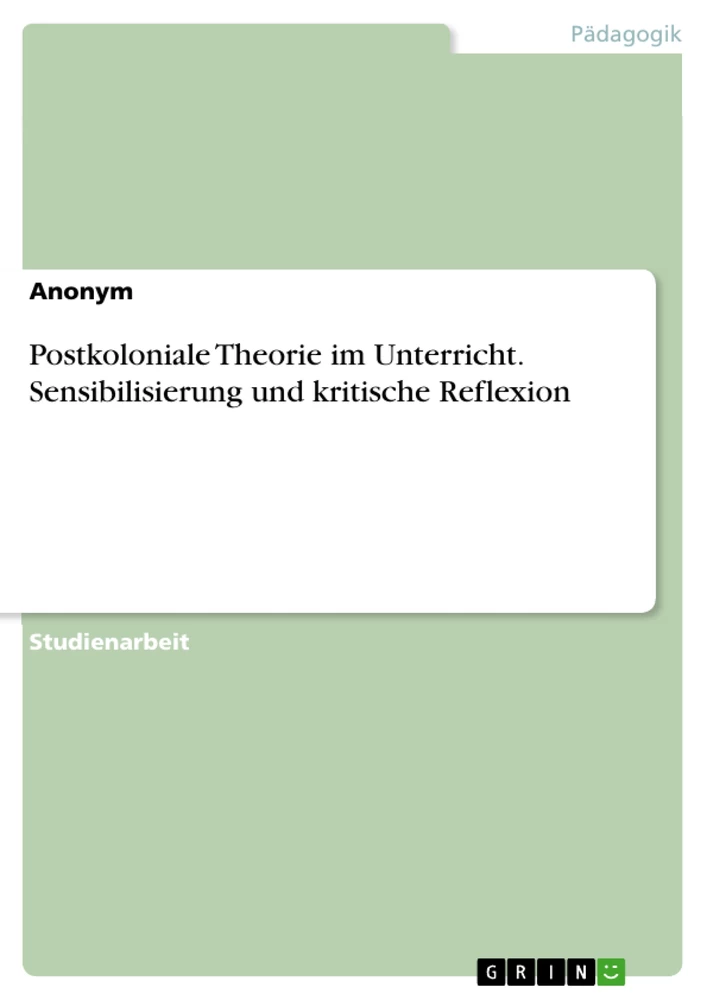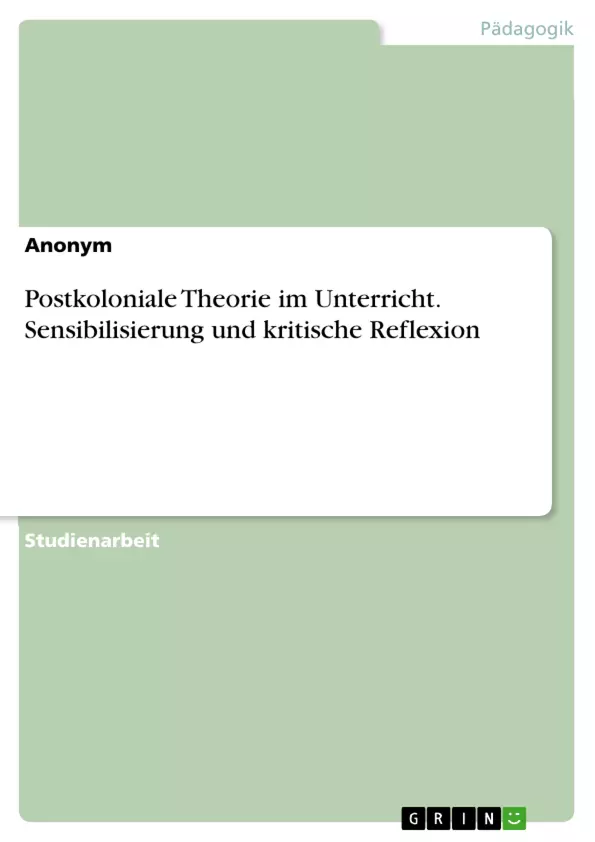Die Fragestellung dieser Arbeit lautet, wie man postkoloniale Theorie beziehungsweise den Postkolonialismus unterrichtstauglich machen kann. Die Arbeit hat demzufolge eine unterrichtspraktische Konkretion als übergeordnetes Ziel. Sie folgt dabei der Hypothese, dass die SuS durch die Auseinandersetzung mit postkolonialer Theorie dazu befähigt werden, das eigene Involviertsein kritisch zu reflektieren.
„Wir sollten politische Bildung auf den Boden der politischen Philosophie zurückholen.“ Dies forderte Micha Brumlik bereits im Jahr 1997. Man könnte annehmen, dass seitdem viel passiert ist. Die Forderung jährt sich schließlich zum 25. Mal. Doch die Annahme ist trügerisch, wie das Beispiel des Postkolonialismus zeigt. So haben sich zwar postkoloniale Theorien und Forschungsansätze in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen wie etwa der Literaturwissenschaft etabliert, die Politikwissenschaft bildet jedoch eine Ausnahme im negativen Sinne. Die Rezeption jener Theorien und Ansätze erfolgt nur vereinzelt und äußerst langsam. Dies schlägt sich in der Konsequenz auch in den Debatten um eine angemessene und aktuelle politische Bildung nieder, bei denen postkoloniale Ansätze allenfalls durch ihre Abwesenheit auffallen.
Diese Arbeit knüpft an diesem Sachverhalt an und versucht, jenes Theoriedefizit zu mindern und der genannten Abwesenheit entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorüberlegungen
- Begriffsklärung
- Politische Theorie als Unterrichtsgegenstand
- Mbembes postkoloniale Theorie
- Umsetzung im Politikunterricht
- Postkoloniale Perspektive im Unterricht
- Mbembe im Unterricht - Gedanken zur Umsetzung an Berufsschulen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Relevanz der postkolonialen Theorie für den Politikunterricht und erörtert Möglichkeiten ihrer Umsetzung im Unterricht. Die Arbeit argumentiert, dass die Einbeziehung einer postkolonialen Perspektive im Unterricht dazu beitragen kann, das eigene Involviertsein kritisch zu reflektieren und ein tieferes Verständnis für globale Zusammenhänge zu entwickeln.
- Die Bedeutung der postkolonialen Theorie für die politische Bildung
- Die Herausforderungen der Rezeption postkolonialer Theorien in der Politikwissenschaft
- Die Einbeziehung postkolonialer Ansätze im Politikunterricht
- Die Konkretisierung der postkolonialen Theorie im Unterricht
- Die Rolle von Ethnozentrismus und Nanorassismus in Mbembes postkolonialer Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die mangelnde Rezeption postkolonialer Theorien in der Politikwissenschaft und argumentiert für deren Einbeziehung im Politikunterricht. Das zweite Kapitel definiert zentrale Begriffe, wie „politische Theorie“ und „Ethnozentrismus“, und erörtert deren Relevanz für die Arbeit. Kapitel drei präsentiert Mbembes postkoloniale Theorie und fokussiert dabei auf die Konzepte des Ethnozentrismus und Nanorassismus. Kapitel vier beschäftigt sich mit der Umsetzung der postkolonialen Theorie im Politikunterricht und beleuchtet die Bedeutung einer postkolonialen Perspektive im Unterricht sowie die praktische Umsetzung von Mbembes Ideen an Berufsschulen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der postkolonialen Theorie im Politikunterricht. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Rezeption postkolonialer Theorien in der Politikwissenschaft und erörtert die Relevanz von Begriffen wie Ethnozentrismus und Nanorassismus in diesem Kontext. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der postkolonialen Theorie von Achille Mbembe und dessen Werk „Politik der Feindschaft“. Zentrale Themen sind die Einbeziehung einer postkolonialen Perspektive im Unterricht, die Entwicklung unterrichtspraktischer Konkretionen und die kritische Reflexion des eigenen Involviertseins in globalen Machtverhältnissen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Postkoloniale Theorie im Unterricht. Sensibilisierung und kritische Reflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335426