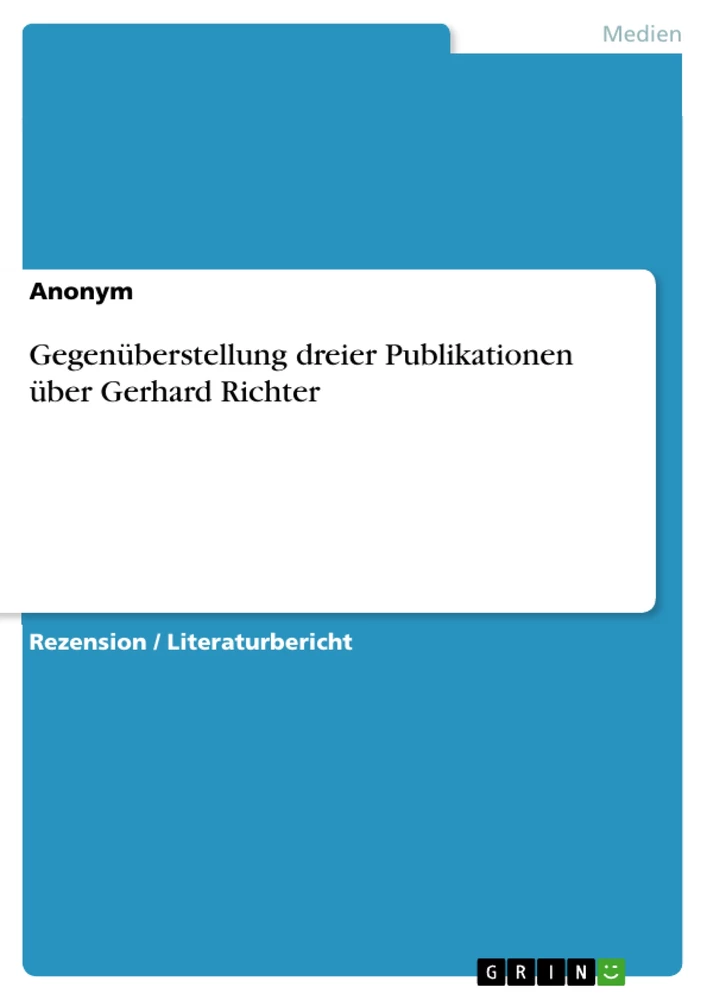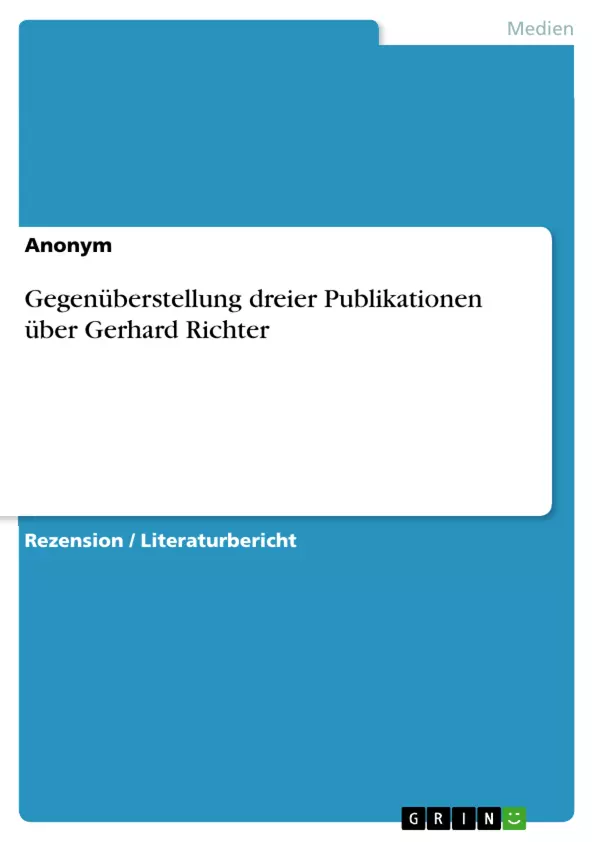„Was ist Malerei in Richters Werk?“ – Das 1985 erschienene Schriftwerk behandelt diese und weitere Fragen um das (Lebens-) Werk des 1932 in Dresden geborenen Künstlers Gerhard Richter.
Es ist ein 127-seitiges Buch mit dem einprägsamen Titel „Gerhard Richter“. Eingeteilt ist es im Wesentlichen in zwei unterschiedlich lange Abschnitte: „Die Figur des Werkes“ und „Das Ereignis des Bildes“. Zu finden ist außerdem ein dritter Punkt: die „biographischen Notizen“. „Die Figur des Werkes“ wird mit drei Zitaten eingeleitet, unter anderem mit einem von Aristoteles. Der Autor, in diesem Abschnitt Denys Zacharopoulos, versucht in den folgenden Seiten die Konstitution des Werkes zu erörtern und immerzu die Frage zu stellen, was denn Malerei in Richters Werk sei. Hierzu legt er dem Leser zunächst nah, wie das Wort „Werk“ zu fassen sei und vermeidet es explizit, das Werk als eine Abfolge seiner Teile zu betrachten wie auch als eine „historisch eingeteilte Reihenfolge künstlerischer Entwicklungen“.
Fragen dominieren das geschriebene Wort: Wann ist ein Werk ein Werk? Sind Werke in Zusammenarbeit oder durch Aneignung von Themen Teile des Gesamtwerks (genannt wird Tizians „Verkündigung“)?
Inhaltsverzeichnis
- Die Figur des Werkes
- Das Ereignis des Bildes
- biographische Notizen
- Richters Arbeiten und Techniken seit den 60ger Jahren
- Einstellungen zu den Massenmedien und das Verhältnis zu vorherigen und späteren Werken anderer zeitgenössischer Künstler
- Rolle und Merkmale des Zyklus' mit einer Überleitung zur historischen Perspektive von Erinnerungsarbeit/en in der Kunst
- Die Lebensgeschichte der Tante Gerhard Richters, Marianne Schoenfelder, und die seines ehemaligen Schwiegervaters, des Frauenarztes und Direktors der Dresdener Frauenklinik Friedrichstadt, Dr. Heinrich Eufinger.
- Stationen aus Richters Vergangenheit - nicht immer chronologisch - aus historischen Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die drei Publikationen beschäftigen sich mit dem Werk des Künstlers Gerhard Richter und betrachten verschiedene Aspekte seines Schaffens aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Autoren beleuchten Richters Bildsprache, die Rolle der Fotografie in seinem Werk, den Einfluss historischer Ereignisse und die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft. Die Werke bieten Einblicke in Richters künstlerische Entwicklung und seine Auseinandersetzung mit den Themen Krieg, Erinnerung, und Identität.
- Die Rolle der Fotografie in Richters Werk
- Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Auswirkungen auf Richters Kunst
- Die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft
- Die Bedeutung von Erinnerung und Identität in Richters Bildern
- Die Analyse der künstlerischen Techniken und Methoden Richters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Figur des Werkes
In diesem Kapitel analysiert Denys Zacharopoulos die Konstitution von Richters Werk. Er stellt die Frage, was Malerei in Richters Werk bedeutet und untersucht die Beziehung zwischen Werk und Künstler. Dabei werden Aspekte wie der Einfluss von anderen Künstlern, die Bedeutung von Abstraktion und die Rolle von Photobildern in Richters Schaffen erörtert.
Das Ereignis des Bildes
Der Autor Ulrich Loock konzentriert sich in diesem Kapitel auf die Analyse des Bildes „Janus“ und untersucht die Legitimation des Begriffs „abstrakt“ in Bezug auf Richters Werk. Er betrachtet das Bild aus verschiedenen Perspektiven, darunter Technik, Farbigkeit und mögliche ideologische Komponenten. Die Rolle von Vorbildern und Ölskizzen in Richters Arbeit wird ebenfalls diskutiert.
Richters Arbeiten und Techniken seit den 60ger Jahren
Kai-Uwe Hemken beleuchtet in diesem Kapitel Richters Arbeiten und Techniken ab den 1960er Jahren. Er untersucht die Entwicklung von Richters „Archiv der visuellen Kultur“, den Atlas, sowie seine Fotomalerei. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Richters Bilderzyklus „18. Oktober 1977“ und seiner Auseinandersetzung mit den Themen Terrorismus und Erinnerung.
Einstellungen zu den Massenmedien und das Verhältnis zu vorherigen und späteren Werken anderer zeitgenössischer Künstler
In diesem Kapitel setzt sich Hemken mit Richters Einstellungen zu den Massenmedien auseinander und untersucht, wie sich diese auf seine Kunst auswirken. Er vergleicht Richters Werk mit dem anderer zeitgenössischer Künstler wie Joseph Beuys, Arnulf Rainer oder Katherina Sieverding und beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren künstlerischen Ansätzen.
Die Lebensgeschichte der Tante Gerhard Richters, Marianne Schoenfelder, und die seines ehemaligen Schwiegervaters, des Frauenarztes und Direktors der Dresdener Frauenklinik Friedrichstadt, Dr. Heinrich Eufinger.
Juergen Schreiber beleuchtet in diesem Kapitel die Lebensgeschichten von Marianne Schoenfelder und Dr. Heinrich Eufinger, zwei wichtigen Personen in Richters Leben. Er zeigt auf, wie die traumatischen Ereignisse der Vergangenheit Richters künstlerisches Schaffen beeinflusst haben. Die Parallelen zwischen den Biografien der beiden Personen und dem Werk des Künstlers werden hervorgehoben. Die Rolle von Richters „Atlas“ und seine Verwendung von Fotografien als Ausgangsmaterial werden in Bezug auf die Lebensgeschichten der beiden Personen beleuchtet.
Stationen aus Richters Vergangenheit - nicht immer chronologisch - aus historischen Perspektiven
In diesem Kapitel werden Stationen aus Richters Vergangenheit aus historischer Perspektive betrachtet. Die Biografie des Künstlers wird in den Kontext der Zeit des Nationalsozialismus, der Nachkriegszeit und der Teilung Deutschlands eingeordnet. Schreiber beschreibt die politische und gesellschaftliche Situation, in der Richter aufgewachsen ist, und beleuchtet die Auswirkungen dieser Ereignisse auf seine künstlerische Entwicklung. Es werden außerdem die Beziehungen zu seiner Familie, seinen Freunden und seinen Weg in den Westen beschrieben.
Schlüsselwörter
Die drei Publikationen beleuchten verschiedene Facetten des Werkes von Gerhard Richter. Zentrale Themen sind die Rolle der Fotografie in seiner Kunst, die Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Auswirkungen auf seine Werke, die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft und die Bedeutung von Erinnerung und Identität. Die Analysen der einzelnen Werke fokussieren auf die künstlerischen Techniken und Methoden Richters, seine Bildsprache und die Interpretation seiner Werke im Kontext der Zeitgeschichte. Wichtige Schlüsselbegriffe sind Fotomalerei, Abstraktion, Erinnerung, Geschichte, Identität, Gesellschaft, künstlerische Technik, Bildsprache und Interpretation. Die Arbeiten zitieren prominente Denker wie Aristoteles, Benjamin, Bordieu und Cézanne, die wichtige Erkenntnisse über Kunst und Gesellschaft liefern.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Fotografie im Werk von Gerhard Richter?
Fotografien dienen Richter oft als Vorlage für seine Malerei (Fotorealismus). Er nutzt sie, um Distanz zum Motiv zu schaffen und die Grenze zwischen Realität und Abbild zu hinterfragen.
Was ist Richters "Atlas"?
Der "Atlas" ist eine monumentale Sammlung von Fotos, Skizzen und Zeitungsausschnitten, die Richter über Jahrzehnte gesammelt hat und die als visuelles Archiv und Inspirationsquelle für seine Werke dient.
Wie setzt sich Richter mit der deutschen Geschichte auseinander?
In Zyklen wie "18. Oktober 1977" (über die RAF) oder durch die Verarbeitung familiärer Traumata aus der NS-Zeit thematisiert er Erinnerung, Schuld und das kollektive Gedächtnis.
Was bedeutet "Abstraktion" in Richters Schaffen?
Richter wechselt oft zwischen fotorealistischen und abstrakten Werken. Für ihn ist Abstraktion eine Methode, das Unaussprechliche sichtbar zu machen, ohne es konkret abzubilden.
Warum ist die Biografie von Marianne Schönfelder für sein Werk relevant?
Marianne Schönfelder war Richters Tante, die Opfer der NS-Euthanasie wurde. Ihre Geschichte und die Verbindung zu seinem Schwiegervater (einem NS-Arzt) prägten seine Auseinandersetzung mit Täterschaft und Opfern.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2008, Gegenüberstellung dreier Publikationen über Gerhard Richter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335512