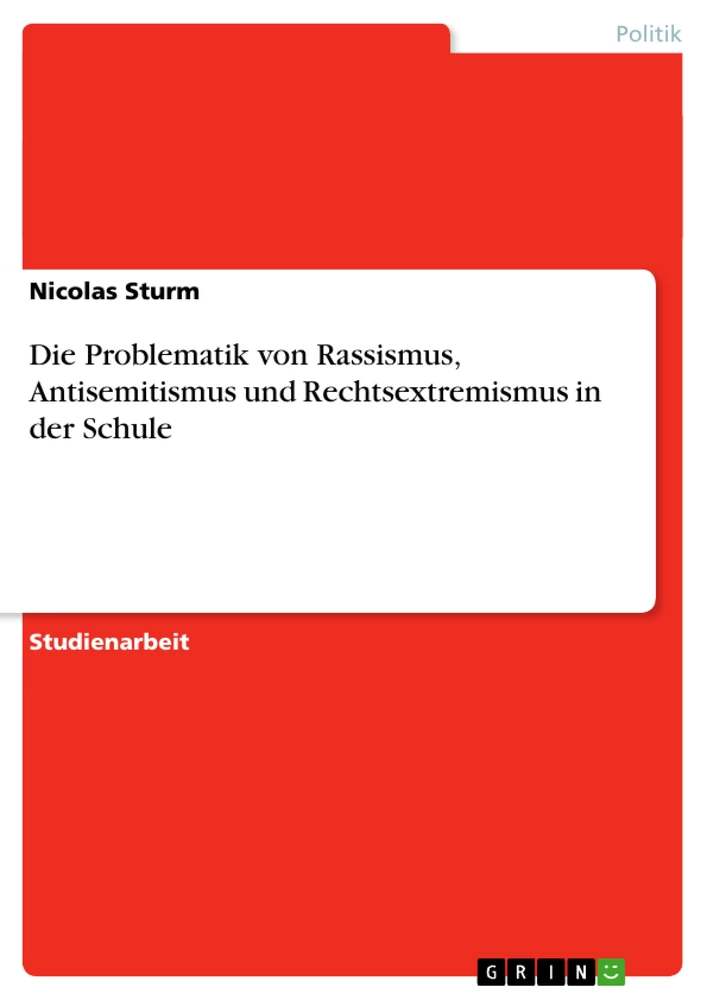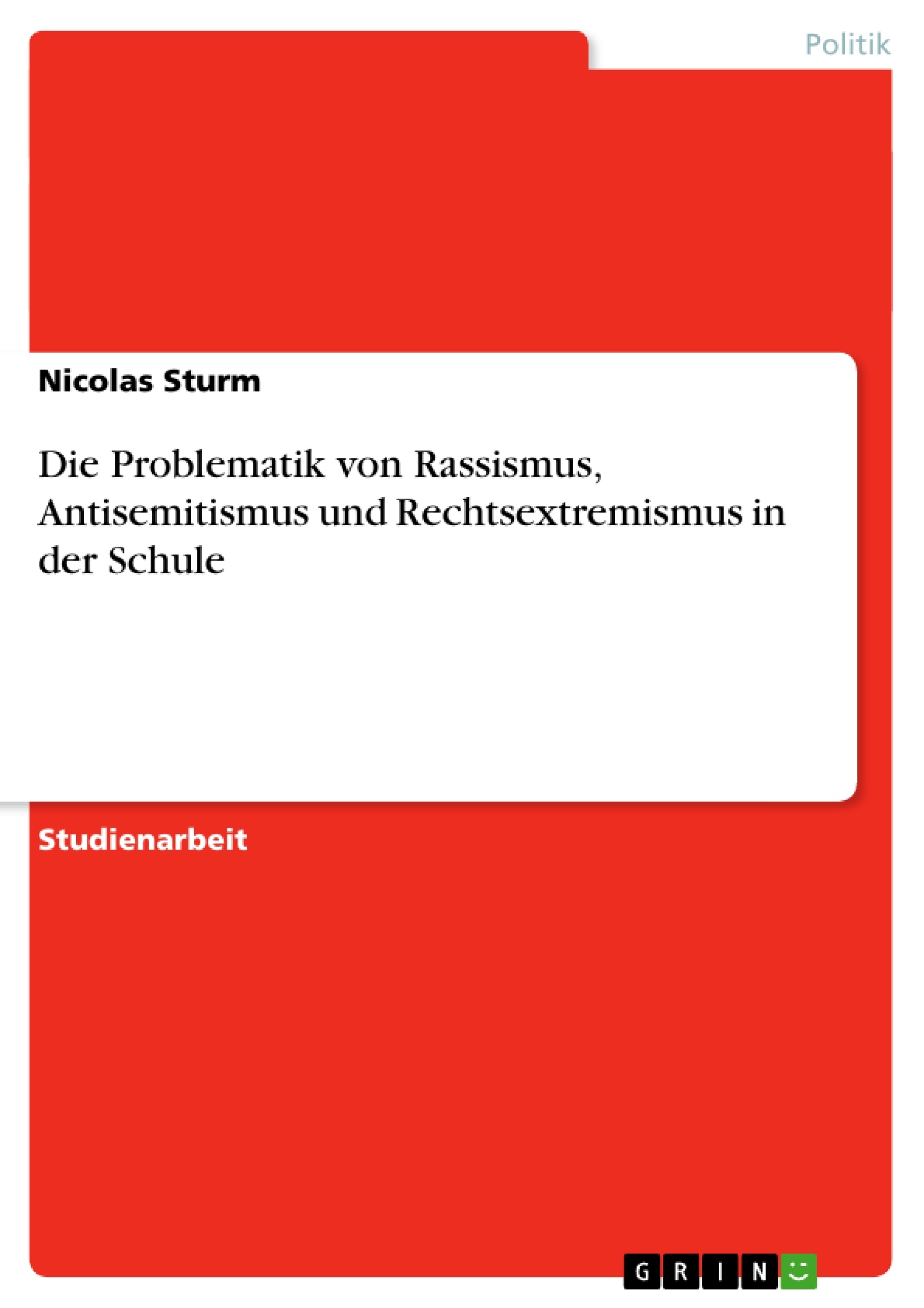Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus sind auch im 21. Jahrhundert weiterhin relevante gesellschaftliche Themen, die in unterschiedlicher Weise auf die Institution Schule einwirken. Kinder und Jugendliche haben in aller Regel bereits aktiv oder passiv Ausgrenzungserfahrungen gemacht und die Schule ist zu einem großen Teil dafür verantwortlich, den Kindern und Jugendlichen Informationen zu Rassismis, Antisemitismus und Rechtsextemismus zur Verfügung zu stellen und sie für die Themen zu sensibilisieren.
Öffentlich wird vielfach die Meinung vertreten, eine Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust sei für Schülerinnen und Schüler ausreichend, um sie für die Problematik zu sensibilisieren. Genau diese Art der Herangehensweise wird aber mittlerweile in der Literatur als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet. In Abschnitt vier der Arbeit werden deshalb dazu alternative Konzepte vorgestellt.
Auch Lehrerinnen und Lehrer scheinen den Herausforderungen der Thematisierung von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Schule nicht immer gewachsen zu sein. So wurden laut einer Studie latent und teilweise auch manifest antisemitische Schüleransichten von einer Lehrerin nicht als problematisch angesehen. Dieser Punkt zeigt einmal mehr, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Problematik von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Schule für Lehrerinnen und Lehrer vonnöten ist.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daran anlehnend mit dieser Fragestellung. Zunächst werden in Abschnitt zwei die drei Begriffe Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus erläutert, Abschnitt drei legt dann den Schwerpunkt auf Schüleransichten zu den drei Bereichen, bevor in Abschnitt vier die sich daraus ergebenden Probleme und Herausforderungen der Themen im Schulunterricht thematisiert werden und in Abschnitt fünf ein Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Rassismus / Antisemitismus / Rechtsextremismus?
- Schüleransichten zu Rassismus I Antisemitismus I Rechtsextremismus
- Probleme und Herausforderungen der Themen im Schulunterricht
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Problematik von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Schule zu beleuchten. Sie untersucht die Verbreitung und die Ursachen dieser Phänomene und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für den Schulunterricht daraus ergeben.
- Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus als gesellschaftliche Probleme
- Schüleransichten und Einstellungen zu den genannten Themen
- Herausforderungen für den Schulunterricht
- Mögliche Lösungsansätze und Konzepte
- Die Bedeutung des interkulturellen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt in das Thema ein und verdeutlicht die Relevanz von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus als gesellschaftliche Probleme. Sie beleuchtet die Verantwortung der Schule, die Schülerinnen und Schüler für diese Themen zu sensibilisieren.
-
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus definiert und unterschiedliche Formen dieser Erscheinungen erläutert. Es wird auf den individuellen Alltagsrassismus, den institutionellen Rassismus sowie den intellektuellen Rassismus eingegangen. Des Weiteren werden die verschiedenen Formen des Antisemitismus, wie z.B. der Antizionismus, beleuchtet.
-
Kapitel drei analysiert Schüleransichten und Einstellungen zu Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Es werden die Ergebnisse von Studien vorgestellt, die beleuchten, wie Jugendliche mit diesen Themen umgehen und welche Stereotype und Vorurteile verbreitet sind. Die Bedeutung des Nahostkonflikts und der Rolle des Staates Israel in den Schülerdiskussionen wird hervorgehoben.
-
Das vierte Kapitel widmet sich den Problemen und Herausforderungen, die sich aus der Thematisierung von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus im Schulunterricht ergeben. Es wird auf das Phänomen der inneren Resonanz bei Lehrkräften eingegangen und verschiedene problematische Argumentationen von Pädagogen beleuchtet. Des Weiteren werden mögliche Lösungsansätze, wie z.B. das Konzept des interkulturellen Lernens, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus, Schule, Schulunterricht, Schüleransichten, interkulturelles Lernen, Bildung, Gesellschaft, Globalisierung, Migration, Nahostkonflikt, Holocaust, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Schule bei der Prävention von Rechtsextremismus?
Die Schule ist zentral dafür verantwortlich, Schülern Informationen bereitzustellen, sie zu sensibilisieren und Ausgrenzungserfahrungen entgegenzuwirken.
Ist die reine Holocaust-Erziehung heute noch ausreichend?
Die Arbeit zeigt auf, dass eine ausschließliche Fokussierung auf den Holocaust als nicht mehr zeitgemäß gilt und durch moderne Konzepte wie interkulturelles Lernen ergänzt werden muss.
Welche Formen von Antisemitismus treten bei Schülern auf?
Neben manifestem Antisemitismus spielen oft latente Vorurteile und eine Vermischung mit dem Nahostkonflikt (Antizionismus) eine große Rolle.
Vor welchen Herausforderungen stehen Lehrer bei diesen Themen?
Lehrer sind oft nicht ausreichend geschult, erkennen antisemitische Ansichten teilweise nicht als problematisch oder kämpfen mit eigener "innerer Resonanz".
Was bedeutet "institutioneller Rassismus" in der Schule?
Es bezieht sich auf Strukturen innerhalb des Bildungssystems, die bestimmte Gruppen benachteiligen, unabhängig von der individuellen Einstellung der Lehrkräfte.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B.A.) Nicolas Sturm (Author), 2008, Die Problematik von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133565