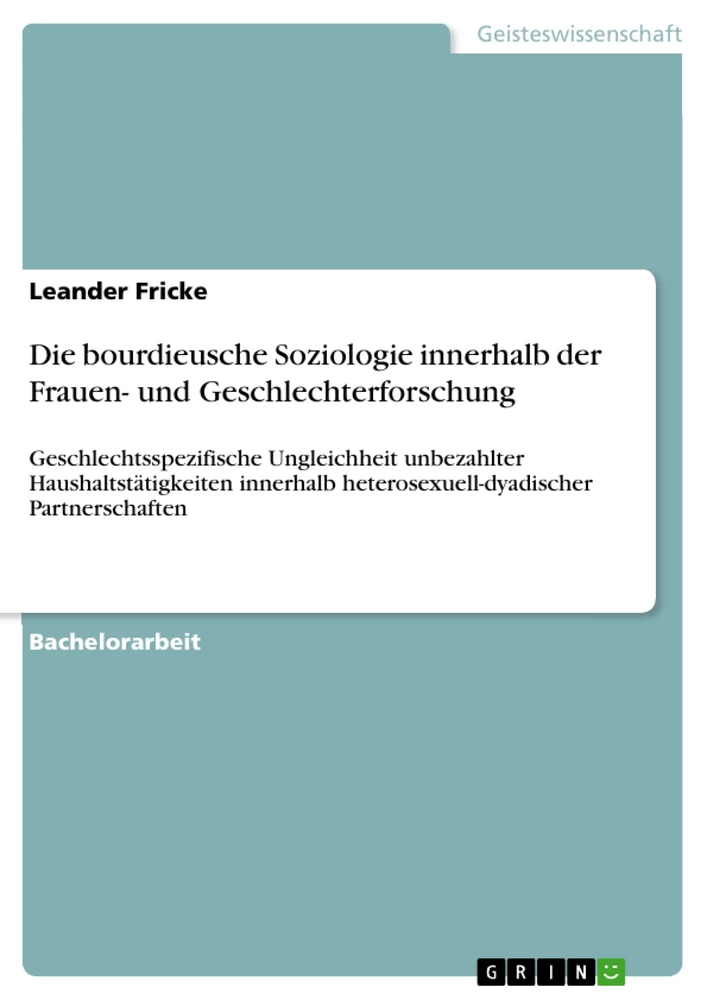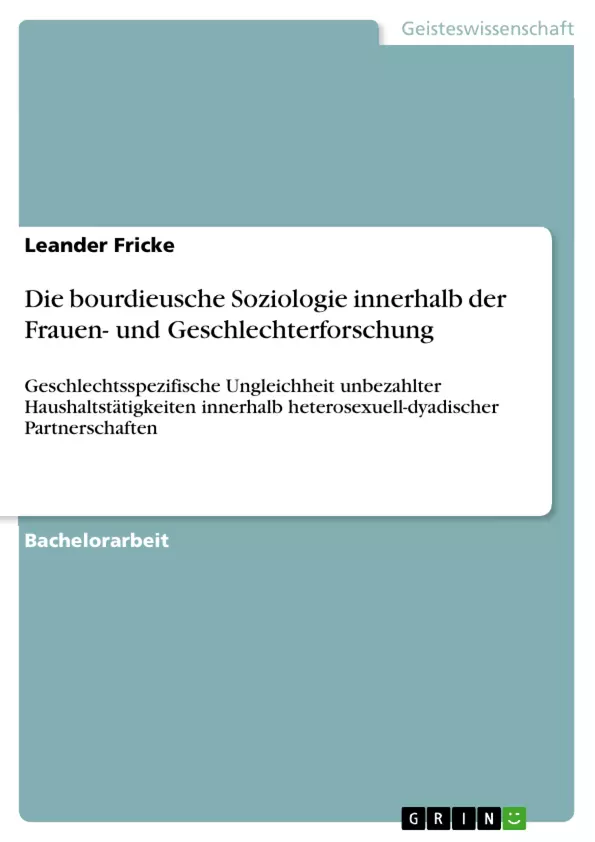Pierre Bourdieu gilt als einer der einflussreichsten Soziologen und Sozialphilosophen des 20. Jahrhunderts. Im Zentrum des Soziologen standen seit jeher Fragen nach den gesellschaftlichen Reproduktionsmechanismen sozialer Hierarchien. Und so lässt sich Bourdieus Soziologie auch als eine eminent politische, herrschaftskritische Soziologie begreifen.
Soziologie als Instrument gegen die „Mystifizierungen von Herrschaftsverhältnissen“ als Teil eines politischen Kampfes um eine gerechtere Einrichtung der Gesellschaft. Die emanzipatorische Wahlverwandtschaft zur Frauen- und Geschlechterforschung, die als Wissenschaft in politischer Absicht die sozialwissenschaftliche Bühne betreten hat, macht hier jedoch nicht halt.
So ist Bourdieu einer der wenigen Soziologen, der sich mit seinem Spätwerk „Die männliche Herrschaft“ (2005) in die Geschlechterdiskussion eingebracht hat. Seine Ausführungen zur Geschlechterordnung in modernen Gesellschaften wurden jedoch nur selten rezipiert und eher ambivalent bis kritisch zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wurden sie, mit wenigen Ausnahmen, u. a. Krais (1993) und Dölling (1993), so gut wie gar nicht als Ausgangspunkt für eine konzeptionelle oder methodische Anregung, vor allem aber nicht für empirische Analysen genutzt.
Diese Ausarbeitung versteht sich nun als ein Beitrag, der dies nachzuholen versucht und sich die bourdieuschen ‚Denkwerkzeuge‘ zur empirischen Analyse eines kernfeministischen Anliegens zu Nutzen macht: Der De-Naturalisierung von Geschlechterverhältnissen und die in diesem Zusammenhang historisch gewachsene und von den feministischen Debatten der 1970er kritisierte Selbstverständlichkeit, die die Frau als ‚natürlichen-houskeeper‘ und den Mann als Familienernährer verordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die soziologische Perspektive Pierre Bourdieus
- Epistemologische Positionierung und Erkenntnisinteresse
- Relationales statt Substanzdenken als Objektivierung
- Anerkennung und Verkennung von Herrschaft
- Dispositionelles Handeln: die Objektivierung der Objektivierung
- Epistemologische Positionierung und Erkenntnisinteresse
- Bourdieu in der Frauen- und Geschlechterforschung
- Methodische Vorbemerkung
- Vergeschlechtlichter und vergeschlechtlichender Habitus
- Partnerschaft und Haushalt
- Stand der Forschung
- Begriffsklärung und Methode
- Anknüpfungspunkte
- Symbolische Grenzziehungen
- Habitualisierungen und Logiken der Haushaltspraxis
- Diskussion: die symbolische Herrschaft des Haushalts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Potenzial der bourdieuschen Soziologie für die Analyse von Geschlechterungleichheit in heterosexuellen Partnerschaften, insbesondere im Bereich der unbezahlten Haushaltsarbeit. Sie untersucht, wie Bourdieus Konzepte die De-Naturalisierung von Geschlechterverhältnissen und die kritische Betrachtung der traditionellen Rollenverteilung von Mann und Frau im Haushalt ermöglichen.
- Die Analyse der strukturellen und kulturellen Faktoren, die die Arbeitsteilung in Partnerschaften beeinflussen.
- Die kritische Betrachtung des Konzepts der „symbolischen Herrschaft“ im Kontext der Haushaltsarbeit.
- Die Anwendung des bourdieuschen Habitus-Konzepts zur Erklärung der Reproduktion von Geschlechterungleichheit in häuslichen Praxen.
- Die Bedeutung der Objektivität des Alltagsverstandes und die praktische Anerkennung von Geschlechterrollen in der Haushaltsarbeit.
- Die Auseinandersetzung mit der Rezeption von Bourdieu in der Frauen- und Geschlechterforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Pierre Bourdieu als einen der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts vor und beleuchtet seine Kritik an gesellschaftlichen Reproduktionsmechanismen und Herrschaftsverhältnissen. Insbesondere wird die Relevanz von Bourdieus Werk für die Frauen- und Geschlechterforschung herausgestellt und die Frage nach der vergeschlechtlichten Reproduktion von Fürsorge- und Hausarbeit behandelt. Das zweite Kapitel erläutert die epistemologische Positionierung Bourdieus, insbesondere sein relationales Verständnis der sozialen Welt und seine dispositionelle Handlungstheorie. Das dritte Kapitel widmet sich der Rezeption von Bourdieu in der Frauen- und Geschlechterforschung und setzt sich kritisch mit dem Rollen-Konzept und der Doing-Gender-Perspektive auseinander. Im vierten Kapitel werden die Forschungsliteratur zu Partnerschaft und Haushalt beleuchtet und wichtige Begriffsklärungen und methodische Ansätze vorgestellt. Das fünfte Kapitel fokussiert auf die symbolischen Grenzziehungen und die Habitualisierungen, die die Haushaltspraxis prägen. Die Diskussion in Kapitel sechs konzentriert sich auf die symbolische Herrschaft des Haushalts und die Frage nach der Reproduktion von Geschlechterungleichheit in dieser Sphäre.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Geschlechterforschung, Frauenforschung, Haushaltsarbeit, Fürsorgearbeit, symbolische Herrschaft, Habitus, Geschlechterrollen, Objektivität, Alltagsverstand, Reproduktion, De-Naturalisierung, Partnerschaft, empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "symbolische Herrschaft" bei Pierre Bourdieu?
Es beschreibt eine Form von Macht, die von den Beherrschten als legitim anerkannt wird, weil sie in verinnerlichten Wahrnehmungsmustern (Habitus) verankert ist.
Wie erklärt Bourdieu die Arbeitsteilung im Haushalt?
Durch das Konzept des Habitus wird gezeigt, dass Geschlechterrollen im Haushalt oft als "natürlich" verkannt werden, obwohl sie soziale Konstrukte sind, die Machtverhältnisse reproduzieren.
Was ist das Ziel der "De-Naturalisierung" von Geschlechterverhältnissen?
Ziel ist es, die Selbstverständlichkeit aufzubrechen, mit der Frauen als "natürliche Hausfrauen" und Männer als "Ernährer" gesehen werden, und deren soziale Herkunft aufzuzeigen.
Warum wurde Bourdieus Spätwerk "Die männliche Herrschaft" kritisiert?
Die Arbeit weist darauf hin, dass seine Ausführungen in der Geschlechterforschung oft ambivalent aufgenommen wurden, da sie wenig Raum für empirische Analysen oder neue konzeptionelle Anregungen ließen.
Was versteht man unter "dispositionellem Handeln"?
Es bezieht sich auf Handlungen, die aus tief verinnerlichten Neigungen (Dispositionen) resultieren, welche durch die soziale Herkunft und das Umfeld geprägt wurden.
- Quote paper
- Leander Fricke (Author), 2022, Die bourdieusche Soziologie innerhalb der Frauen- und Geschlechterforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335760