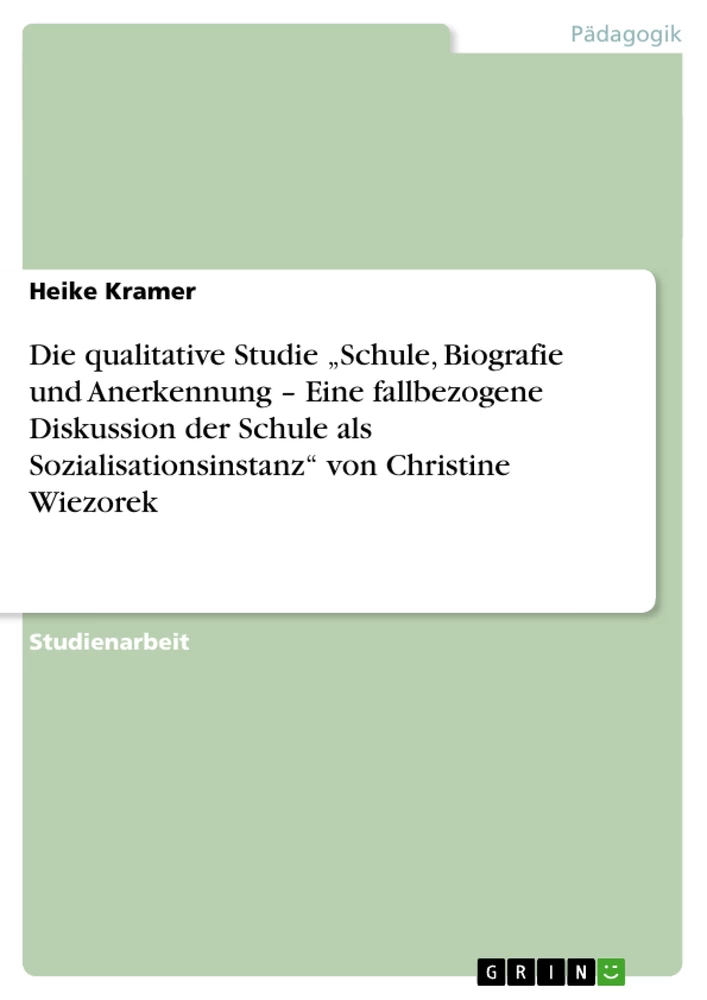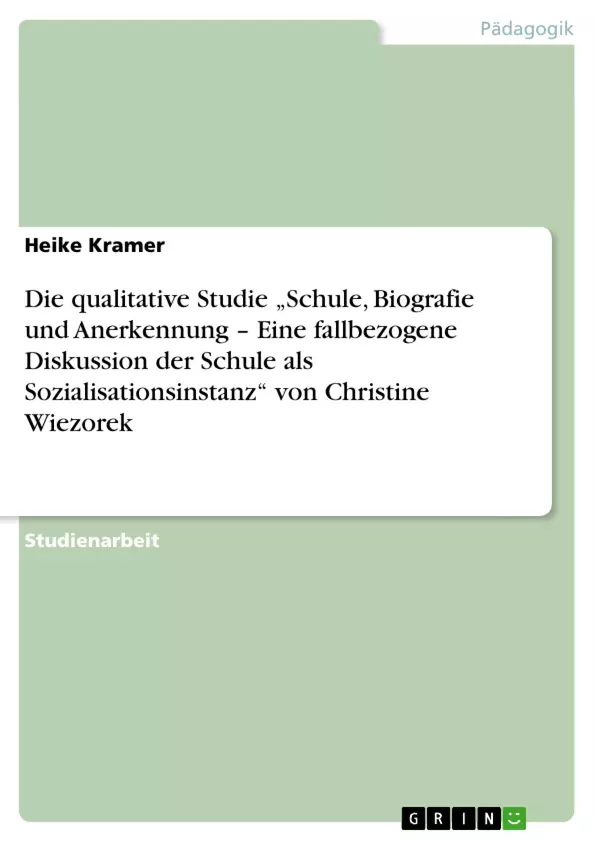Der qualitativen Studie, Schule Biografie und Anerkennung – Eine fallbezogene Diskussion
der Schule als Sozialisationsinstanz geht die Feststellung voraus, dass die gesellschaftlich
bestimmte Schulpflicht die Schule zu einem Ort macht, der einen Beitrag zur sozialen Organisation
der Biographie leistet. Dadurch, dass jeder Heranwachsende die Schule besuchen
muss, wird die Schule zu einem gesellschaftlich bestimmten Teil des Lebenslaufs. Die Frage,
die Wiezorek stellt, richtet sich nachfolgend darauf, worin dieser gesellschaftlich initiierte
Beitrag der Schule besteht. Dadurch, dass die Prozesse innerhalb der Schule durch interagierende
Subjekte charakterisiert sind, geht es zudem darum, die soziale Organisation der Biographie
zu bestimmen. Der Fragestellung geht sie durch das Analysieren von drei Exemplarischen
Schülerbiographien, die anhand narrativer Interviews rekonstruiert werden und auf der
Basis von dabei relevant erscheinenden theoretischen Ansätzen auf den Grund, um als Ergebnis
die Schule allgemein und theoretisch in ihrem Beitrag zur Biographieorganisation zu
bestimmen. Eingangs stellt sich dabei die Frage, ob es der Wissenschaftlerin gelingt, eine
fruchtbare Verbindung von Empirie und Theorie zu leisten. Weiterhin, ob der qualitative Forschungszugang
adäquat hinsichtlich der Fragestellung gewählt wurde. Folgend soll also versucht
werden, Wiezoreks Arbeit in ihrer logischen Struktur zusammenfassend wiederzugeben,
um ihre Forschungsergebnisse aufzeigen zu können sowie anschließend wieder auf die zu
Beginn gestellten Fragen zurückzukommen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Herleitung des Aufbaus und Inhalts der Arbeit
2.1 Zur inhaltlichen Gliederung
2.2 Zur methodischen Vorgehensweise
3. Der Kern der Studie – Die drei Fallrekonstruktionen
3.1 Die konditionelle Matrix und soziohistorische Rahmenbedingungen
3.2 Zu den Schulbiographischen Portraits, Thematisierungen und der biographischen Relevanz sowie Eigentheorien von Schule
3.2.1 Michael Wagner
3.2.2 Dennis Brandt
3.2.3 Klaus Kutschbach
4. Zu den Forschungsergebnissen
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anmerkung zu Abb.I
Anhang: Abb.
1. Einleitung
Der qualitativen Studie, Schule Riografie und Anerkennung – Eine fallbezogene Diskussion der Schule als Sozialisationsinstanz1 geht die Feststellung voraus, dass die gesellschaftlich bestimmte Schulpflicht die Schule zu einem Ort macht, der einen Reitrag zur sozialen Organisation der Riographie leistet. Dadurch, dass jeder Heranwachsende die Schule besuchen muss, wird die Schule zu einem gesellschaftlich bestimmten Teil des Lebenslaufs. Die Frage, die Wiezorek stellt, richtet sich nachfolgend darauf, worin dieser gesellschaftlich initiierte Beitrag der Schule besteht. Dadurch, dass die Prozesse innerhalb der Schule durch interagie-rende Subjekte charakterisiert sind, geht es zudem darum, die soziale Organisation der Rio-graphie zu bestimmen. Der Fragestellung geht sie durch das Analysieren von drei Exemplari-schen Schülerbiographien, die anhand narrativer Interviews rekonstruiert werden und auf der Basis von dabei relevant erscheinenden theoretischen Ansätzen auf den Grund, um als Ergeb-nis die Schule allgemein und theoretisch in ihrem Beitrag zur Biographieorganisation zu bestimmen. Eingangs stellt sich dabei die Frage, ob es der Wissenschaftlerin gelingt, eine fruchtbare Verbindung von Empirie und Theorie zu leisten. Weiterhin, ob der qualitative For-schungszugang adäquat hinsichtlich der Fragestellung gewählt wurde. Folgend soll also ver-sucht werden, Wiezoreks Arbeit in ihrer logischen Struktur zusammenfassend wiederzugeben, um ihre Forschungsergebnisse aufzeigen zu können sowie anschließend wieder auf die zu Beginn gestellten Fragen zurückzukommen.
2. Herleitung des Aufbaus und Inhalts der Arbeit
Die wesentliche Struktur der Arbeit von Wiezorek ergibt sich durch „(...) vier thematische Teile, denen die einzelnen Kapitel zugeordnet sind.“2 Für einen ersten Einblick in die inhaltli-che Abfolge der Studie werden diese Teile zunächst genannt: I. Fragestellung, empirischer Zugang und methodische Verortung (Kapitel 1,2); II. Die Einbettung der Sozialisation in ge-sellschaftliche Erziehungsverhältnisse (Kapitel 3); III. Schulbiographische Verläufe und fami-lienbiographische Hintergründe – Fallrekonstruktionen (Kapitel 4,5,6); IV. Diskussion der Schule als gesellschaftliche Sozialisationsinstanz (Kapitel 7).3
Im Folgenden sollen durch einen Überblick über die inhaltliche Strukturierung der aufgezähl-ten thematischen Abschnitte und deren Schwerpunktsetzung sowie Verknüpfung untereinan-der die hauptsächlichen Aspekte hinsichtlich der Fragestellung erläutert werden. Daraufhin wird nochmals separat auf die Forschungsmethodik von Wiezorek eingegangen.
2.1 Zur inhaltlichen Gliederung
Das Schema am Ende des ersten Kapitels, welches die Anordnung der Arbeit prägnant veran-schaulicht, dient als Grundlage für eine zusammenfassende Darstellung des Inhalts.4 Dieses Schaubild macht auf bemerkenswerte Weise deutlich, wie die einzelnen Kapitel inhaltlich aufeinander Bezug nehmen. Weiterhin ist durch die Pfeilkonstellationen nachvollziehbar, wie der methodische Entwicklungsgang verläuft, durch den Wiezorek zu ihren abschließenden Ergebnissen kommt. Die Exemplarischen Fallanalysen bilden sozusagen den ersten Block der schematischen Darstellung der Arbeit. Sie sind als Beitrag zu einer Diskussion der Schule als Sozialisationsinstanz zu sehen. Diese Diskussion wird wiederum durch den zweiten Block demonstriert, der mit der allgemeinen Problemstellung schulischer Sozialisationsforschung beginnt.
In Kapitel 1 des ersten Teils Fragestellung, empirischer Zugang und methodische Verortung erläutert die Autorin in acht Unterpunkten die Problematik, die mit der Fragestellung ihrer Studie zusammenhängt und begründet dabei gleichzeitig das eigene Vorgehen innerhalb ihrer Studie. Diese Fragestellung zielt auf Ergebnisse, die klären sollen „(...) worin der Beitrag besteht, den die Schule zur sozialen Organisation der Biographie leistet.“5. Innerhalb der acht Punkte im ersten Kapitel stellt Wiezorek ihre Arbeit zunächst vor und bettet ihre Fragestel-lung folgend in die für sie relevanten theoretischen Überlegungen und empirischen Daten aus der schulischen Sozialisationsforschung ein. Die Fragen danach, wie die gesellschaftlich strukturierte Institution Schule Einfluss auf die Entwicklung der einzelnen Subjekte hat und die Vergleiche der Sozialisationsinstanz Schule zu anderen Sozialisationsinstanzen und wie-derum deren Einflussmöglichkeiten auf die intersubjektiven Prozesse in der Schule sind in-nerhalb dieses Forschungsgebiets zentrale Anliegen, die es zu untersuchen gilt.6 Dieses Un-tersuchungsgebiet erweitert die Autorin durch ihre rekonstruierten Fallanalysen und den dabei gewonnen Erkenntnissen um die biographische Perspektive. Legitimiert wird diese Erweite-rung unter biographischer Perspektive7 anfangs, indem sie vorrangig unter Punkt (1) und (2) feststellt, dass der Sozialisand durchaus aktiv und selbst gestaltend bei seiner schulischen So- zialisation mitwirkt. Dieser Aussage wiederum liegt ein Verständnis von Sozialisation zugrunde, das wie folgt beschrieben wird: „Sozialisation wird hier basal als Prozess der Ges-taltung der eigenen Biographie über die aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Gegebenheiten verstanden; dieser Prozess ist auf die Entwicklung und Erhaltung von Hand-lungsfähigkeiten, Handlungsautonomie ausgerichtet, schließt aber auch Prozesse ihrer Ge-fährdung mit ein.“8 Davon ausgehend ist zu sagen, dass bei der Fokussierung schulischer So-zialisation die Auseinandersetzungsprozesse von Bedeutung sind, die quasi unmittelbar inner-halb der Schule stattfinden und gleichzeitig die Entwicklung von Handlungsfähigkeit und Handlungsautonomie betreffen, demnach die gesamte Biographie eines Heranwachsenden prägen. Dabei besitzt jedes sich entwickelnde Subjekt unterschiedliche ‚Bewertungsskalen’ für die Relevanz schulischer Gegebenheiten sowie individuelle Erfahrungshintergründe be-züglich der eigenen Biographie.9 Unter Punkt (7) des ersten Kapitels nennt sie dazu die nötige methodologische fallanalytische Herangehensweise. Die „(...) merkmalsentdeckende Heraus-arbeitung der Phänomenologie eines einzelnen Falles (...) [garantiert Erkenntnisse] eines bei-spielhaften Zusammenhangs von Biographie und Schule (...).“10 Das bedeutet, dass allein die Erfassung der Komplexität und Prozesshaftigkeit eines Falls zu Befunden führen kann, die innerhalb der Fallanalyse diskutiert und rekonstruiert werden und in der Folge durch die er-fasste interne Logik des Falls Rückschlüsse bezüglich des spezifischen Zusammenhangs von Biographie und Schule erlauben. Diese Rückschlüsse wiederum können das Potential zu einer abstrahierten allgemeinen Theorie der Schule als Sozialisationsinstanz darstellen, indem sie aufzeigen, worin bzw. durch welche Problematik grundsätzlich und bei allen drei Fallanaly-sen gleichsam der schulische Beitrag zur Biographie besteht.11
Innerhalb der Punkte (3) bis (8) garantiert die Darstellung der aufeinander aufbauenden bzw. sich entwickelnden Forschungslinien schulischer Sozialforschung weiterhin, dass deutlich wird, woran sich Wiezorek bezüglich ihrer schulbiographischen Einzelfallanalysen orientiert, warum die Darstellung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen die von ihr In-terviewten zur Schule gehen von Bedeutung ist, wo die Arbeit Wiezoreks ihren Ausgang hat und letztlich, warum Familie und Milieu innerhalb ihrer Fallrekonstruktionen ebenfalls Ge-genstand der Analyse sind. Die o. g. vorherrschenden Fragestellungen in der schulischen So-zialisationsforschung, die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zum zentralen Gegens-tand dieser Forschungsrichtung wurden, haben laut Wiezorek ihren Ursprung im strukturfunk-tionalistischen Ansatz Ende der 60er Jahre desselben Jahrhunderts, wobei sie Fend (1976, 1977, 1981) als wichtigsten Vertreter dieser Richtung nennt.12 Grundlegend ist hierbei die Annahme, dass die schulische Sozialisationsinstanz nicht bloß in Bezug auf die Leistung der Schüler, die sich in den Noten widerspiegelt in ihrer Beeinflussungsmöglichkeit untersucht werden muss, sondern dass Schule vielmehr am „gesellschaftlichen Reproduktionsprozess“13 beteiligt ist. Als Beteiligte Instanz dieses Prozesses kommt der Schule die Aufgabe zu, die Heranwachsenden zu qualifizieren, damit man für den Einstieg in die gesellschaftliche Struk-tur nach der schulischen Laufbahn, etwa für die Berufswelt ausgerüstet ist. Damit nach der Schullaufbahn eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft garantiert ist, muss bereits die Schule gesellschaftlich bedingte Normen und Regeln vermitteln. Ebenso soll die Aufgabe der Selektion durch die Schule erfüllt werden, indem z. B. mit Hilfe von Leistungs- und Eig-nungsprüfungen den Schülern den jeweiligen Ergebnissen nach der Weg zu einem Studium offen steht oder ggf. andere Wege beschritten werden sollten. Die Schule ist also „(...) ge-rahmt von gesetzlich-institutionellen Regelungen- als Institution ein auf die Persönlichkeits-entwicklung des Schülers wirkendes System (vgl. Fend 1976; Fend 1977: 214) (...)“14
Unter Punkt (6) greift Wiezorek diesen Aspekt wieder auf und verweist darauf, dass neben der Schule auch die „familialen und milieuweltlichen Gegebenheiten des Aufwachsens"15, die im Rahmen der Fallanalysen relevant werden, ebenfalls durch „gesellschaftliche Rahmenbe-dingungen strukturiert“16 sind.
Um wieder auf die Herleitung der einzelnen Forschungslinien innerhalb der schulischen Sozi-alisationsforschung zurückzukommen, ist als Stichpunkt der interaktionistische Ansatz zu nennen, welcher sich in den 70er Jahren entwickelte. Die äußere Verfasstheit der Schule, die durch gesellschaftliche Reglementierung charakterisiert ist, wurde bereits bei Fend durch eine sog. Innenansicht ergänzt, die er mit dem operationalisierten Begriff des Schulklimas weiter-hin bezüglich der Wirkung auf die Persönlichkeit der Schüler zum Gegenstand der Forschung gemacht hat. Dabei arbeitete Fend die Dimensionen des Inhaltsaspekts, Interaktionsaspekts sowie den Beziehungsaspekt heraus, die auch bei Wiezorek und ihren Fallanalysen eine Rolle spielen.17 Der interaktionistische Ansatz entwickelte sich ausgehend von diesem trotzdem eher makrosoziologischen Blick dahingehend, dass er vornehmlich mittels der qualitativen Methodik von Fallrekonstruktionen die inneren, durch intersubjektive Prozesse gekennzeich-neten Strukturen der Schule und deren Einfluss auf die Identitätsentwicklung der Schüler un-tersuchte, und zwar indem er offen legt, wie und durch welche Faktoren der Einfluss wirkt. Dabei wurde es zunächst möglich zu untersuchen, wodurch die „ (...) Schule als Typisie- rungs- und Kontrollinstanz bei der Erzeugung sekundärer Devianz (Lemert 1875) (...)“18 be-deutsam wird, was durch spätere Einzelfallanalysen immer differenzierter ausgearbeitet wur-de. So wurde es u. a. durch die Studie von Krappmann und Oswald (1995) möglich, „diffe-renzierend auf die Verwobenheit schulischer Sozialisation mit der anderer Bereiche (der Fa-milie, peer group) aufmerksam [zu werden]“ was dann in einer weiteren Forschungslinie, der biographischen SchülerInnenforschung aus den 80er Jahren von Bedeutung wird.19 Orientiert an der Längsschnittstudie von Hurrelmann und Wolf (1986), die u. a. veranschaulicht, was Erfolg bzw. Versagen in der Schule zu den zukünftigen Strukturierungen der Lebensphasen beiträgt sowie ausgehend von Nittels „ (...)Untersuchung zu Gymnasialer Schullaufbahn und Identitätsentwicklung (...)“20, die durch „(...) autobiographisch- narrative Interviews „Daten [erhebt, C. W.], deren Analyse Rückschlüsse auf die sequentielle Ordnung lebensgeschichtli-cher Ereignisse und Erfahrungsabläufe gestattet (...)“21, erlangt Wiezorek schließlich die am Einzellfall analysierten Rückschlüsse darauf, was die Schule zur biographischen Struktur bei-trägt.22
Schlussendlich bleibt noch zu erwähnen, dass sie unter Punkt (4) und (5) zum einen den Aus-gang ihrer „ (...) Arbeit im Bielefelder-Kasseler Graduiertenkolleg Schulentwicklung an Re-formschulen im Hinblick auf das allgemeine Schulsystem (...)“23 thematisiert, wobei sie dar-auf aufmerksam macht, dass sie anders als das Graduiertenkolleg „(...) ein von den konkreten Einzelschulen abgehobenes Bild von Schule (...)24 durch den Besuch mehrer Schulen ihrer Interviewpartner zum Gegenstand ihrer Analysen macht. Zum anderen rechtfertigt sie die Analyse des Zusammenhangs von Familie und Milieu mit der Schule innerhalb ihrer Fallre-konstruktionen einerseits durch die expliziten Äußerungen und Bedeutungszuschreibungen dieser Bereiche durch die Jungendlichen während der Interviews. Andererseits betont sie, dass, ausgenommen der Studien von Willis Spaß am Widerstand (1979), die das Herkunftsmi-lieu der Arbeiterklasse in Verbindung mit der Ablehnung von Schule diskutiert und von der Forschung Kramers und Helspers (2000), die das Verhältnis von Familie und Schule untersu-chen, diese Verhältnisse in der Forschung unzureichend behandelt wurden. Durch die Analy-sen des Herkunftsmilieus sowie der jeweiligen familialen Bedingungen in ihren Fallrekon-struktionen soll dieses Defizit verhindert werden.25 Letztlich hat die Autorin im ersten Kapitel einen bündigen Überblick über ihr Vorgehen hergestellt, der zur begründeten Struktur (Schaubild) ihrer Arbeit führt.
Das erste Kapitel gibt also auf eine argumentative, sich an empirische Daten und wissen-schaftliche Befunde orientierende Weise Einsicht in die Struktur der Arbeit. Gleichzeitig ge-währt es eine Übersicht über die plausible Vorgehensweise und angestrebten Ziele. Die kon-kret zu erwartenden Ergebnisse dabei werden jedoch innerhalb der Zusammenfassung Wiezo-reks Studie meinerseits später näher benannt und beschrieben. Zunächst soll die angewandte qualitative Methodik Gegenstand der Arbeit sein, um dann durch eine knappe und einleitende Zusammenfassung des zweiten thematischen Teils der Untersuchung auf die Fallrekonstrukti-onen sprechen zu kommen.
2.2 Zur methodischen Vorgehensweise
Wieder Bezug nehmend auf das Schaubild am Ende des ersten Kapitels, sollte an dieser Stelle u. a. deutlich geworden sein, warum die Exemplarischen Fallanalysen (erster Block) als wichtiges Element bei der Diskussion der Schule als Sozialisationsinstanz (zweiter Block) unabdingbar ist. Der folgende Abschnitt hat sozusagen die Verbindung beider Blöcke, näm-lich das, was die Fallstudien als Mittel der Erkenntnisgewinnung für eine schultheoretische Fragestellung quasi auszeichnet, zum Thema.26 Demzufolge wird also darauf eingegangen, durch welche Vorgehensweise innerhalb der rekonstruktiven Forschung Wiezoreks die Er-kenntnisse gewonnen werden sowie weiterhin auf die formaltheoretische Ausgangslage ver-wiesen.
Bei Wiezorek steht „(...) das Wie des Zusammenhanges von Schule und Biographie (...)“27 im Vordergrund, was ihre Forschung als eine qualitative identifiziert. Dieses Wie des Zusam-menhanges „(...) erfordert zunächst eine Distanzierung von theoretischen Vorannahmen oder einem elaborierten Forschungsmodell über die Wechselwirkungen von Schule und Biogra-phie, denn erst über die Rekonstruktionen schulbiographischer Verläufe, schulbiographischer Thematisierungen sowie biographisch konstituierter Eigentheorien über Schule (...)“28 lässt sich darauf folgend deutlich machen, in welcher Weise die Schule als strukturelle Gegeben-heit der Biographie auftritt. Um dies zu erreichen, greift Wiezorek zum einen auf den Unersu-chungsplan der Einzelfallanalyse zurück.29 Diese Analyse, so Mayrings Grundgedanke dazu, „(...) will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tief greifenden Ergebnissen zu gelangen.“30 Ein derartiger Untersuchungsplan scheint also grundlegend für die von der Wis- senschaftlerin angestrebten Erkenntnisse zu sein. Zum anderen wendet sie weiterhin das qualitative Erhebungsverfahren des narrativen bzw. offenen Interviews an. Auch hierbei sollen die Grundgedanken, die im Zusammenhang einer Erläuterung qualitativer Sozialforschung stehen, aufgeführt werden: „Das narrative Interview will durch freies Erzählen von Geschich-ten zu subjektiven Bedeutungsstrukturen gelangen, die sich einem systematischen Abfragen versperren würde. Die Strukturierung des Gesprächs geschieht durch den universellen Ab-laufplan von Erzählungen, den der Interviewer unterstützt.“31 Durch dieses Erzählen soll der Interviewte deshalb selbst den „(...) unterstellte[n] Zusammenhang von Schule und Biographie (...)“32 strukturieren, damit die von Mayring erwähnten subjektiven Bedeutungsstrukturen in Bezug auf den hier thematisierten Zusammenhang von Schule und Biographie offen gelegt werden können. Dabei geht dem Erhebungsprozess im Besonderen „(...)das Interesse an den jeweiligen inneren Zusammenhängen der Phasen bzw. Strukturen von individuellen bzw. kol-lektiven Einzelfallprozessen sowie daraus hervorgehend das Interesse an den „Prozessstruktu-ren und -mechanismen der ‚Identität’“(a.a.O.: 247)“33 voraus.
Dieser Erhebungsprozess wurde von Wiezorek folgendermaßen geplant: Nach der Fragestel-lung, die das Thema einleitet, sollte der Interviewpartner ohne Unterbrechung und durch die Interviewerin motiviert erzählen können. Sofern die Erzählung dem o. g. universalen Ablauf-plan entspricht und vor allem nicht völlig von der anfänglich gestellten Frage abweicht, wird erst am durch den Befragten signalisierten Ende der Schilderungen nachgefragt. Dabei sollte nach bestimmten Kommentaren gefragt werden, die nicht weiter ausgeführt wurden, was aber in Bezug auf das Thema von Interesse sein könnte sowie sich allgemein nach bestimmten themenrelevanten Aspekten, die bis dahin noch nicht angesprochen wurden, erkundigt wer-den. Vorgesehen wird, dem Interviewten währenddessen die Möglichkeit zu geben, selbst abstrahierende Gedanken und Theorien über das Erzählte zu formulieren, um dabei zuzusagen ein mehr oder weniger reflektierender Experte seiner eigenen Schulbiographie zu werden. Innerhalb des Erhebungsprozesses stellte sich allerdings heraus, dass von den Interviews, die mit ursprünglich zwölf ehemaligen Schülern einer Thüringer Schule durchgeführt wurden, letztlich drei von wiederum fünf, die für die ausführliche Analyse brauchbar waren als Fallre-konstruktionen für die weitere Untersuchung verwendet werden konnten.34 Bei vier der Interviews zeigte sich im Verlauf, dass der Familie hohe Signifikanz zugesprochen wurde was Wiezorek dazu veranlasste, das jeweilige Interview durch ein familienbiographisches Ge-spräch zu ergänzen.35
Die weiteren Arbeitsschritte nach den aufgezeichneten Interviews und Familienbiographi-schen Gesprächen haben sich als ‚Arbeiten am Text’ mit Hilfe der Dokumentarischen Metho-de der Interpretation gestaltet. An dieser Stelle soll dieses Textinterpretieren jedoch nicht ausführlich wiedergegeben werden, weil diesem Arbeitsprozess viele einzelne Schritte immanent sind, deren Erläuterung im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen würde. Hinsichtlich der familienbiographischen Gespräche ist weiterhin zu sagen, dass Wiezorek bei deren Analyse neben der Textinterpretation die „ (...) Methodik der sozialwissenschaftlichen Genogramma-nalyse (...), wie sie von Hildenbrand für die fallrekonstruktive Familienforschung zugänglich gemacht wurde (vgl. Hildenbrand 1999).“36, eingesetzt hat. Bei der üblichen Vorgehensweise wird ein genealogischer Stammbaum mit den jeweils relevanten Daten der Familienmitglieder – wie etwa Angaben zu Personen, die Beziehungen untereinander, Beruftätigkeit – vor der eigentlichen Textinterpretation angelegt, was zu einer Fallstrukturhypothese verhelfen kann. Diese Stammbäume sind im Bezug auf die Analysen deshalb hilfreich, weil sie dazu beitra-gen, eine sich entwickelnde Familie mit Bezug zu den jeweiligen generationsspezifischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu veranschaulichen, die dem einzelnen Fall und des-sen biographischen Verlauf keine unwesentlichen Rahmenbedingungen beim Aufwachsen bereitstellen. Bei der Studie Wiezoreks dagegen konnte der genealogische Stammbaum erst nachdem die Wichtigkeit der Analyse familialer Rahmenbedingungen innerhalb der Interviews deutlich wurde, als Hilfsmittel eingesetzt werden. Trotzdem wurde es bei der Ge-nogrammanalyse in Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen möglich, durch die Rückbeziehung der dabei gewonnenen Einsichten in die inneren Beziehungs- und Handlungs-strukturen der jeweiligen Familien auf die Gesprächssequenzen zu überprüfen, ob diese Ein-sichten am Text der Interviews bestehen können bzw. ergänzend schulbiographische Thema-tisierungen erklären können.37
Formaltheoretisch geht Wiezorek bei ihren Fallanalysen von drei maßgeblichen Ansatzpunk-ten aus, denen jeweils hohe explizierende Relevanz bezüglich der auftretenden Phänomene innerhalb der Fallrekonstruktionen im Hinblick auf die sozialisationstheoretische Fragestel-lung zugeschrieben wird. Zum einen bezieht sie sich bei der Darstellung der Identitätsent-wicklung und das Handeln in diffusen und rollenförmigen Sozialbeziehungen auf Mead (1993), Parsons (1958, 1961, 1966) und Oevermann (1996), wobei sie gleichzeitig bestimmte Begrifflichkeiten ihrer weiteren Analyse einführt.
[...]
1 Wiezorek, Christine. „Schule Biografie und Anerkennung – Eine fallbezogene Diskussion der Schule als Sozia lisationsinstanz“, Wiesbaden 2005.
2 Wiezorek 2005, S.43.
3 Im Folgenden werden Titel einzelner Kaptitel und thematischer Abschnitte sowie wichtige Begriffe aus Wie-zoreks Arbeit grundsätzlich durch kursive Schriftart kenntlich gemacht. Diese Hervorhebungen wiederum seitens Wiezorek innerhalb der Zitate werden wegen ihrer Regelmäßigkeit nicht weiter ausgewiesen.
4 Vgl. Abb. I.
5 Wiezorek 2005, S.15.
6 Vgl. Tillmann (1995) zitiert nach: Wiezorek 2005, S.18.
7 Vgl. Abb. I.
8 Wiezorek 2005, S.16f.
9 Vgl. ebd.
10 Ebd, S.43.
11 Vgl. ebd, S.42ff.
12 Vgl. ebd, S.19.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Ebd, S.41.
16 Ebd.
17 Vgl. ebd, S.20.
18 Ebd, S.20f.
19 Vgl. S.22ff.
20 Ebd, S.23.
21 Ebd.
22 Vgl. ebd. S.28.
23 Ebd, S.29.
24 Ebd, S.34.
25 Vgl. S.35ff.
26 Vgl. Abb. I.
27 Wiezorek 2005, S.47.
28 Ebd.
29 In Kapitel 2.1 wurde bereits die dabei wichtige phänomenologische Herangehensweise begründet.
30 Mayring, Philip. „Einführung in die qualitative Sozialforschung“, Weinheim und Basel 2002, S.42.
31 Ebd, S.73.
32 Wiezorek 2005, S.48. Die Autorin geht hier bezüglich der allgemeiner Angaben zum narrativen Interview von Schütze (1987) aus.
33 Ebd, S.49.
34 Da nach Nittel (1992) den Schülern erst nach der jeweiligen Schullaufbahn und mit Abstand zu den dort herr-schenden Gegebenheiten bewusst werden kann, welche Bedeutung der Schule im Bezug auf die eigene Biogra-phie zukommt, interviewte Wiezorek ehemalige Schüler aus den Abschlussjahrgängen 1995 und 1997. Vgl. ebd, S.50.
35 Vgl. ebd, S.47ff.
36 Ebd, S.60.
37 Vgl. ebd, S.50ff.
Häufig gestellte Fragen zur Studie von Christine Wiezorek
Was untersucht die Studie „Schule, Biografie und Anerkennung“?
Sie untersucht, welchen Beitrag die Schule als Sozialisationsinstanz zur sozialen Organisation der individuellen Biographie leistet.
Welche Methode wendete Christine Wiezorek an?
Die Studie basiert auf qualitativen Fallrekonstruktionen, die mithilfe von narrativen Interviews erstellt wurden.
Was wird unter "Biografieorganisation" verstanden?
Der Prozess, in dem Individuen ihre eigene Lebensgeschichte in aktiver Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Institutionen wie der Schule gestalten.
Warum ist die Schulpflicht für die Biografie relevant?
Weil sie die Schule zu einem gesellschaftlich determinierten Teil des Lebenslaufs macht, den jeder Heranwachsende durchlaufen muss.
Welche Rolle spielt die Familie in dieser Studie?
Familienbiographische Hintergründe werden als Teil der Fallrekonstruktion einbezogen, um die Wechselwirkung verschiedener Sozialisationsinstanzen zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Studentin Heike Kramer (Autor:in), 2007, Die qualitative Studie „Schule, Biografie und Anerkennung – Eine fallbezogene Diskussion der Schule als Sozialisationsinstanz“ von Christine Wiezorek, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133579