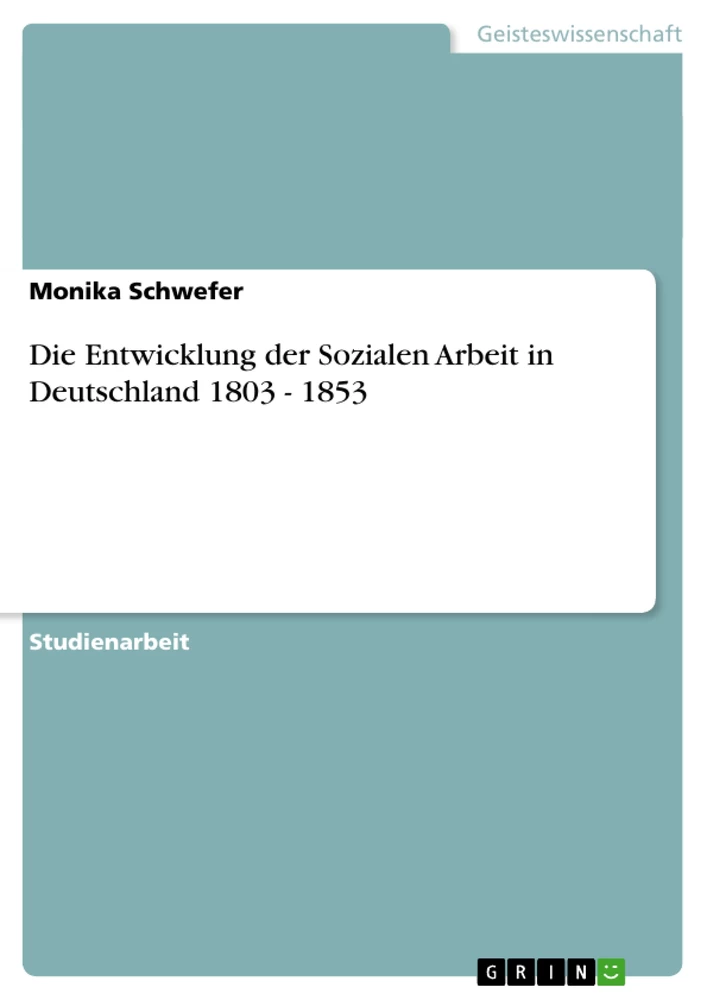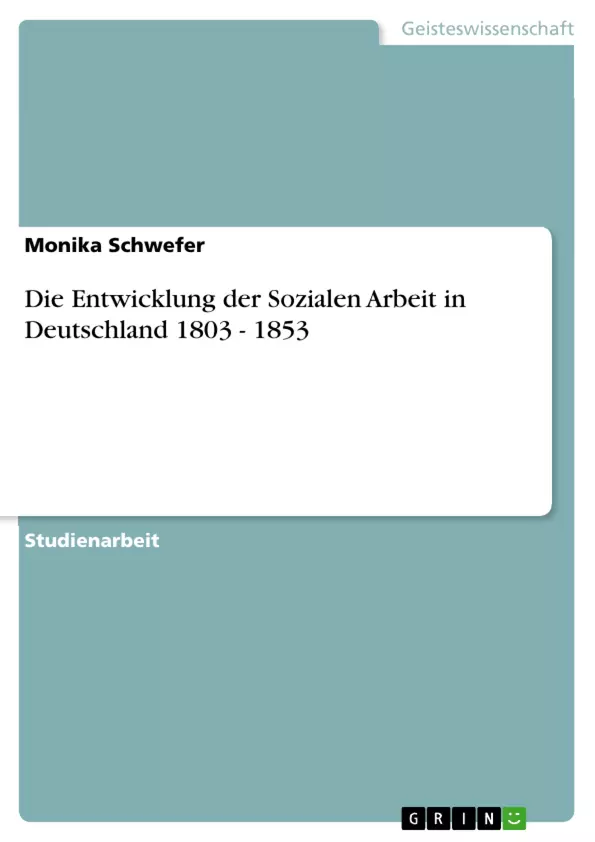Jeder Beruf hat seinen Ursprung. So kann man die Wurzeln des Architekten bis zum Höhlenausbau der Steinzeit zurück verfolgen, ebenso gab es den heutigen Beruf des Konditors schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte. Brot und andere Lebensmittel mussten hergestellt werden, um ein Volk am Leben zu halten. Doch worin liegen die beruflichen Anfänge der Sozialen Arbeit? Wie weit lassen sie sich ergründen? Sicherlich fallen einem sofort Begriffe wie „Hebamme, Kindermädchen, Arzt und Pfleger“ ein, die alle zum sozialen Sektor gehören. Aber gab es diese Berufe schon in der Steinzeit oder erst in der Bronzezeit? Warum haben sich die verschiedenen Berufe in der Sozialen Arbeit entwickelt und ab wann kann man eigentlich von einer ersten Professionalisierung sprechen? Die liberale Sozialreformerin der deutschen Frauenbewegung Alice Salomon betitelte diesen Berufszweig im 19. Jahrhundert als „beruflich praktizierte Mütterlichkeit“ . Doch mittlerweile ist die Soziale Arbeit vielmehr. Sie ist vielfältiger geworden, breiter angelegt und nicht einfach mehr nur auf eine „Mütterlichkeit“ der Praktizierenden zu beschränken. So gibt es dort unzählige Berufe, die sich in verschiedenen Bereichen wiederfinden, z.B. Altenpflege, Jugendarbeit, Rehabilitation, Beratung in allen Lebenslagen usw. .
In anderen Berufszweigen beschäftigt man sich nicht unbedingt mit diesen Fragen nach dem Ursprung. Doch meiner Meinung nach, ist es wichtig sich während des Bachelor – Studienganges Soziale Arbeit mit diesem Thema auseinander zu setzen, um heutige Entwicklungslinien und Diskussionen zu verstehen. Außerdem ist es notwendig nachvollziehen zu können, worin die Anfänge bestimmter sozialer Berufe liegen, um sich auch später damit zu identifizieren und auf das Klientel besser eingehen zu können. Aus diesen Gründen habe ich mich in dieser Hausarbeit mit dem Thema „Die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland im Zeitraum von 1803 bis 1853“ beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Gesellschaftliche Hintergründe im 19. Jahrhundert
- Der wirtschaftliche Bereich
- Die politische Situation
- Der familiäre Bereich
- Entwicklungen in deutschen Städten
- Die Rostocker Armenverordnung
- Hamburg - Das Rauhe Haus
- Wuppertal – Das Elberfelder System
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland zwischen 1803 und 1853. Ziel ist es, die Anfänge der professionellen Sozialen Arbeit im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts zu beleuchten und wichtige Entwicklungsschritte nachzuvollziehen.
- Die Auswirkungen der Industrialisierung auf die soziale Frage
- Die Entstehung kommunaler Armenordnungen und ihre Reformierung
- Innovative Ansätze der Armenfürsorge in verschiedenen deutschen Städten (Rostock, Hamburg, Wuppertal)
- Das Aufkommen neuer institutioneller Formen der Sozialen Arbeit
- Die ersten Schritte hin zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Motivation der Autorin, sich mit den Ursprüngen der Sozialen Arbeit auseinanderzusetzen. Es wird die Notwendigkeit betont, die historischen Entwicklungslinien zu verstehen, um die heutige Soziale Arbeit besser zu begreifen und sich mit dem Klientel identifizieren zu können. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland zwischen 1803 und 1853.
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Inhalt der Arbeit. Sie benennt die gesellschaftlichen Hintergründe des 19. Jahrhunderts (wirtschaftliche, politische und familiäre Situation) als Grundlage für die Entstehung der sozialen Frage und das Aufkommen der Sozialen Arbeit. Der Hauptteil behandelt drei deutsche Städte als Vorreiter der Armenfürsorge: Rostock mit seiner kommunalen Armenverordnung, Hamburg mit dem Rauhen Haus und Wuppertal mit dem Elberfelder System. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Entwicklungen im betrachteten Zeitraum.
Gesellschaftliche Hintergründe im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Bedingungen, die die Entwicklung der Sozialen Arbeit prägten. Die Industrialisierung mit ihren Folgen wie Landflucht, Armut und wachsender sozialer Ungleichheit wird ausführlich dargestellt. Der Aufstieg des Kapitalismus und die Herausbildung des Nationalstaates werden als zentrale politische und wirtschaftliche Faktoren betrachtet, welche die soziale Frage verschärften und den Bedarf an neuen Formen der sozialen Fürsorge hervorriefen. Die zunehmende Vernetzung durch Medien wie Zeitungen wird ebenfalls als ein Faktor hervorgehoben, der das Bewusstsein für soziale Probleme schärfte und das Engagement in sozialen Fragen förderte.
Entwicklungen in deutschen Städten: Dieses Kapitel präsentiert drei Fallstudien, die verschiedene Ansätze der Armenfürsorge und frühen Sozialen Arbeit veranschaulichen. Die Rostocker Armenverordnung von 1803 wird als ein erster Schritt zur kommunalen Selbstverwaltung in der Armenhilfe beschrieben. Das Rauhe Haus in Hamburg (gegründet 1833) wird als Beispiel für eine innovative Einrichtung zur Betreuung verhaltensauffälliger und armer Kinder und Jugendlicher dargestellt. Schließlich wird das Elberfelder System (ab 1853) als Reaktion auf die durch die Industrialisierung entstandene Massenarmut vorgestellt, das sich durch dezentrale und ehrenamtliche Strukturen auszeichnete.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Deutschland, 19. Jahrhundert, Industrialisierung, Armenfürsorge, soziale Frage, Rostock, Hamburg, Wuppertal, Rauhes Haus, Elberfelder System, kommunale Selbstverwaltung, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Soziale Arbeit in Deutschland (1803-1853)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland zwischen 1803 und 1853. Sie beleuchtet die Anfänge professioneller Sozialer Arbeit im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts und verfolgt wichtige Entwicklungsschritte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Auswirkungen der Industrialisierung auf die soziale Frage, die Entstehung und Reformierung kommunaler Armenordnungen, innovative Ansätze der Armenfürsorge in Rostock, Hamburg und Wuppertal (Rostocker Armenverordnung, Rauhes Haus, Elberfelder System), das Aufkommen neuer institutioneller Formen der Sozialen Arbeit und die ersten Schritte zur Professionalisierung des Berufsfelds.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet ein Vorwort, eine Einleitung, ein Kapitel zu den gesellschaftlichen Hintergründen des 19. Jahrhunderts, ein Kapitel zu den Entwicklungen in deutschen Städten (Rostock, Hamburg, Wuppertal), eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis.
Was wird im Kapitel "Gesellschaftliche Hintergründe im 19. Jahrhundert" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Bedingungen, die die Entwicklung der Sozialen Arbeit prägten. Es beschreibt die Industrialisierung mit ihren Folgen (Landflucht, Armut, soziale Ungleichheit), den Aufstieg des Kapitalismus, die Herausbildung des Nationalstaates und die zunehmende Vernetzung durch Medien wie Zeitungen als Faktoren, die die soziale Frage verschärften und den Bedarf an neuer sozialer Fürsorge hervorriefen.
Was wird im Kapitel "Entwicklungen in deutschen Städten" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien zu drei Städten: Rostock (mit der Armenverordnung von 1803 als Beispiel für kommunale Selbstverwaltung), Hamburg (mit dem Rauhen Haus als innovative Einrichtung für verhaltensauffällige und arme Kinder und Jugendliche) und Wuppertal (mit dem Elberfelder System als Reaktion auf Massenarmut, gekennzeichnet durch dezentrale und ehrenamtliche Strukturen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Soziale Arbeit, Deutschland, 19. Jahrhundert, Industrialisierung, Armenfürsorge, soziale Frage, Rostock, Hamburg, Wuppertal, Rauhes Haus, Elberfelder System, kommunale Selbstverwaltung, Professionalisierung.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Anfänge der professionellen Sozialen Arbeit in Deutschland zu verstehen und im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts zu verorten. Sie soll dazu beitragen, die heutige Soziale Arbeit besser zu begreifen.
Welche Quellen werden verwendet?
Das Literaturverzeichnis enthält die verwendeten Quellen, die im Detail in der vollständigen Hausarbeit aufgeführt sind.
- Quote paper
- Monika Schwefer (Author), 2008, Die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland 1803 - 1853, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133586