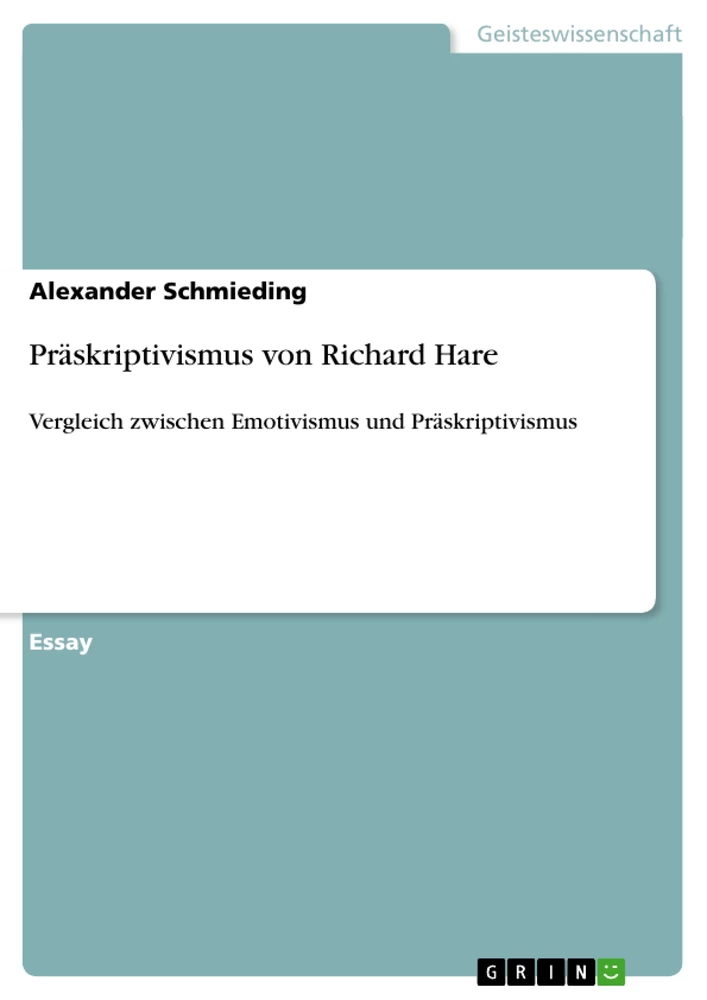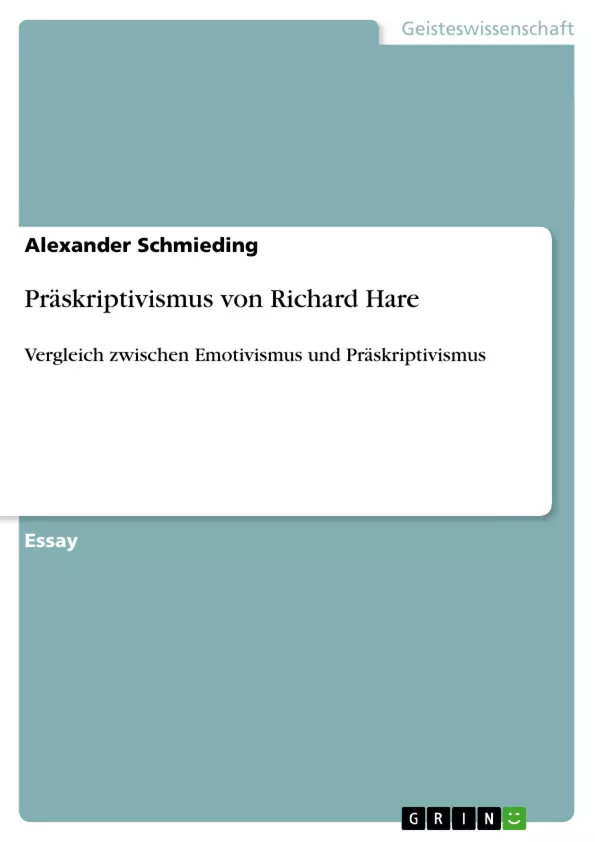Im folgenden Essay werde ich Hares’ Präskriptivismus rekonstruieren. In dem Verlauf dieser Abhandlung werde ich auch das Problem des Fanatikers erklären. Ich beziehe mich dabei auf den Text „Eine moderne Form der goldenen Regel“ aus dem Buch
„Texte zur Ethik“.
Im folgenden Essay werde ich Hares’ Präskriptivismus rekonstruieren.
In dem Verlauf dieser Abhandlung werde ich auch das Problem des Fanatikers erklären. Ich beziehe mich dabei auf den Text „ Eine moderne Form der goldenen Regel“ aus dem Buch „ Texte zur Ethik“.
Richard M. Hare ist ein englischer Moralphilosoph des 20.Jahrhunderts. Seine entwickelte Moraltheorie nennt er „ Universaler Präskriptivismus“.
Zu Beginn seiner Abhandlung klärt er, dass es nur zwei Merkmale moralischer Urteile geben könne. Diese sind die Präskriptivität und Universalisierbarkeit.
Die Präskriptivität bezieht sich auf das Individuum, welches seine Handlungen durch seine eigens auferlegte Maxime moralisch zu rechtfertigen versucht. Die Universalisierbarkeit geht darüber hinaus und bezieht sich auf ein Kollektiv von Menschen, die diese Maxime als einen „ Handlungsgrundsatz“ akzeptieren und danach handeln. Richard M. Hare versucht nun anhand eines Beispiels die Umsetzbarkeit dieser beiden Begriffe zu erläutern. Er schildert drei Personen A, B, C, welche im wechselseitigen Gläubiger/Schuldnerverhältnis stehen. A schuldet B Geld und B schuldet wiederum C Geld. Hare nimmt weiterhin an, dass jeder Gläubiger dazu berechtigt sei seinen Schuldner einzusperren. Er beweist nun, dass immer beide Begriffe zusammen gehören, weil sich sonst ein Widerspruch zwischen dem „ wollen“ und dem“ sollen“ ergäbe. Ist eine Vorschrift präskriptiv, aber nicht universalisierbar, dann stimmt B folgendem Satz zu: „ Laß mich A ins Gefängnis stecken“( S.110). Wenn dieser Satz allerdings moralisch formuliert wird, kann B die Konsequenzen, die daraus folgen nicht mehr wollen. „ Jeder in meiner Lage sollte seinen Schuldner ins Gefängnis stecken“(S.110). C befindet sich nämlich in derselben Situation wie B und deshalb ist B höchstwahrscheinlich nicht gewillt ins Gefängnis zu gehen. Wenn eine Vorschrift universalisierbar, aber nicht präskriptiv ist, bricht die ganze moralische Begründung zusammen. Angenommen B postuliert den Grundsatz Ich(B) sollte C ins Gefängnis stecken, dann muss B ebenso die Vorschrift annehmen „ Laß C mich ins Gefängnis stecken“ (S.110). Weil das „ sollte“ präskriptiv angenommen wird, sieht sich jeder moralisch Handelnde an seine Urteile gebunden. B kann natürlich das Gefängnis nicht wollen. Aber wenn er es nicht will, kann er seinen Anspruch bei A auch nicht mehr moralisch rechtfertigen.
Nach diesem Beweis zählt Hare vier Erfordernisse auf, die für solche geschilderten Begründungen notwendig sind. 1. Es müssen immer Tatsachen vorliegen, denn nach ihm gilt, dass keine Begründung aus dem Nichts entsteht. 2. Universalisierbarkeit und Präskriptivität müssen beide auf die Tatsachen anwendbar sein. 3. Es spielen bei den Begründungen auch Neigungen eine Rolle. Zum Beispiel ist B geneigt A ins Gefängnis zu stecken, oder B ist nicht gewillt von C ins Gefängnis gesteckt zu werden. 4. Nach Hare ist auch geistiges Vorstellungsvermögen wichtig. Denn C wäre als dritte Person nicht nötig, wenn B wüsste wie es ist in der Lage von A zu sein.
Hare beginnt nun „ Fluchtwege“ für B aufzuzeigen, durch die B aus seinem ambivalenten Gläubiger/Schuldnerverhältnis herauskommen könne. Es sei damit aber immer ein gewisser Preis verbunden, und es sei wichtig worin er im Einzelnen bestehe. B könne das Wort „sollte“ weder präskriptiv noch universalisierbar formulieren, aber dadurch löse sich der moralische Diskurs auf. Wie ich oben bereits gezeigt habe gehören beide Begriffe zusammen, als alleiniges Teil sind sie moralisch ungültig. B handelt also nicht moralisch wenn er das Wort „ sollte“ verändert oder weglässt. Er verletzt damit die beiden Begriffe Universalisierbarkeit und Präskriptivität. Nach Hare gibt es aber für B noch die Möglichkeit die Wörter zwar normgerecht zu verwenden, sich aber in bestimmten Fällen eines moralischen Urteils zu enthalten. Für Hare gibt es da zwei Varianten. Einerseits kann die Person B es moralisch irrelevant finden, ob sie A ins Gefängnis steckt oder eben nicht.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Richard Hare unter "Universalem Präskriptivismus"?
Es ist eine Moraltheorie, die besagt, dass moralische Urteile zwei wesentliche Merkmale haben müssen: Präskriptivität (vorschreibend) und Universalisierbarkeit (allgemeingültig).
Was bedeutet "Präskriptivität" in Hares Ethik?
Präskriptivität bedeutet, dass moralische Urteile handlungsleitend sind; wer ein Urteil fällt, verpflichtet sich selbst dazu, danach zu handeln.
Warum ist die "Universalisierbarkeit" für moralische Urteile notwendig?
Sie stellt sicher, dass ein Urteil nicht nur für ein Individuum, sondern für alle Personen in einer identischen Situation als Handlungsgrundsatz gelten muss.
Was erklärt das Gläubiger-Schuldner-Beispiel von Hare?
Es zeigt den logischen Widerspruch auf, der entsteht, wenn man eine Handlung für sich beansprucht (jemanden einsperren), aber nicht will, dass dieselbe Regel gegen einen selbst angewandt wird.
Welche Rolle spielen Tatsachen und Vorstellungskraft in dieser Theorie?
Moralische Begründungen erfordern Tatsachen als Basis und geistiges Vorstellungsvermögen, um sich in die Lage der von der Handlung betroffenen Personen zu versetzen.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schmieding (Autor:in), 2008, Präskriptivismus von Richard Hare, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133593