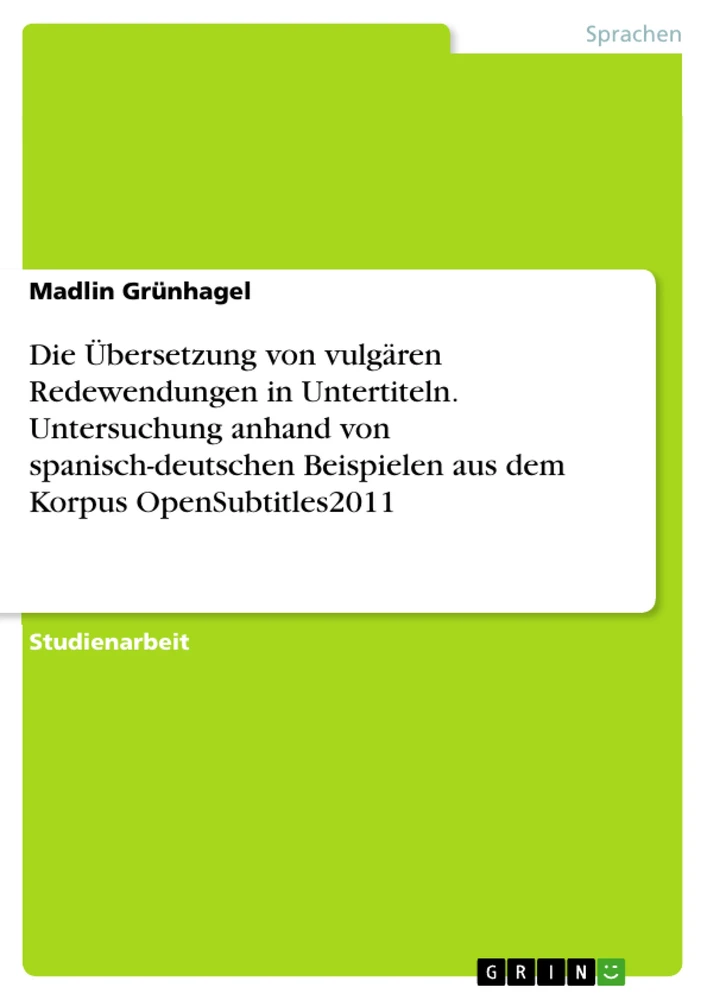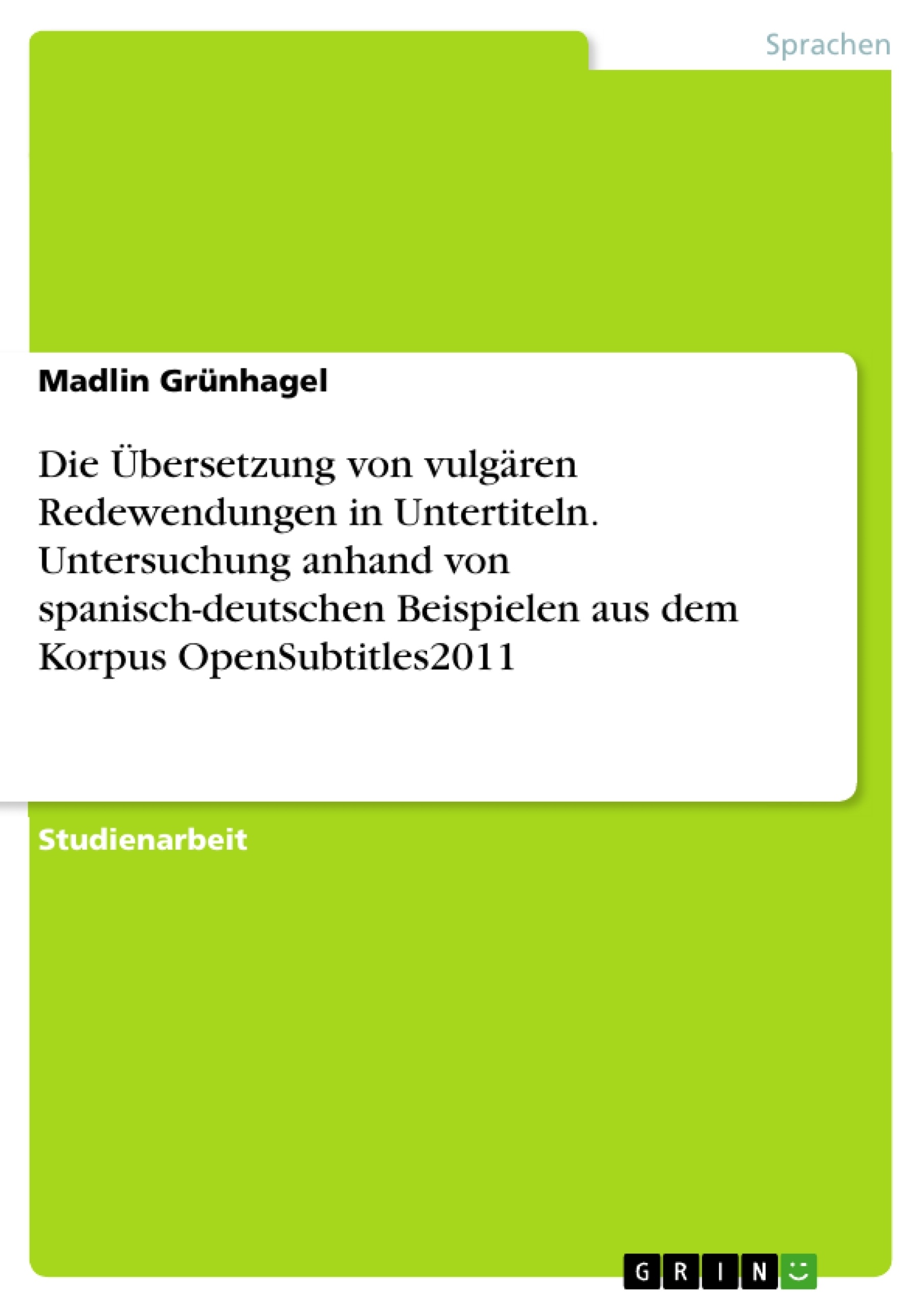Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit vulgären spanischen Redewendungen und mit deren möglichen deutschen Übersetzungen in der Filmuntertitelung. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie sich die Bedeutung von Redewendungen allgemein konstituiert und wie eine geeignete Übersetzungsstrategie von vulgären Redewendungen aussehen könnte. Zudem soll untersucht werden, ob im Deutschen häufig Abschwächungen oder Auslassungen vorkommen. Bei der Analyse der Redewendungen sollen die impliziten Informationen der Redewendungen, die sogenannten Implikaturen, gefunden werden.
Das gewählte Thema ist aus verschiedenen Gründen interessant. Zum einen scheint die Akzeptanz gegenüber vulgären Redewendungen in Spanien weitaus größer zu sein als in Deutschland. Zum anderen entfalte nach Schröpf das geschriebene Wort eine größere Wirkung als das gesprochene. Für die geeignete Übersetzungsstrategie müssen beide Punkte ausreichend berücksichtigt werden, da Übersetzer*innen eine ethische Verantwortung gegenüber allen Beteiligten haben und sie ungewollte Tabubrüche vermeiden sollten.
Im Theorieteil werden die relevanten Begriffe und mögliche Übersetzungsstrategien bei vulgären Redewendungen und Besonderheiten bei Untertiteln dargestellt. Im Praxisteil wird zunächst das Vorgehen der Analyse erläutert. Kernstück der Arbeit bildet die Analyse von 7 spanischen Redewendungen mit den Lemmata „cagar“ bzw. „cojón“. Dazu wurden 10-15 zufällige Beispiele aus dem spanisch-deutschen Korpus OpenSubtitles2011 von Tiedemann (2009), das insgesamt 3 979 alignierte Dokumente bzw. 50,7 Millionen Tokens umfasst, mithilfe des Korpuskompilationswerkzeugs SketchEngine ausgewertet. Für die Analyse wurde das spanisch-deutsche Wörterbuch der Redewendungen von Torrent et al. (2020), kurz SDWDR, sowie das monolinguale Online-Wörterbuch der Real Academia Española, kurz RAE, verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Phraseologie im weiteren und engeren Sinne
- Die Bedeutungskonstitution von Redewendungen
- Einschränkungen und Strategien bei der Übersetzung vulgärer Redewendungen
- Besonderheiten bei der Untertitelung von Filmen
- Praktischer Teil
- Methodologische Überlegungen
- Vorgehen
- Das Korpus OpenSubtitles2011
- Analyse der Übersetzung von vulgären spanischen Redewendungen mit „cagar“ und „cojones“ ins Deutsche
- Me cago en algo o alguien
- Que te cagas
- Cagarse encima una persona
- De cojones
- De los cojones
- Faltarle a alguien cojones
- Estar [bzw. tener] hasta los cojones
- Gesamtauswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übersetzung vulgärer spanischer Redewendungen in deutsche Untertitel, insbesondere anhand von Beispielen aus dem Korpus OpenSubtitles2011. Die Zielsetzung ist die Klärung der Bedeutungskonstitution von Redewendungen im Allgemeinen und die Entwicklung geeigneter Übersetzungsstrategien für vulgäre Ausdrücke im Kontext der Filmuntertitelung. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, inwieweit Abschwächungen oder Auslassungen im Deutschen im Vergleich zum Spanischen üblich sind.
- Bedeutungskonstitution von Redewendungen
- Übersetzungsstrategien für vulgäre Redewendungen
- Kulturelle Unterschiede in der Akzeptanz von Vulgärsprache
- Analyse von Implikaturen in vulgären Redewendungen
- Ethische Aspekte der Übersetzung von Vulgärsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Übersetzung vulgärer Redewendungen in Filmuntertiteln ein und benennt die Forschungsfrage: Wie lassen sich vulgäre spanische Redewendungen angemessen ins Deutsche übertragen? Es wird auf den kulturellen Unterschied in der Akzeptanz von Vulgärsprache zwischen Spanien und Deutschland eingegangen und die ethische Verantwortung der Übersetzer*innen betont. Die Arbeit skizziert den Aufbau und das Vorgehen.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Phraseologie, differenziert zwischen Phraseologie im weiteren und engeren Sinne und erörtert die Bedeutungskonstitution von Redewendungen. Es werden verschiedene Ansätze zur Bedeutungserklärung vorgestellt, wie die „übertragene Bedeutung“ und die „lexikalisierte, aktuelle Bedeutung“. Die Rolle von Kontext und Implikaturen bei der Bedeutungsermittlung wird hervorgehoben, und verschiedene Übersetzungsstrategien und deren Einschränkungen im Umgang mit vulgärer Sprache werden diskutiert. Besonderheiten der Untertitelung von Filmen werden ebenfalls betrachtet.
Praktischer Teil: Der praktische Teil beschreibt die Methodik der Arbeit, die Analyse des Korpus OpenSubtitles2011 und die Auswahl der zu untersuchenden Redewendungen mit den Lemmata „cagar“ und „cojones“. Das Kapitel erläutert detailliert das Vorgehen bei der Analyse der ausgewählten Redewendungen und die verwendeten Hilfsmittel wie das spanisch-deutsche Wörterbuch der Redewendungen und das Online-Wörterbuch der Real Academia Española. Es gibt einen Überblick über die Analyse der einzelnen Redewendungen.
Schlüsselwörter
Vulgärsprache, Redewendungen, Phraseologie, Übersetzung, Untertitelung, Spanisch, Deutsch, OpenSubtitles2011, Implikaturen, Übersetzungsstrategien, Kulturvergleich, Ethische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Übersetzung vulgärer spanischer Redewendungen in deutsche Untertitel
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Übersetzung vulgärer spanischer Redewendungen in deutsche Untertitel, insbesondere anhand von Beispielen aus dem Korpus OpenSubtitles2011. Im Fokus steht die Klärung der Bedeutungskonstitution von Redewendungen und die Entwicklung geeigneter Übersetzungsstrategien für vulgäre Ausdrücke im Kontext der Filmuntertitelung. Es wird auch untersucht, inwieweit Abschwächungen oder Auslassungen im Deutschen im Vergleich zum Spanischen üblich sind.
Welche Redewendungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Übersetzung spanischer Redewendungen mit den Lemmata „cagar“ (z.B. „Me cago en algo o alguien“, „Que te cagas“, „Cagarse encima una persona“) und „cojones“ (z.B. „De cojones“, „De los cojones“, „Faltarle a alguien cojones“, „Estar [bzw. tener] hasta los cojones“) ins Deutsche.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Phraseologie, differenziert zwischen Phraseologie im weiteren und engeren Sinne und erörtert die Bedeutungskonstitution von Redewendungen. Verschiedene Ansätze zur Bedeutungserklärung (übertragene Bedeutung, lexikalisierte, aktuelle Bedeutung), die Rolle von Kontext und Implikaturen, sowie Übersetzungsstrategien und deren Einschränkungen im Umgang mit vulgärer Sprache werden diskutiert. Besonderheiten der Untertitelung von Filmen werden ebenfalls betrachtet.
Welche Methodik wird angewendet?
Der praktische Teil beschreibt die Methodik der Arbeit, die Analyse des Korpus OpenSubtitles2011 und die Auswahl der zu untersuchenden Redewendungen. Das Vorgehen bei der Analyse wird detailliert erläutert, ebenso die verwendeten Hilfsmittel wie das spanisch-deutsche Wörterbuch der Redewendungen und das Online-Wörterbuch der Real Academia Española.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil mit der Analyse der ausgewählten Redewendungen und ein Fazit. Der theoretische Teil behandelt die Bedeutungskonstitution von Redewendungen und Übersetzungsstrategien für vulgäre Ausdrücke. Der praktische Teil beschreibt die Methodik und die Analyse der ausgewählten Beispiele. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vulgärsprache, Redewendungen, Phraseologie, Übersetzung, Untertitelung, Spanisch, Deutsch, OpenSubtitles2011, Implikaturen, Übersetzungsstrategien, Kulturvergleich, Ethische Aspekte.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie lassen sich vulgäre spanische Redewendungen angemessen ins Deutsche übertragen?
Welche ethischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit betont die ethische Verantwortung der Übersetzer*innen beim Umgang mit vulgärer Sprache und berücksichtigt kulturelle Unterschiede in der Akzeptanz von Vulgärsprache zwischen Spanien und Deutschland.
Welches Korpus wird verwendet?
Als Korpus dient OpenSubtitles2011.
- Citation du texte
- Madlin Grünhagel (Auteur), 2021, Die Übersetzung von vulgären Redewendungen in Untertiteln. Untersuchung anhand von spanisch-deutschen Beispielen aus dem Korpus OpenSubtitles2011, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1336131