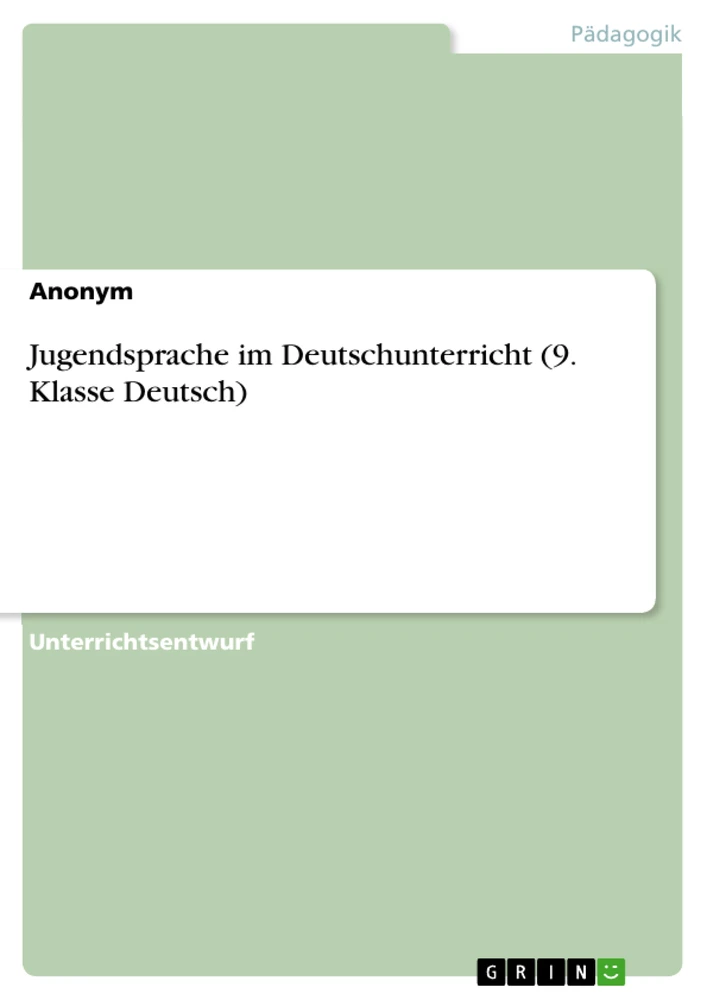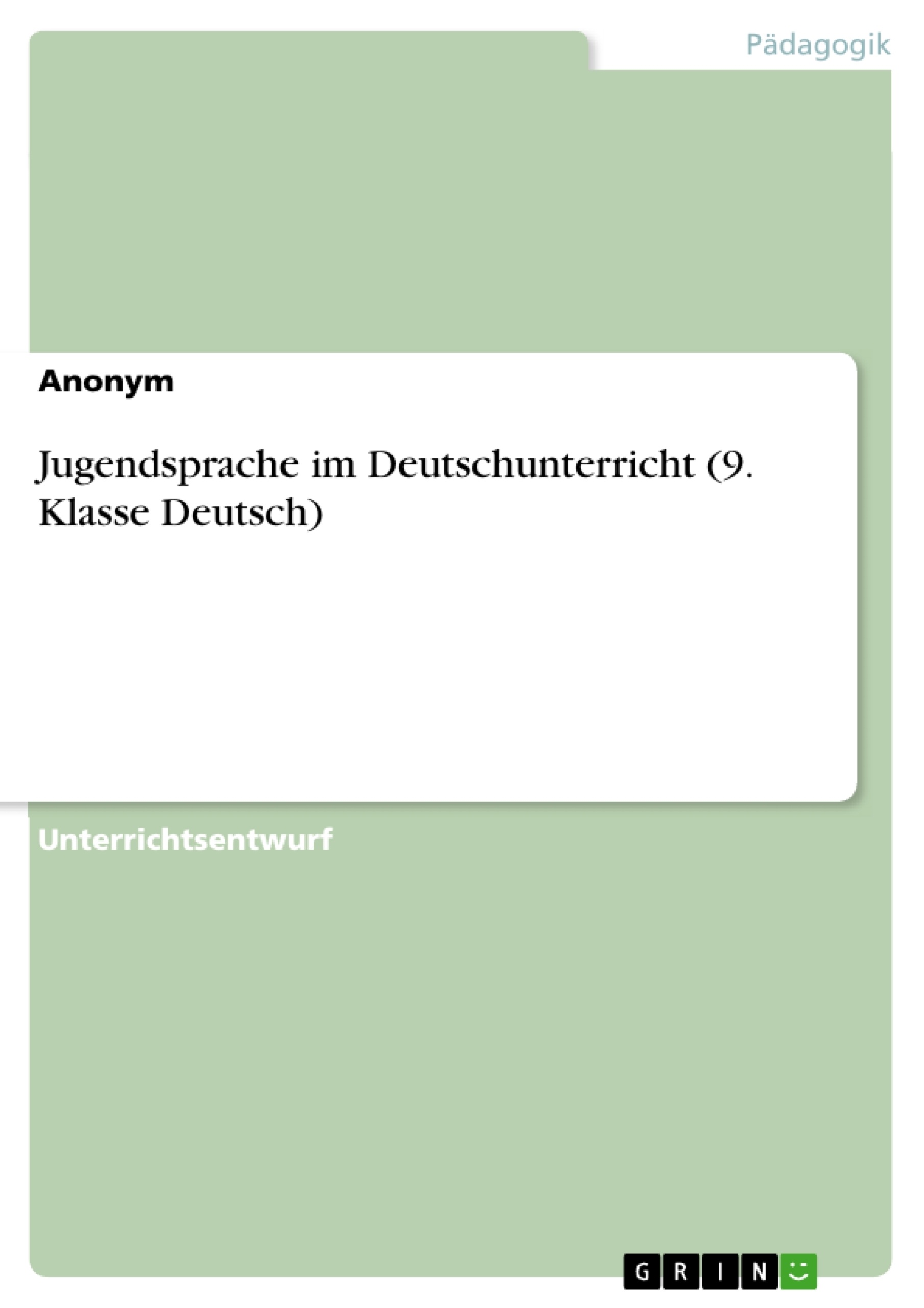Der folgende Unterrichtsentwurf widmet sich dem Thema „Jugendsprache“. Die Jugendsprache betrifft den Alltag von Lehrer:innen sowie Schüler:innen oder auch die jüngeren Geschwister, nicht zuletzt Social-Media. Da Sprachausbildung vor allem in der Schule stattfindet, ist die Thematik besonders für Deutschlehrkräfte wichtig. Unter Jugendsprache versteht man die individuelle Sprechweise von Jugendlichen, die von der Standardsprache abweicht. Demnach wird die Sprache junger Menschen durch die soziale Interaktion geprägt, die durch gemeinsame Interessen, gemeinsame soziale Aktivitäten und enge Freundschaften gekennzeichnet ist. Die Jugendlichen entwickeln neue Sprachgewohnheiten, damit sie sich in der Phase der Pubertät bewusst von den Erwachsenen und deren gesellschaftlich-kulturellen Wertvorstellungen abgrenzen können oder über einen gemeinsamen sprachlichen Code sich ihrer Peergroup zugehörig fühlen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Unterrichtseinheit
- 2.1 Planung/Überblick gebende Verlaufsskizze
- 2.2 Bedingungsanalyse
- 2.3 Einordnung der 3./4. Stunde in die Unterrichtsreihe
- 2.4 Sachanalyse
- 2.5 Didaktische Analyse
- 2.5.1 Bezug zum Bildungsplan
- 2.5.2 Kompetenzen/ Lehr-Lernziele
- 2.6 Methodische Analyse
- 3. Reflexion/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Unterrichtsentwurf befasst sich mit dem Thema „Jugendsprache“ und zielt darauf ab, die Bedeutung und Funktion dieser Sprachvarietät im Deutschunterricht zu verdeutlichen. Dabei sollen die SchülerInnen die verschiedenen Sprachvarietäten erkennen, voneinander unterscheiden und deren Wirkungsweisen reflektieren können.
- Analyse der Jugendsprache und ihrer Merkmale
- Unterscheidung von Jugendsprache und Standardsprache
- Bedeutung von Sprachvarietäten für die sprachliche Bildung
- Sprachbewusstheit und Sprachkompetenz fördern
- Sprachliche Kreativität und Rollenspiele im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Jugendsprache“ vor und erläutert seine Relevanz für den Deutschunterricht. Die Unterrichtseinheit gliedert sich in verschiedene Phasen und umfasst eine detaillierte Planungsskizze. Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung der verschiedenen Sprachvarietäten, die durch verschiedene Medien wie YouTube-Videos vorgestellt und analysiert werden. Die SchülerInnen sollen gemeinsam wichtige Merkmale der Sprachvarietäten herausarbeiten und diese in Gruppenarbeit erörtern. Ziel ist es, die SchülerInnen zu befähigen, die verschiedenen Sprachvarietäten zu erkennen, voneinander zu unterscheiden und deren Bedeutung für die sprachliche Bildung zu reflektieren.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachvarietäten, Standardsprache, Umgangssprache, Dialekt, Sprachbewusstheit, Sprachkompetenz, Sprachliche Kreativität, Unterrichtsentwurf, Deutschunterricht, Bildungsplan, Medien, YouTube-Videos.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2023, Jugendsprache im Deutschunterricht (9. Klasse Deutsch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1336141