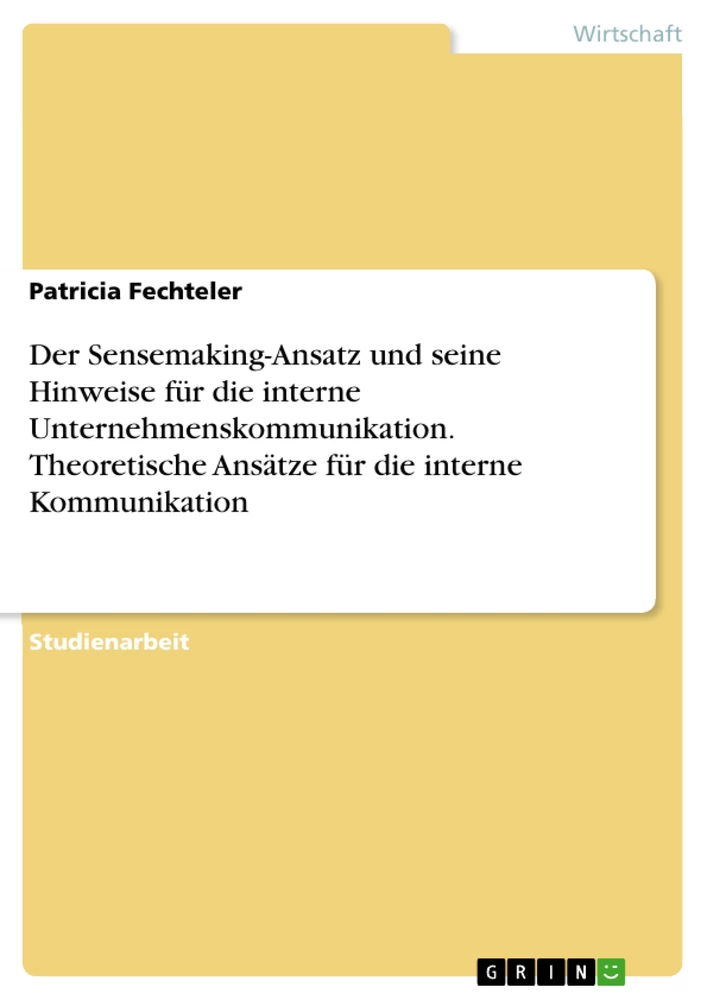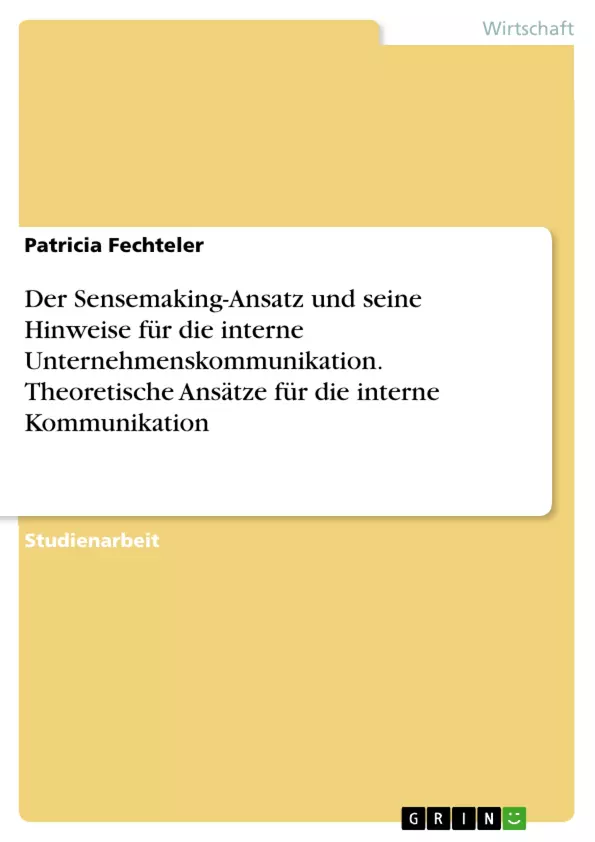Ziel dieser Arbeit ist es, den Sensemaking-Ansatz mit seinen Elementen und in seiner Komplexität zu verstehen und Hinweise für die interne Kommunikation abzuleiten. Zunächst soll hierzu in Kapitel zwei das Konstrukt des Sensemaking-Prozesses sowohl allgemein als auch die Perspektive von Karl E Weick auf den Prozess abgebildet werden. Im anschließenden dritten Kapitel wird der Sensemaking-Ansatz in Bezug auf Organisationen betrachtet. Es werden der Organisationsbegriff nach Karl E. Weick erläutert und die Herausforderungen in diesem Zusammenhang identifiziert. Das vierte Kapitel schlägt schlussendlich die Brücke zur internen Kommunikation. Es wird erörtert, welche Schnittpunkte bestehen, was die interne Kommunikation vom Sensemaking-Ansatz lernen kann und wie sie ihn für sich nutzen kann. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.
Die Idee von Organisationen reicht weit in der Geschichte zurück und kann vielschichtig ausgelegt werden. Von der Sportgruppe bis hin zum Unternehmen kann von Organisation die Rede sein. Im Laufe der Zeit wurden hierzu verschiedenste Theorien entwickelt. Eines der bedeutsamsten und aktuellsten Themen auf dem Gebiet der Organisationsforschung ist die Auseinandersetzung mit Veränderungen oder auch Wandel in Organisationen. Wenn eine substanzielle Veränderung der sogenannten Ordnung der Wirklichkeit eintritt, die die Organisation betrifft, wird von organisationalem Wandel gesprochen.
Durch Wandelprozesse können bei den Mitgliedern der entsprechenden Organisation Irritationen und Unsicherheiten hervorgerufen werden. Mit diesem Phänomen der neuen Wirklichkeitsbewertung setzt sich der Sensemaking-Ansatz von Karl E. Weick unter anderem auseinander. Der Sensemaking-Ansatz fügt sich in eine Reihe von organisationstheoretischen Modellen und Ansätzen ein und wird den modernen Organisationstheorien zugeordnet.
Auch in der internen Kommunikation ist der Wandel aktuell eines der zentralen Themen und erfährt starken Bedeutungszuwachs. Die interne Kommunikation wird mehr denn je als entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg angesehen. Sie zählt zu den am stärksten wachsenden Bereichen der Unternehmenskommunikation. Welche Rolle könnte die interne Kommunikation im Rahmen von Wandel, allgemeiner Irritation und Sensemaking-Theorien haben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie des Sensemaking-Ansatzes
- Allgemeiner Sensemaking-Prozess
- Sensemaking nach Karl E. Weick
- Sensemaking-Ansatz in Organisationen
- Organisationsbegriff und Sensemaking beim Organisieren nach Karl E. Weick
- Herausforderungen des Sensemaking beim Organisieren
- Scheitern des Sensemaking-Prozesses im Falle Serebriers
- Sensemaking und seine Hinweise für die interne Kommunikation
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, den Sensemaking-Ansatz mit seinen Elementen und in seiner Komplexität zu verstehen und Hinweise für die interne Kommunikation abzuleiten.
- Der Sensemaking-Prozess und seine Bedeutung für die Organisation
- Der Einfluss des Sensemaking-Ansatzes auf die interne Kommunikation
- Herausforderungen des Sensemaking-Prozesses in Organisationen
- Die Rolle der internen Kommunikation bei der Bewältigung von Wandel und Unsicherheit
- Praxisbeispiele für den Einsatz des Sensemaking-Ansatzes in der internen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Sensemaking-Ansatz als ein wichtiges Konzept in der Organisationsforschung vor und beleuchtet dessen Relevanz für die interne Kommunikation in Zeiten des Wandels.
- Theorie des Sensemaking-Ansatzes: Dieses Kapitel beschreibt den Sensemaking-Prozess allgemein und im Speziellen nach Karl E. Weick. Es werden die zentralen Elemente und Prinzipien des Ansatzes erläutert.
- Sensemaking-Ansatz in Organisationen: Hier wird der Organisationsbegriff nach Karl E. Weick betrachtet und die Herausforderungen des Sensemaking-Prozesses in Organisationen beleuchtet. Das Scheitern des Sensemaking-Prozesses im Falle Serebriers wird als Beispiel analysiert.
Schlüsselwörter
Sensemaking, interne Kommunikation, Organisationstheorie, Wandel, Irritation, Karl E. Weick, Organisationsbegriff, Unternehmenskommunikation, Kommunikation, Unternehmenserfolg
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Karl E. Weick unter "Sensemaking"?
Sensemaking beschreibt den Prozess, wie Menschen in Organisationen unklaren Situationen Sinn verleihen, um handlungsfähig zu bleiben.
Warum ist Sensemaking für die interne Kommunikation wichtig?
In Zeiten von Wandel und Unsicherheit hilft die interne Kommunikation dabei, Irritationen abzubauen und eine gemeinsame neue Wirklichkeitsbewertung zu fördern.
Was sind die Herausforderungen beim "Organisieren" nach Weick?
Die größte Herausforderung ist die Bewältigung von Komplexität und die Vermeidung des Scheiterns von Sinnstiftungsprozessen bei organisationalem Wandel.
Wie kann die interne Kommunikation den Sensemaking-Ansatz nutzen?
Sie kann als Moderator fungieren, um den Austausch zu fördern und Informationen so aufzubereiten, dass sie den Mitarbeitern bei der Sinnstiftung helfen.
Was passiert, wenn der Sensemaking-Prozess scheitert?
Ein Scheitern führt zu Handlungsunfähigkeit, Demotivation und einem Verlust der organisationalen Ordnung, wie am Fallbeispiel Serebrier erläutert wird.
- Quote paper
- Patricia Fechteler (Author), 2018, Der Sensemaking-Ansatz und seine Hinweise für die interne Unternehmenskommunikation. Theoretische Ansätze für die interne Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1336146