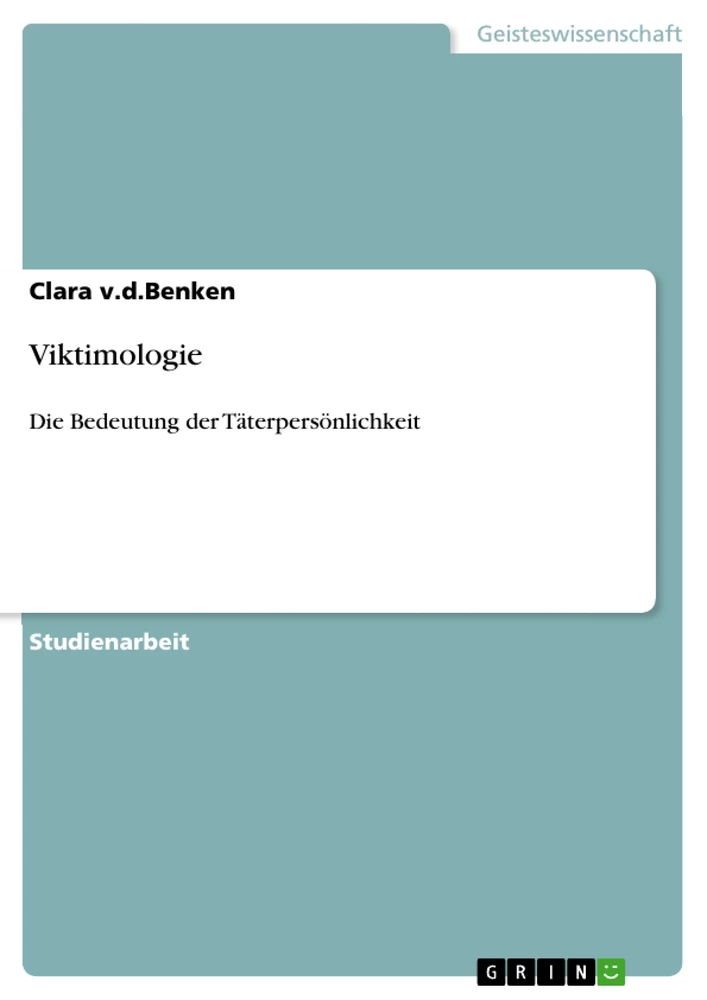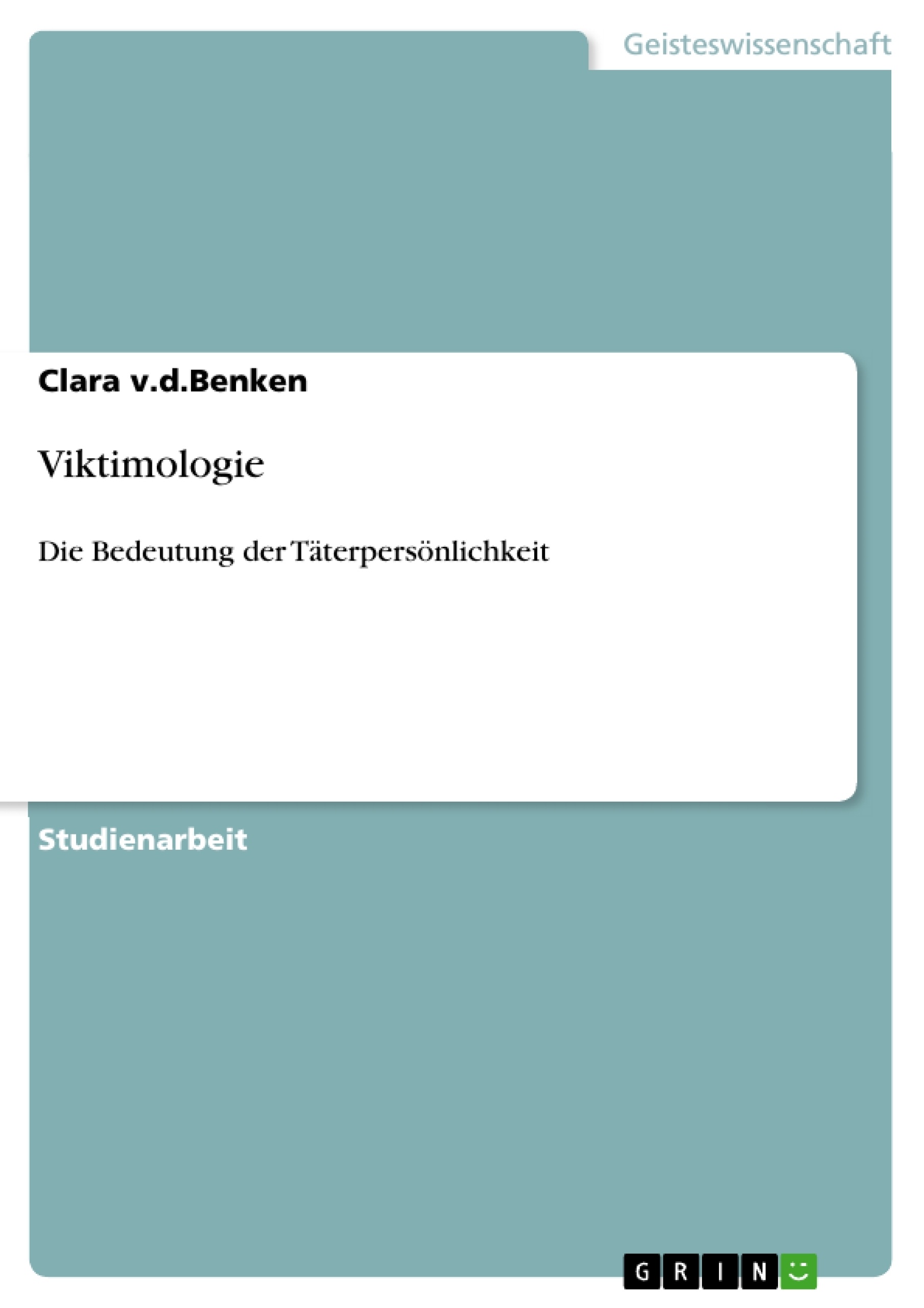Eine ausführliche Ausarbeitung über die Persönlichkeiten eines Täters.
Wie wird man zum Täter?
Eine Auseinandersetzung, die viele Informationen und Fakten gibt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Täter
1. Definition
2. Täterbild
3. Täterentwicklung
1. Entstehung
2. Verhalten
4. Täterstrategien
1. Innerhalb der Familie
2. Außerhalb der Familie
5. Täterprofile
1. Infantiler Täter
2. Ödipaler Täter
3. Pubertärer Täter
4. Adoleszenter Täter
5. Allwissender Täter
6. Geisteskranker Täter
7. Seniler Täter
8. Unberechenbarer Täter
6. Frauen als Täter
1. Tabuisierung
2. Entstehung und Gründe
7. Täter-Opfer Ausgleich
8. Therapiemöglichkeiten
1. Medikamente
2. Delikt Rekonstruktion
3. Empathieübung
4. Rückfälligkeit
9. Resümee
10. Literaturverzeichnis
Prüfungsleistung: Viktimologie – Die Bedeutung der Täterpersönlichkeit
1. Einleitung
Als meine Gruppe und ich uns entschieden, ein Referat über Viktimologie zu halten, wussten wir zuerst nicht recht, wo wir anfangen sollten. So unterteilten wir das Thema: Viktimologie im engeren Sinne, Opfer und Täter.
Wir entschlossen, uns in der Opferkunde hauptsächlich auf Vergewaltigung zu spezialisieren. Ich habe mich für den Teil des Täters entschieden und versuche nun, die wichtigsten Fragen, die gestellt werden, wenn man von einer Tat in den Medien erfährt, wie zum Beispiel: „Warum kann jemand so etwas Grausames tun?“, zu beantworten.
Vergewaltigung im allgemeinen kann jedem Menschen passieren. Doch in den letzten Jahren hörte man immer öfter von Vergewaltigungen und Missbrauch an Kindern, was mich angeregt hat, mehr darüber zu berichten und darauf aufmerksam zu machen.
2. Täter
2.1. Definition:
Schaut man in ein Lexikon, so wird dort der Täter definiert als eine Person, der eine Tat selbst (eigenhändige, unmittelbare Täterschaft), durch einen anderen (mittelbare Täterschaft) oder mit einem anderen gemeinschaftlich (Mittäterschaft) begeht (§ 25 StGB). Ein mittelbarer Täter benutzt zur Verwirklichung eines Verbrechens eine andere Person, die z. B. wegen Schuldunfähigkeit nicht als unmittelbarer Täter verantwortlich gemacht werden kann.[1]
2.2.Täterbild
Wer sind die Täter und was macht sie dazu?[2]
Diese Frage kommt oft genug auf. In den Nachrichten wird immer wieder über neue Verbrechen berichtet.
Sicherlich kann man sich daran erinnern, wie früher die Eltern vor dem bösen Mann warnten, der Kinder überreden wollte, mit ins Auto einzusteigen.
Doch schon lange hat sich diese Vorstellung als falsch erwiesen, denn die Täter sind nicht, wie angenommen, psychisch krank, unattraktiv oder pervers. Nein, im Gegenteil: Die Missbrauchstäter sind ganz normale Menschen, die keine psychisch krankhaften Befunde aufweisen. Sie sind sogar sehr klug, denn sie wissen genau, was sie tun und planen ihre Gewalttaten sehr sorgfältig, damit ihre Straftaten nicht direkt aufgedeckt werden.
Meist ist der Täter dem Opfer kein Fremder, sondern eher eine Vertrauensperson, sehr oft sind es sogar Verwandte aus dem eigenen Familienkreis.
Die Täter sind zu 90% männlich. Circa 70% sind Väter oder Stiefväter der Opfer. Circa 10% sind weiblich, womit man eigentlich nicht rechnet, da es erst in den letzten Jahren aufgedeckt wurde.
Sie sind in allen Gesellschaftsschichten vertreten und somit kann man keine spezielle soziale Herkunft festmachen.
Das bedeutet, dass man in allen Schichten mit Tätern zu tun haben kann, sei es in der eigenen Familie oder im Freundes- und Nachbarkreis.
3. Täterentwicklung
3.1. Entstehung
Es gibt viele Entstehungsmöglichkeiten, die jedoch bei jedem Täter verschieden sind.
Eine Möglichkeit ist die Folge der männlichen Sozialisation. Dadurch, dass der Täter ein Teil der männlichen Gesellschaftsordnung ist, setzt er sich stark unter Druck und glaubt, dass er über eine andere Person Macht ausüben muss, um sich selbst zu behaupten.
Eine andere Möglichkeit ist die eines machtlosen Menschen, der sich selbst durch sexuelle Gewalt mehr Macht und Stärke beweisen muss, um so dieses Problem zu kompensieren.
Eine dritte Möglichkeit ist, dass Täter selbst in ihrer Kindheit Opfer einer Vergewaltigung geworden sind und versuchen, durch sexuelle Gewalt die eigenen Opfererfahrungen und Ohnmachtsgefühle, die durch das damalige traumatische Erlebnis entstanden sind, zu überwinden.
Die Medien spielen in der Entstehung eine verstärkende Rolle, denn sie haben einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Medien, die viele gewaltverherrlichende Serien zeigen, gewöhnen uns immer mehr an die Gewalt und so verlieren wir die Emotionalität und den Bezug zur Realität, sodass die Fantasien eines Täters immer stärker werden können.
3.2. Verhalten
Da Täter, wie oben beschrieben, keine Emotionen spüren, sind sie unfähig, ihre Bedürfnisse von denen eines Kindes zu unterscheiden. Zeigt das Kind zum Beispiel typisch kindliche Bedürfnisse nach Zuneigung und Geborgenheit, so beziehen Täter diese Reaktion, im eigenen Interesse, auf das Verlangen des Kindes nach sexuellem Kontakt.
Viele Täter, die männliche Opfer haben, sind nicht homosexuell. Im Gegenteil, meistens sind sie sogar verheiratet und leben in einer glücklichen Beziehung mit einer Frau.
Von den Tätern sind schon jetzt 1/3 Jugendliche unter 21 Jahren und diese Zahlen werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr steigen. 2/3 sind Erwachsene.
4. Täterstrategien
Wie bereits festgestellt wurde, kannten sich 2/3 der Opfer und Täter bereits vor der Tat, oft sind die beiden miteinander verwandt.
Mehr als die Hälfte der Täter kommt aus dem direkten Familienkreis (Vater(figur), Bruder, Großvater, Mutter, Schwester, Großmutter) und nur 6% sind dem Opfer vorher unbekannt.
4.1. Innerhalb der Familie
Warum die Prozentzahl für Vergewaltigung innerhalb der Familien so hoch ist, lässt sich schnell erklären.
Für den Täter stellt sich kein großes Problem dar, ständig Situationen „herbeizuführen“, in denen er mit dem Kind ungestört sein kann. So kann er zum Beispiel vorgeben, mit dem Kind die Hausaufgaben zu machen und dazu in einen stillen Raum gehen oder beim abendlichen Gang ins Bad mithelfen.
Das Kind steht unter der Verfügungsgewalt des Täters, der so den Tagesablauf des Kindes, natürlich im eigenen Interesse, bestimmen kann.
[...]
[1] (http://lexikon.meyers.de/meyers/T%C3%A4ter)
[2] May, A. 1997: Nein ist nicht genug
- Arbeit zitieren
- Clara v.d.Benken (Autor:in), 2008, Viktimologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133699