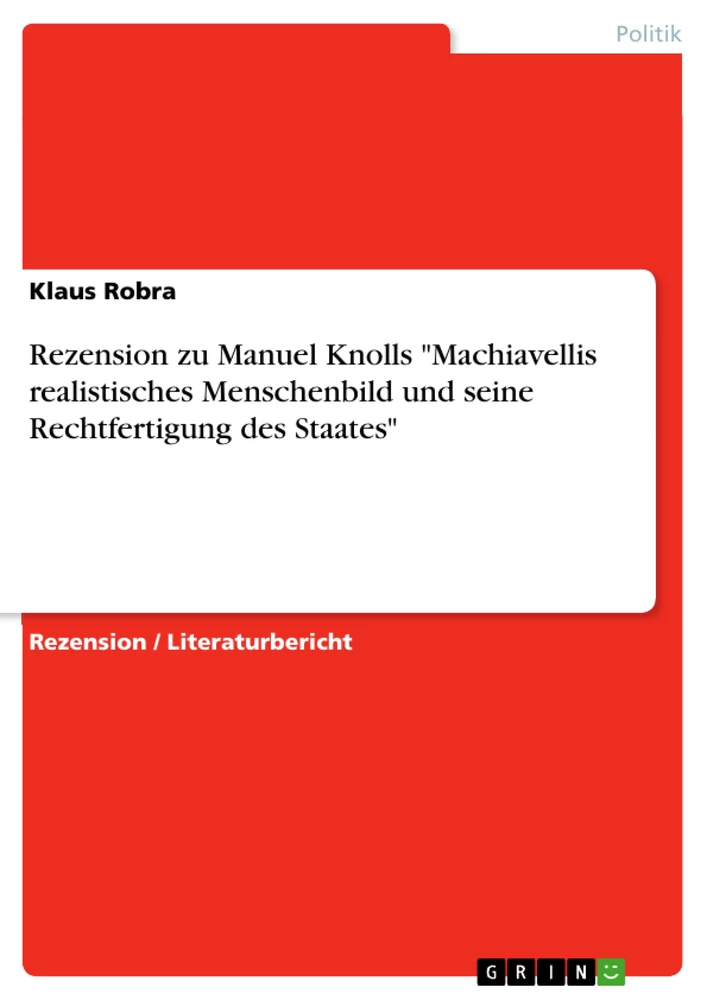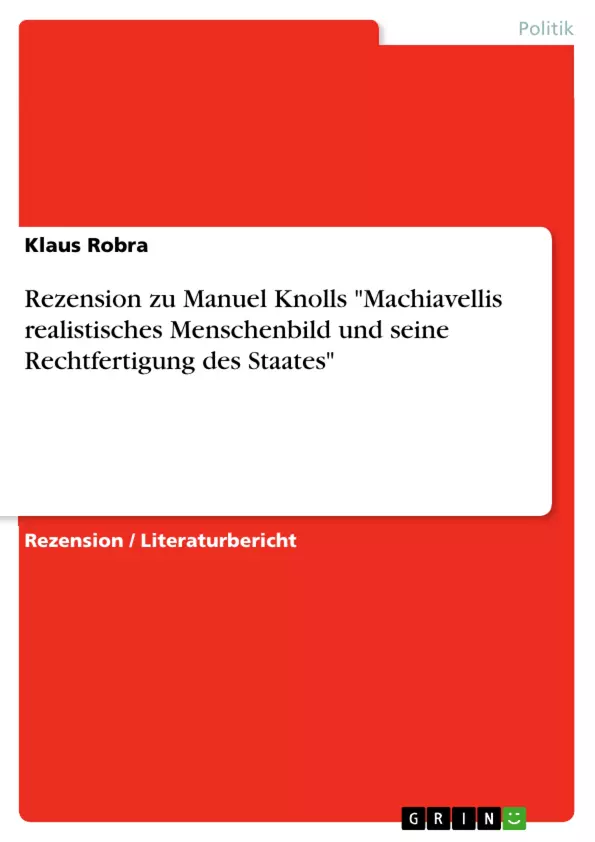Niccoló Machiavelli (1469-1527) sieht die bedeutendste Antriebskraft der Geschichte in der angeblich konstanten Bosheit der Menschen sowohl im individuellen als auch im kollektiven Leben. In seinem Aufsatz über "Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates" behauptet Manuel Knoll (2018), das Menschenbild des Florentiners sei – entgegen vorherrschender Meinungen – weder pessimistisch noch optimistisch, sondern realistisch, wobei er als Grundvoraussetzung „die Unwandelbarkeit der menschlichen Natur“ annehme, durch die „eine wissenschaftliche Analyse der Politik“ überhaupt erst möglich werde. Weil die „Menschen prinzipiell „böse“ seien, halte Machiavelli, ähnlich wie später Thomas Hobbes, einen starken Staat für erforderlich, der in der Lage sei, „die menschliche Natur umzugestalten und den Menschen zu verbessern“.
Rezension zu:
Manuel Knoll: Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates (2018) 1
Seit langem herrscht Uneinigkeit darüber, was als „Motor der Geschichte“, ihre grundlegende Antriebskraft, anzusehen sei. In jüdisch-christlicher Tradition ist es zweifellos der Schöpfergott, von dem erwartet wird, dass er eines Tages das Reich Gottes auf Erden heraufführen werde. – Ähnlich universalistisch argumentiert man im Marxismus, ersetzt aber Gott durch die gesellschaftliche Arbeit mit dem Ziel eines Reichs der Freiheit in einer Klassenlosen Gesellschaft.
Dagegen lehnt Karl R. Popper jede Art von Universalismus strikt ab und fordert stattdessen eine „Sozialtechnik der kleinen Schritte“, um möglichst vielen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.2
All dessen ungeachtet sehen strenggläubige Christen und Moslems Antrieb und Ziel der Geschichte ausschließlich in der Anbetung der Gottheit, d.h. Jesu bzw. Allahs.3 – Noch bescheidener wirkt die These des Soziologen Emmanuel Todd, die Familie sei eine „unbewusste Antriebskraft der Gesellschaft“, und erscheint dabei wesentlich seriöser als die Behauptung, diese Kraft sei in der internationalen Seefahrt zu suchen. ...4
Von dem „Motor gesellschaftliche Arbeit“ erwartete Marx die zwangsläufige Errichtung des Reichs der Freiheit (s.o.) – was aber bis heute nicht eingetreten ist. Und auch „das Reich Gottes“ ist nicht in Sicht. Eher schon gibt es gewisse Erfolge der Popperschen Sozialtechnik, wenn auch nicht im globalen Maßstab (s.u.).
Niccoló Machiavelli (1469-1527) sieht die bedeutendste Antriebskraft der Geschichte in der angeblich konstanten Bosheit der Menschen, und zwar sowohl im individuellen als auch im kollektiven Leben. In seinem Aufsatz über Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates behauptet Manuel Knoll (2018), das Menschenbild des Florentiners sei – entgegen vorherrschender Meinungen – weder pessimistisch noch optimistisch, sondern realistisch, wobei er als Grundvoraussetzung „die Unwandelbarkeit der menschlichen Natur“ annehme, durch die „eine wissenschaftliche Analyse der Politik“ überhaupt erst möglich werde.5 Weil die „Menschen prinzipiell „böse“ seien, halte Machiavelli, ähnlich wie später Thomas Hobbes, einen starken Staat für erforderlich, der in der Lage sei, „die menschliche Natur umzugestalten und den Menschen zu verbessern“. (Knoll a.a.O. ebd.)
Schon hier aber zeigt sich bei Machiavelli ein Widerspruch, den Knoll anscheinend übersehen hat: Wenn die menschliche Natur „unwandelbar“ böse ist, kann sie weder umgestaltet noch verbessert werden. Machiavelli selbst hat versucht, diesen Widerspruch aufzulösen, indem er zu unterscheiden versuchte zwischen der „Konstanz“ der menschlichen Natur, die zugleich eine „Konstanz der Geschichte“ sei, und dem tatsächlichen, oft „wankelmütigen“ Verhalten der Menschen. Wobei sich aber ein neuer Widerspruch dadurch ergibt, dass Machiavelli auch die Wankelmütigkeit als Teil der konstanten „Bosheit“ der Menschen ansieht, denn man könne „von den Menschen im allgemeinen sagen, daß sie undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig … sind“.6
Konstant bösartig seien jedenfalls „Ehrgeiz und Habgier“. Dennoch sei ein guter Staat in der Lage, dem entgegenzuwirken, und zwar vor allem durch eine gute Verfassung mit einer hochintelligenten und zugleich skrupellosen Führungs- persönlichkeit an der Spitze des Staates.
Ein solcher Staat werde auch für gute und sinnvolle Erziehung sorgen. Gute Erziehung werde durch „gute Gesetze“ erreicht, und gute Erziehung führe zu „hervorragender Tüchtigkeit“.7 Wobei sich wiederum die Frage stellt, wie solches möglich sein soll, wenn die menschliche Natur zugleich für „unwandelbar“ gehalten wird.
Manuel Knoll kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, Machiavelli habe den Staat sehr wohl als „moralische Instanz“ gerechtfertigt. Verfehlt sei daher die häufig anzutreffende Interpretation, Machiavelli habe Politik und Moral voneinander getrennt, die Devise „der Zweck heiligt die Mittel“ über alles andere gestellt.
Kritische Würdigung
Der Machiavellismus hat nachweislich nicht nur Nietzsche, sondern auch Lenin und den Bolschewismus und insbesondere Faschisten und Nazis beeinflusst. Auch im (Neo-)Liberalismus hat er Spuren hinterlassen. Umso mehr ist eine kritische Auseinandersetzung mit ihm geboten, auch wenn ich hier die – eher geringen – Unterschiede zwischen dem Machiavellismus und den tatsächlichen Auffassungen Machiavellis nicht analysieren kann.
Tatsächlich behauptet Machiavelli, die Menschen würden nur dann Gutes tun, wenn sie „von der Not (necessità)“ dazu gezwungen würden.8 Im Vergleich zur Antike zeichne sich der Mensch seiner Zeit nicht durch Stärke, sondern durch Schwäche aus. Der Grund hierfür liege vor allem im Einfluss des Christentums mit seiner Geringschätzung der diesseitigen Welt zu Gunsten des Jenseits:
„Das Christentum >läßt uns die Ehren dieser Welt weniger schätzen, während die Heiden diese sehr hoch schätzten, ihr höchstes Gut darin erblickten und deshalb in ihren Taten viel kühner waren< (Machiavelli…). Während das Heidentum die Welt bejaht und Männer von weltlichem Ruhm heiligspricht, verneint das Christentum die diesseitige Welt und verherrlicht die demütigen und kontemplativen Menschen statt den tatkräftigen.“9
Historisch trifft diese Behauptung jedoch nur einen Teil der Wahrheit. Jesus hat die Gleichheit aller Menschen vor Gott verkündet und damit den Weg geebnet für die moderne Auffassung der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Ferner: Wie hätten ein Karl der Große oder auch Otto der Große ihre christlich geprägten Reiche gründen und konsolidieren können, wenn in diesen nur „schwächliche Erziehung“ und Jenseitsbezogenheit geherrscht hätten? Weitere Beispiele lassen sich auch aus späterer Zeit anführen, so im Hinblick auf die Weltreiche Großbritanniens und der USA. Zutreffend scheint, dass Christentum und Kapitalismus mehr oder weniger unheilige Allianzen eingehen und dennoch beachtliche Erfolge erzielen können.
Machiavellis Grundfehler: Er verkennt den Anteil positiver Eigenschaften und Fähigkeiten an der menschlichen „Natur“ (die ja wesentlich auch Kultur ist!), zumal dann, wenn er – widersprüchlich – dieser Natur einerseits bösartige Konstanz und andererseits durchaus auch schöpferische Fähigkeiten zuschreibt.10 Wenn Menschen zu Nächstenliebe, Selbsterhaltung, Altruismus, Kooperation, gegenseitiger Hilfe und erfolgreicher Team-Arbeit fähig sind, so keineswegs nur als Antworten auf Notlagen oder pure Notwendigkeiten. Vielmehr gehören diese positiven Eigenschaften zum genetischen, d.h. aus dem Tierreich stammenden, angeborenen Erbe der Menschheit11 – ohne dass deshalb die ebenfalls angeborenen Aggressions- und Zerstörungstriebe zu leugnen wären.
Es hat sich zudem immer wieder gezeigt, dass der Zweck die Mittel nicht heiligt. Wenn Diktatoren unschuldige Menschen umbringen lassen, dann sind dies Verbrechen, auch wenn mit diesen noch so angeblich hehre Ziele verfolgt wurden. Fernziele und Nahziele müssen miteinander vereinbar sei. Kriminelle Mittel lassen sich nicht rechtfertigen.
Im privaten wie im öffentlichen Leben kommt es wohl darauf an, der teilweise von Gegensätzen geprägten Triebstruktur des Menschen in möglichst allen zuträglicher, vernünftiger Art und Weise gerecht zu werden. Ein „starker Staat“ genügt für diese Aufgabe nicht, langfristig erst recht nicht. Vieles hängt davon ab, ob es gelingt, neue, progressive Gesellschaftsformen – Formen des gedeihlichen Miteinanders – zu entwickeln, in denen alle Menschen ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß leben und arbeiten können. Näheres hierzu habe ich mehrfach dargelegt (u.a. GRIN-Verlag, München 2017, 2020, 2023).
Literaturhinweise
Bauer, Joachim 2008: Das kooperative Gen. Abschied vom Darwinismus, Hamburg
Habermann, Ernst 1996: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars, geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU 1996_S?9_38...
Knoll, Manuel 2018: Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates, in: https://core.ac.uk/download/pdf/162654347.pdf, S. 182-201
Robra, Klaus 2017: Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demo-kratischen Öko-Sozialismus, München, http://www.grin.com/de/e-book/375344/.
[...]
1 In: https://core.ac.uk/download/pdf/162654347.pdf
2 Vgl. K. R. Popper: Hat die Weltgeschichte einen Sinn? In: www.home.uni-osnabrück.de>uwmeyer>lehre
3 s. https://herznuggets.wordpress.com/2014/01/06/der-motor-der-gesch... bzw. www.religiondesislam.de>der-sinn-des-lebens-antwort-vom-islam
4 vgl. https://www.tagesspiegel.de/kultur/ist-die-familie-der-motor-der-geschichte-5544991.html bzw.: www.sh-ugeaviscu.dk>24>der-motor-der-geschichte-die-seefahrt
5 Vgl. Knoll 2018, Zusammenfassung (S. 182)
6 Machiavelli, in: Knoll a.a.O. S. 186
7 Machiavelli, in: Knoll a.a.O. S. 195
8 In: Knoll a.a.O. S. 194. Wobei anzumerken ist, dass ‚ necessità‘ auch ‚Notwendigkeit‘ bedeutet.
9 Knoll a.a.O. S. 197
10 Vgl. Knoll a.a.O. S. 188
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus von Manuel Knolls Aufsatz über Machiavellis Menschenbild?
Manuel Knolls Aufsatz konzentriert sich auf Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates. Knoll argumentiert, dass Machiavellis Menschenbild weder pessimistisch noch optimistisch, sondern realistisch ist, basierend auf der Annahme der Unwandelbarkeit der menschlichen Natur.
Welche Rolle spielt die menschliche Natur in Machiavellis politischer Theorie laut Knoll?
Laut Knoll betrachtet Machiavelli die menschliche Natur als grundsätzlich "böse". Dies erfordert einen starken Staat, der in der Lage ist, die menschliche Natur umzugestalten und zu verbessern. Diese Annahme ermöglicht eine wissenschaftliche Analyse der Politik.
Welchen Widerspruch findet der Rezensent in Knolls Darstellung von Machiavellis Menschenbild?
Der Rezensent sieht einen Widerspruch darin, dass Machiavelli einerseits die Unwandelbarkeit der menschlichen Natur betont, andererseits aber die Möglichkeit ihrer Umgestaltung und Verbesserung durch den Staat annimmt.
Wie bewertet Knoll Machiavellis Haltung zur Moral in der Politik?
Knoll kommt zu dem Schluss, dass Machiavelli den Staat durchaus als moralische Instanz gerechtfertigt hat. Er verwirft die Interpretation, dass Machiavelli Politik und Moral getrennt und die Devise "der Zweck heiligt die Mittel" über alles gestellt habe.
Welchen Einfluss hatte Machiavellismus laut dem Rezensenten?
Der Machiavellismus hatte nachweislich Einfluss auf Nietzsche, Lenin, den Bolschewismus, Faschisten und Nazis. Auch im (Neo-)Liberalismus hat er Spuren hinterlassen.
Welchen Grundfehler sieht der Rezensent in Machiavellis Denken?
Der Rezensent sieht Machiavellis Grundfehler darin, den Anteil positiver Eigenschaften und Fähigkeiten an der menschlichen "Natur" zu verkennen. Er kritisiert, dass Machiavelli der menschlichen Natur einerseits bösartige Konstanz, andererseits aber auch schöpferische Fähigkeiten zuschreibt.
Welche Alternativen schlägt der Rezensent zu Machiavellis Staatsverständnis vor?
Der Rezensent schlägt vor, dass es darauf ankommt, der teilweise von Gegensätzen geprägten Triebstruktur des Menschen in möglichst zuträglicher und vernünftiger Art und Weise gerecht zu werden. Er betont, dass ein "starker Staat" allein nicht genügt, sondern dass neue, progressive Gesellschaftsformen entwickelt werden müssen, in denen alle Menschen ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß leben und arbeiten können.
Welche Rolle spielt das Christentum in Machiavellis Analyse der menschlichen Schwäche?
Machiavelli argumentiert, dass das Christentum mit seiner Geringschätzung der diesseitigen Welt zugunsten des Jenseits zur Schwäche der Menschen seiner Zeit beigetragen habe.
Welche Literatur wird im Text zitiert?
Im Text werden folgende Werke zitiert: Joachim Bauer: Das kooperative Gen. Abschied vom Darwinismus (2008), Ernst Habermann: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kommissars (1996), Manuel Knoll: Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates (2018) und Klaus Robra: Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demo-kratischen Öko-Sozialismus (2017).
- Arbeit zitieren
- Dr. Klaus Robra (Autor:in), 2023, Rezension zu Manuel Knolls "Machiavellis realistisches Menschenbild und seine Rechtfertigung des Staates", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1337175