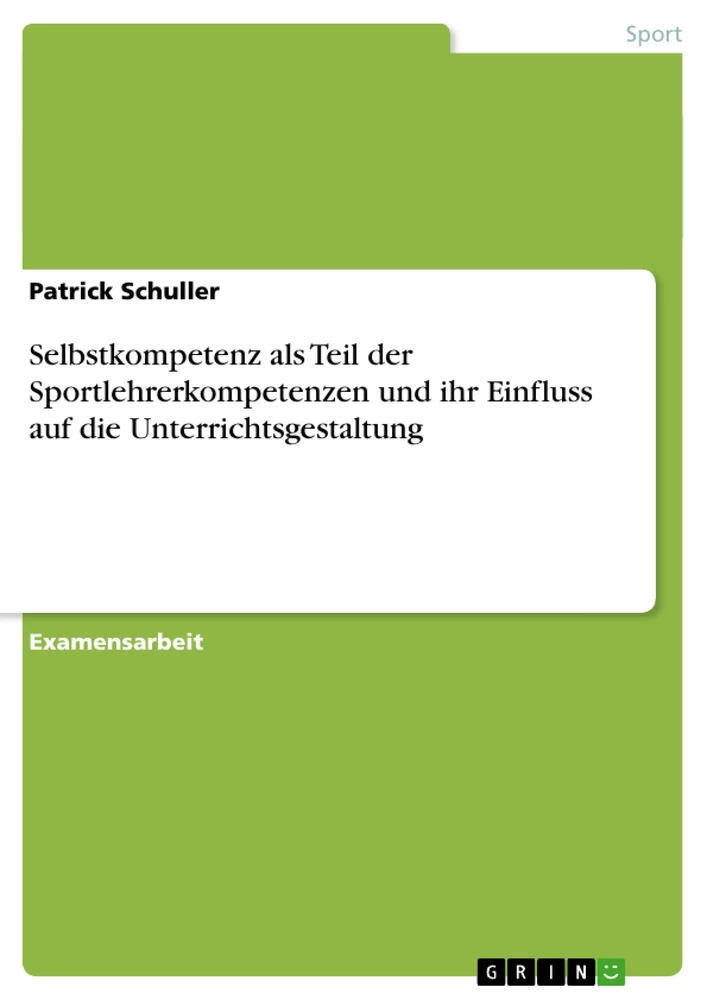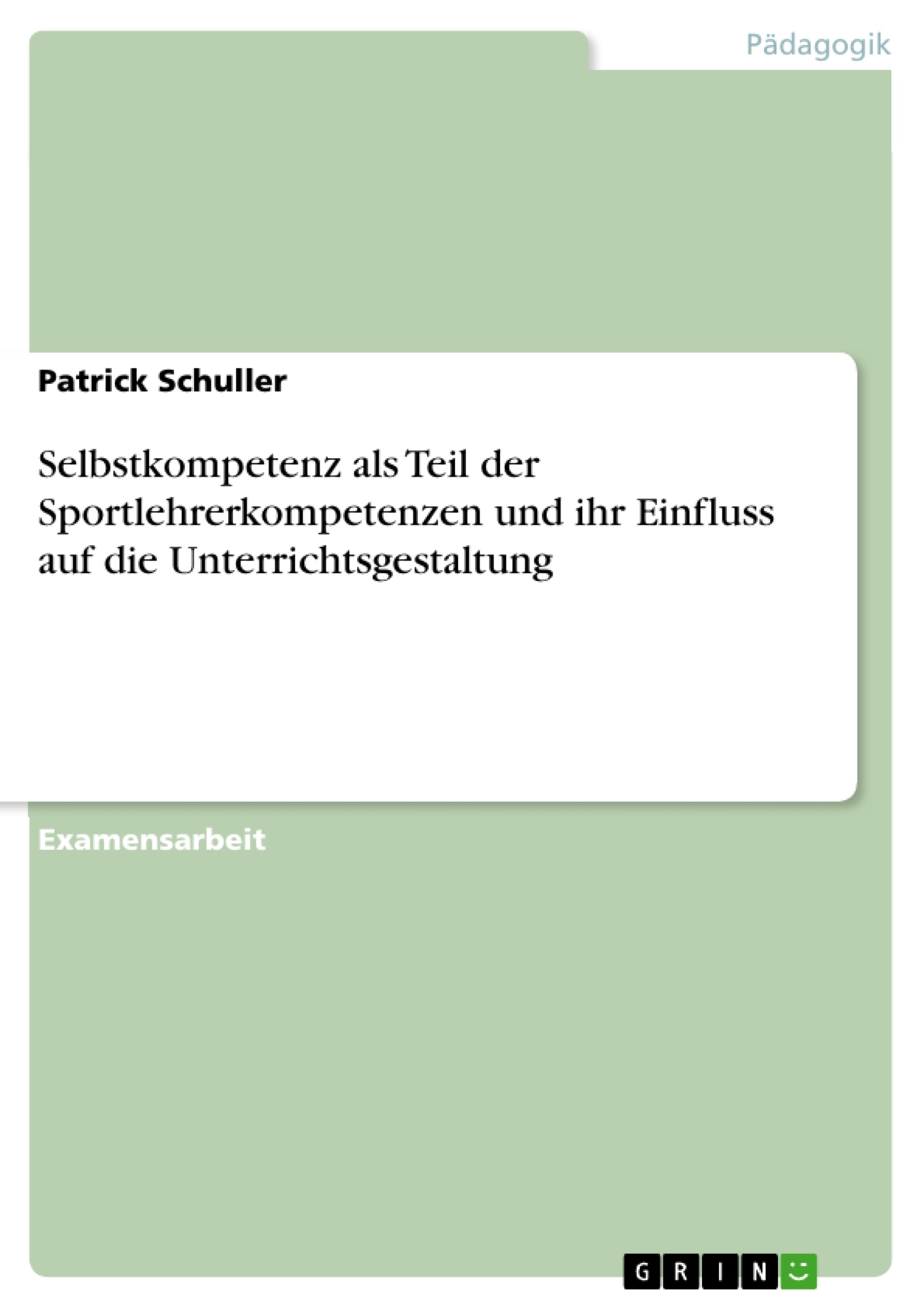I THEORETISCHER TEIL
1 Einleitung 1
1.1 Einführung in die Thematik 1
1.2 Aufbau der Arbeit 3
2 Der Kompetenzbegriff 5
2.1 Ursprung des Kompetenzbegriffes 5
2.2 Definition des Kompetenzbegriffes 6
2.3 Kompetenzmodell von Scherler 10
2.4 Zusammenfassung 13
3 Kompetenzen des Sportlehrers 14
3.1 Kompetenzmodell nach Michael Bräutigam 14
3.1.1 Fachkompetenz 17
3.1.2 Selbstkompetenz 18
3.1.3 Sozialkompetenz 20
3.1.4 Sachkompetenz 22
3.1.5 Systemkompetenz 22
3.2 Sportlehrerkompetenzen nach dem Deutschen Sportbund 1977 23
3.3 Kompetenzen von Sportlehrern nach Uwe Pühse 25
3.4 Zusammenfassung 26
4 Biographische Kompetenz 27
4.1 Theorien biographischer Kompetenz 27
4.1.1 Professionstheorie nach Hilbert Meyer 27
4.1.2 Professionalisierung im Lehrerberuf nach Reh und Schelle 29
4.1.3 Entwicklungsphasen von Lehrkräften nach Schönknecht 30
4.2 Vermittlung von Selbstkompetenz und biographischer Kompetenz 31
4.3 Zusammenfassung 35
5 Qualitative Sozialforschung 37
5.1 Die Wurzeln qualitativen Denkens 37
5.2 Grundlagen qualitativen Denkens 38
5.3 Die 13 Säulen qualitativen Denkens 39
5.4 Zusammenfassung 44
II EMPIRISCHER TEIL
6 Forschungsfrage 45
7 Qualitative Untersuchung 47
7.1 Untersuchungsmethodik 47
7.2 Qualitative Forschungsdesigns 48
7.3 Verfahren der qualitativen Untersuchung 49
7.3.1 Sample 50
7.3.2 Erhebungsverfahren 51
7.3.3 Aufbereitungsverfahren 54
7.3.4 Auswertungsverfahren 55
7.4 Zusammenfassung 57
8 Ergebnisse 59
8.1 Vorgehen bei der Datenauswertung 59
8.2 Ergebnisse der Auswertung 61
8.3 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 72
9 Zusammenfassung und Ausblick 79
Literaturverzeichnis 81
Anhang 84
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik
- Aufbau der Arbeit
- Der Kompetenzbegriff
- Ursprung des Kompetenzbegriffes
- Definition des Kompetenzbegriffes
- Kompetenzmodell von Scherler
- Zusammenfassung
- Kompetenzen des Sportlehrers
- Kompetenzmodell nach Michael Bräutigam
- Fachkompetenz
- Selbstkompetenz
- Sozialkompetenz
- Sachkompetenz
- Systemkompetenz
- Sportlehrerkompetenzen nach dem Deutschen Sportbund 1977
- Kompetenzen von Sportlehrern nach Uwe Pühse
- Zusammenfassung
- Biographische Kompetenz
- Theorien biographischer Kompetenz
- Professionstheorie nach Hilbert Meyer
- Professionalisierung im Lehrerberuf nach Reh und Schelle
- Entwicklungsphasen von Lehrkräften nach Schönknecht
- Vermittlung von Selbstkompetenz und biographischer Kompetenz
- Zusammenfassung
- Qualitative Sozialforschung
- Die Wurzeln qualitativen Denkens
- Grundlagen qualitativen Denkens
- Die 13 Säulen qualitativen Denkens
- Zusammenfassung
- Forschungsfrage
- Qualitative Untersuchung
- Untersuchungsmethodik
- Qualitative Forschungsdesigns
- Verfahren der qualitativen Untersuchung
- Sample
- Erhebungsverfahren
- Aufbereitungsverfahren
- Auswertungsverfahren
- Zusammenfassung
- Ergebnisse
- Vorgehen bei der Datenauswertung
- Ergebnisse der Auswertung
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Selbstkompetenz im Kontext der Sportlehrerkompetenzen und deren Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Selbstkompetenz und der Fähigkeit, effektiven Sportunterricht zu gestalten, zu beleuchten.
- Der Kompetenzbegriff im Sportunterricht
- Sportlehrerkompetenzen: Ein Überblick verschiedener Modelle
- Der Einfluss von Selbstkompetenz auf die Unterrichtsgestaltung
- Methoden der qualitativen Sozialforschung
- Analyse der Ergebnisse einer qualitativen Studie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstkompetenz von Sportlehrern und deren Bedeutung für die Unterrichtsgestaltung ein. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und skizziert die Forschungsfrage. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe für den Leser und stellt den Kontext der gesamten Arbeit dar, indem sie die Relevanz des Themas herausstellt und die Struktur der folgenden Kapitel ankündigt. Die Argumentation baut auf der Notwendigkeit auf, die Bedeutung von Selbstkompetenz für effektiven Sportunterricht zu untersuchen.
Der Kompetenzbegriff: Dieses Kapitel analysiert den Kompetenzbegriff aus verschiedenen Perspektiven. Es beleuchtet den Ursprung und verschiedene Definitionen von Kompetenz, untersucht ein spezifisches Kompetenzmodell (z.B. von Scherler) und fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Die verschiedenen Definitionen und Modelle werden kritisch betrachtet und in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden dargestellt, um ein fundiertes Verständnis des Kompetenzbegriffes für die weitere Arbeit zu schaffen.
Kompetenzen des Sportlehrers: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Kompetenzmodellen für Sportlehrer. Es werden unterschiedliche Ansätze (z.B. nach Bräutigam, dem Deutschen Sportbund, Pühse) verglichen und die jeweiligen Komponenten, insbesondere die Selbstkompetenz, detailliert beschrieben. Die Zusammenfassung dieses Kapitels vergleicht und kontrastiert die verschiedenen Modelle und hebt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gewichtung von Selbstkompetenz hervor. Die Analyse der Modelle liefert eine Grundlage für die spätere Untersuchung des Einflusses von Selbstkompetenz auf die Unterrichtsgestaltung.
Biographische Kompetenz: Das Kapitel erörtert den Zusammenhang zwischen biographischer Kompetenz und Selbstkompetenz im Kontext des Lehrerberufs. Es werden relevante Theorien (z.B. von Meyer, Reh und Schelle, Schönknecht) vorgestellt und analysiert, wie diese beiden Kompetenzformen miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Die Zusammenfassung dieses Kapitels verdeutlicht, wie die Vermittlung biographischer Kompetenz die Entwicklung von Selbstkompetenz bei Sportlehrern unterstützt und somit die Unterrichtsqualität verbessert.
Qualitative Sozialforschung: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen und Methoden qualitativer Sozialforschung, die für die empirische Untersuchung verwendet werden. Es werden die Wurzeln des qualitativen Denkens, Grundlagen und die „13 Säulen qualitativen Denkens“ erläutert. Die Zusammenfassung dieses Kapitels fasst die wichtigsten methodischen Ansätze zusammen, die der empirischen Untersuchung zugrunde liegen. Das Kapitel dient als methodische Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse im empirischen Teil der Arbeit.
Schlüsselwörter
Selbstkompetenz, Sportlehrerkompetenzen, Unterrichtsgestaltung, Qualitative Sozialforschung, Kompetenzmodelle, Biographische Kompetenz, Professionalisierung, Lehrerberuf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Selbstkompetenz von Sportlehrern und deren Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Selbstkompetenz im Kontext der Sportlehrerkompetenzen und deren Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung. Sie beinhaltet eine Literaturrecherche zu Kompetenzmodellen, biographischer Kompetenz und qualitativer Sozialforschung, gefolgt von der Beschreibung und Auswertung einer qualitativen Studie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenbereiche: den Kompetenzbegriff im Sportunterricht, verschiedene Sportlehrerkompetenzmodelle (Bräutigam, Deutscher Sportbund, Pühse), den Einfluss von Selbstkompetenz auf die Unterrichtsgestaltung, Theorien der biographischen Kompetenz (Meyer, Reh & Schelle, Schönknecht), Methoden der qualitativen Sozialforschung und die Analyse der Ergebnisse einer empirischen qualitativen Studie.
Welche Kompetenzmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Kompetenzmodelle für Sportlehrer, darunter das Modell von Michael Bräutigam (mit den Komponenten Fach-, Selbst-, Sozial-, Sach- und Systemkompetenz), das Modell des Deutschen Sportbundes von 1977 und das Modell von Uwe Pühse. Die verschiedenen Modelle werden verglichen und hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Selbstkompetenz diskutiert.
Welche Rolle spielt die biographische Kompetenz?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen biographischer und Selbstkompetenz im Lehrerberuf. Sie bezieht Theorien von Hilbert Meyer, Reh und Schelle sowie Schönknecht ein, um zu zeigen, wie die Vermittlung biographischer Kompetenz die Entwicklung von Selbstkompetenz und damit die Unterrichtsqualität positiv beeinflusst.
Welche Forschungsmethode wird angewendet?
Es wird eine qualitative Sozialforschung mit entsprechenden Methoden angewendet. Die Arbeit beschreibt die Grundlagen qualitativen Denkens, einschliesslich der „13 Säulen“, und erläutert die methodischen Schritte der Untersuchung, von der Auswahl der Stichprobe (Sample) bis zur Auswertung der Daten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist strukturiert in eine Einleitung, Kapitel zum Kompetenzbegriff, Sportlehrerkompetenzen, biographischer Kompetenz und qualitativer Sozialforschung. Es folgt die Beschreibung der Forschungsfrage, der qualitativen Untersuchung (Methoden, Design, Verfahren), die Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation, sowie ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Selbstkompetenz, Sportlehrerkompetenzen, Unterrichtsgestaltung, Qualitative Sozialforschung, Kompetenzmodelle, Biographische Kompetenz, Professionalisierung, Lehrerberuf.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Selbstkompetenz und der Fähigkeit, effektiven Sportunterricht zu gestalten. Das zentrale Ziel ist es, den Einfluss von Selbstkompetenz auf die Unterrichtsgestaltung zu beleuchten.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für die Thematik der Sportlehrerkompetenzen, insbesondere der Selbstkompetenz, und deren Einfluss auf die Unterrichtsqualität interessieren. Sie ist relevant für Sportlehrer, Lehramtsstudierende, Wissenschaftler und alle, die sich mit der Professionalisierung im Lehrerberuf auseinandersetzen.
- Quote paper
- Patrick Schuller (Author), 2008, Selbstkompetenz als Teil der Sportlehrerkompetenzen und ihr Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133721