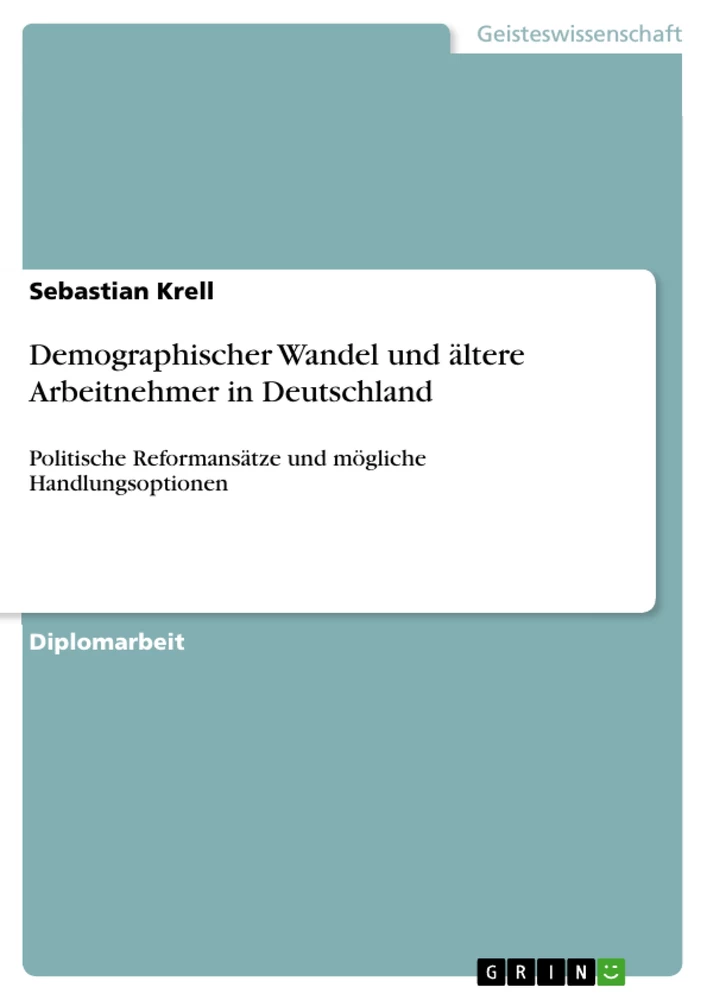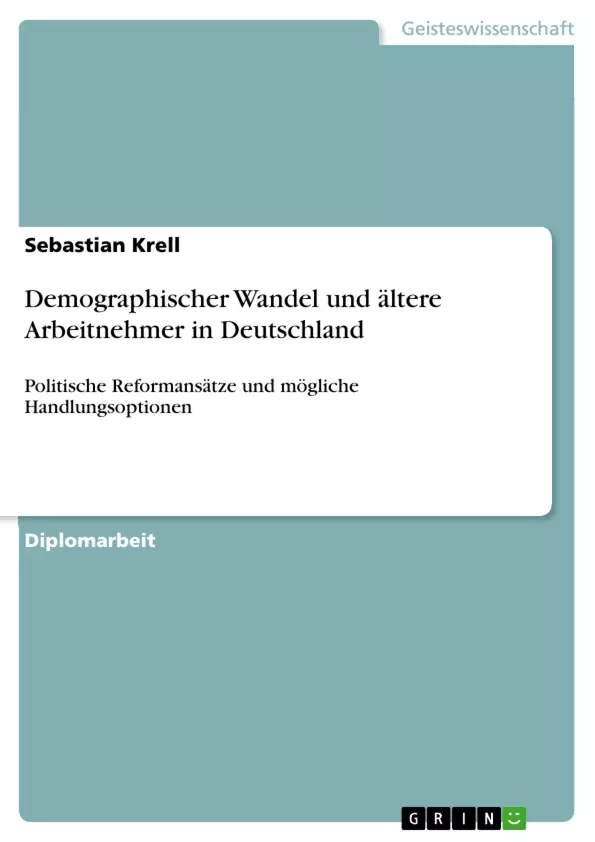Ältere Arbeitnehmer und der Arbeitsmarkt ist ein Themenkomplex der durch den demographischen Wandel und seinen Auswirkungen auf die Bevölkerung und folglich auch auf die Erwerbsbevölkerung in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Der demographische Wandel wird verstanden als eine Entwicklung, die im Kern das Altern der Bevölkerung mit der Perspektive ihrer Schrumpfung beinhaltet. Hervorgerufen wird die zunehmende Alterung durch die niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung. Deutschland war das erste Land auf der Welt, in dem ohne Fremdeinwirkung mehr Menschen gestorben als geboren wurden. Kurzum, die deutsche Bevölkerung wird relativ altern und sich absolut Unterjüngen.
Auf diesen Prozess hat Franz-Xaver Kaufmann (Schweizer Soziologe) bereits 1960 mit seiner These der Überalterung der Gesellschaft aufmerksam gemacht.
Die demographische Entwicklung wird nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft betreffen und diese vor große Herausforderungen stellen. Kommende Veränderungen werden auch nicht vor dem Arbeitsmarkt halt machen, denn die demographischen Entwicklungen determinieren das künftige Arbeitskräftepotenzial. Auf diese Veränderungen gilt es sich einzustellen. Das Phänomen der alternden Belegschaften ist bereits heute auf dem Arbeitsmarkt anzutreffen und dieser Prozess wird sich weiter beschleunigen. Um der Herausforderung des demographischen Wandels entgegenzuwirken sind in der letzten Zeit die älteren Arbeitnehmer verstärkt in den Fokus der politischen Diskussion gerückt. Der demographische Wandel erzwingt eine wachsende Erwerbsbeteiligung der Älteren und somit auch eine verlängerte Lebensarbeitszeit. In der betrieblichen Praxis ist die Botschaft noch nicht überall angekommen, aber gerade die Unternehmen müssen sich auf die anstehenden Veränderungen einstellen, denn sie werden künftig mit einer im Durchschnitt älteren Belegschaft arbeiten und planen müssen. In letzter Zeit sind viele (politische) Maßnahmen in die Wege geleitet worden, um die Erwerbsbeteiligung und eine verlängerte Lebensarbeitszeit der Älteren zu ermöglichen. Ob diese Maßnahmen allein ausreichen um die Arbeitsmarktsituation der Älteren zu verbessern ist zurzeit noch fraglich.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
1.1 Ziel der Arbeit
1.2 Aufbau
2. Demographischer Wandel
2.1 Gegenstand der demographischen Forschung
2.1.1 Demographie
2.1.1.1 Geschichte der Demographie
2.1.2 Der erste und der zweite Demographische Übergang
2.2 Die Komponenten des demographischen Wandels
2.2.1 Fertilität
2.2.1.1 Geschichte der Fertilität
2.2.2 Migration
2.2.2.1 Geschichte der Migration
2.2.3 Mortalität
2.2.3.1 Geschichte der Mortalität
2.2.4 Altersstruktur der deutschen Bevölkerung
2.2.4.1 Entwicklung der Altersstruktur
2.3 Die demographische Entwicklung in Deutschland
2.3.1 kurzfristige bis mittelfristige Entwicklung
2.3.2 langfristige Entwicklung
2.4 Zwischenfazit
3. Demographischer Wandel in der Arbeitswelt
3.1 Demographischer Wandel und Arbeitskräfteangebot
3.1.1 Grundlagen und aktuelle Lage
3.1.2 Projektion des Arbeitskräftepotenzials
3.2 „Altere Arbeitnehmer"
3.3 Zwischenfazit
4. Vorstellung von Reformansätzen
4.1 Entwicklung der Arbeitsförderung
4.2 Darstellung der Instrumente
4.2.1 Ansätze für ältere Arbeitslose
4.2.1.1 Instrumente zur Verbesserung der Beschäftigungssituation
4.2.1.2 arbeitsrechtliche Maßnahmen
4.2.2 Ansätze für ältere Arbeitnehmer
4.2.2.1 Qualifizierungsmaßnahmen
4.2.2.2 „Rente mit 67"
5. Bewertung der Instrumente und mögliche Handlungsoptionen
5.1 Bewertung der Instrumente
5.1.1 Instrumente zur Erhöhung der Beschäftigungschancen und —fähigkeit
5.1.1.1 Kombilohn für Ältere
5.1.1.2 Eingliederungszuschuss für Ältere
5.1.1.3 Förderung beschäftigter Arbeitnehmer
5.1.1.4 Befristungsregelung für Ältere
5.1.2 Anreiz zur Verringerung des früheren Erwerbsausstiegs
5.2 mögliche Handlungsoptionen
6. Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: Annahmen der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Tabelle 2: Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials
Tabelle 3: Instrumente für ältere Arbeitslose und ältere Arbeitnehmer
Tabelle 4: Teilnehmer an Maßnahmen für Ältere
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Modell des ersten und zweiten Demographischen Übergangs
Abbildung 2: Entwicklung der Bevölkerungszahl bis 2050
Abbildung 3: Veränderung der Altersstruktur
Abbildung 4: Entwicklung der Altersstruktur des Erwerbspersonenpotenzials
Abbildung 5: Entwicklungen ausgewählter Quoten für 55- bis unter 65-jährige
Abbildung 6: zusammengefasste Geburtenziffer von 1952 bis 2006
Abbildung 7: Wanderungssaldo der ausländischen Personen über die Grenzen Deutschlands
Abbildung 8: Entwicklung der Lebenserwartung seit 1871
Abbildung 9: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland 2006
Abbildung 10: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland von 1910 bis 2050
Abbildung 11: Beschäftigungsquoten nach Alter (55 - 64 Jahre)
1. Einleitung
Ältere Arbeitnehmer und der Arbeitsmarkt ist ein Themenkomplex der durch den demographischen1 Wandel und seinen Auswirkungen auf die Bevölkerung und folglich auch auf die Erwerbsbevölkerung in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der demographische Wandel wird verstanden als eine Entwicklung, die im Kern das Altern der Bevölkerung mit der Perspektive ihrer Schrumpfung beinhaltet. Hervorgerufen wird die zunehmende Alterung durch die niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung. Deutschland war das erste Land auf der Welt, in dem ohne Fremdeinwirkung mehr Menschen gestorben als geboren wurden. Dies als Geburtendefizit bezeichnete Ereignis trat in Deutschland erstmals 1972 auf (Brig 2005: 1). Bis zum Jahr 2003 wurde dieses Geburtendefizit noch durch einen positiven Wanderungssaldo übertroffen und führte somit zu einem Anwachsen der deutschen Bevölkerung (Korcz/Schlömer 2008: 156). Seitdem sinkt die deutsche Bevölkerungszahl kontinuierlich, wenn auch langsam. Kurzum, die deutsche Bevölkerung wird relativ altern und sich absolut Unterjüngen.
Auf diesen Prozess hat Franz-Xaver Kaufmann (Schweizer Soziologe) bereits 1960 mit seiner These der Überalterung der Gesellschaft aufmerksam gemacht (Schimany 2003: 14). Seine These fand in der Fachwelt wie auch der damaligen Gesellschaft (noch) kein Gehör. Anfang der 1980er begann Meinhard Miegel (Sozialwissenschaftler) mit der Erforschung des demographischen Wandels und wies mehrfach auf die einschneidenden bevorstehenden Veränderungen hin.2 Dies wurde ebenso wenig zur Kenntnis genommen. Erst mit Beginn der Krise der Rentenversicherung und der Diskussion über deren unsichere Finanzierung, Anfang der 1990er Jahre, wurde das Thema allmählich auf die politische Agenda gesetzt.3 Aber noch 1999 merkte Herwig Birg (Professor für Bevölkerungsforschung an der Universität Bielefeld) an, dass dieses Thema von der deutschen Politik und Gesellschaft nahezu ignoriert und tabuisiert würde.4 Mittlerweile liegen die Fakten auf dem Tisch und die Botschaft ist angekommen, das Thema ist hinreichend bekannt und wird breit in der Öffentlichkeit und Politik diskutiert.
Die demographische Entwicklung wird nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft betreffen und diese vor große Herausforderungen stellen. Kommende Veränderungen werden auch nicht vor dem Arbeitsmarkt halt machen, denn die demographischen Entwicklungen determinieren das künftige Arbeitskräftepotenzial. Auf diese Veränderungen gilt es sich einzustellen. Das Phänomen der alternden Belegschaften ist bereits heute auf dem Arbeitsmarkt anzutreffen und dieser Prozess wird sich weiter beschleunigen (INQA 2008: 3). Um der Herausforderung des demographischen Wandels entgegenzuwirken sind in der letzten Zeit die älteren Arbeitnehmer verstärkt in den Fokus der politischen Diskussion gerückt. Der demographische Wandel erzwingt eine wachsende Erwerbsbeteiligung der Älteren und somit auch eine verlängerte Lebensarbeitszeit. In der betrieblichen Praxis ist die Botschaft noch nicht überall angekommen, aber gerade die Unternehmen müssen sich auf die anstehenden Veränderungen einstellen, denn sie werden künftig mit einer im Durchschnitt älteren Belegschaft arbeiten und planen müssen. In letzter Zeit sind viele (politische) Maßnahmen in die Wege geleitet worden, um die Erwerbsbeteiligung und eine verlängerte Lebensarbeitszeit der Älteren zu ermöglichen. Ob diese Maßnahmen allein ausreichen um die Arbeitsmarktsituation der Älteren zu verbessern ist zurzeit noch fraglich.
1.1 Ziel der Arbeit
Das Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den deutschen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmer zu geben. Vor diesem Hintergrund gilt es, eine Reihe von Fragen zu beantworten. Wie wird sich künftig unsere Bevölkerung entwickeln und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Arbeitsmarkt? Wie stellt sich die gegenwärtige Arbeitsmarktsituation der älteren Arbeitnehmer dar? Welche Maßnahmen hat die Politik in die Wege geleitet, um auf die demographische Herausforderung im Hinblick auf ältere Arbeitnehmer zu reagieren? Wie sind diese Maßnahmen zu bewerten und gibt es möglicherweise Verbesserungsmöglichkeiten? Auf diese Fragen will die vorliegende Arbeit eine Antwort geben.
1.2 Aufbau
Diese Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Im Anschluss an die Heranführung an das Thema werden im zweiten Kapitel der demographische Rahmen und die künftige Entwicklung umrissen. Ausgehend von den Ergebnissen der künftigen Entwicklung werden im dritten Kapitel die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt und die gegenwärtige Situation der älteren Arbeitnehmer dargelegt. Kapitel vier stellt die gegenwärtigen arbeitsmarktpolitischen und teils arbeitsrechtlichen Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer vor. Diese werden dann in Kapitel fünf bewertet und diskutiert. Ebenso werden mögliche Handlungsoptionen aufgezeigt. Abschließend werden die Schlussfolgerungen zusammengefasst.
Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit im Text überwiegend die männliche Form verwendet. Die Angaben beziehen sich dennoch immer auf die weibliche und männliche Person. Des Weiteren wird auf eine geschlechtliche Differenzierung weitestgehend verzichtet. Der Bezugsrahmen dieser Arbeit ist Deutschland und bezieht sich auf den Wissensstand vom Februar 2009.
2. Demographischer Wandel
Im folgenden Kapitel werden der demographische Rahmen und die künftige Entwicklung umrissen. Beginnend mit einer Darlegung eines Überblicks über den Gegenstandsbereich der demographischen Forschung, folgt darauf die Veranschaulichung der Komponenten die den demographischen Wandel determinieren. Auf diesen Komponenten aufbauend wird anhand der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes von 2006 aufgezeigt, wie sich die deutsche Bevölkerung künftig entwickeln wird. Abschließend wird ein Zwischenfazit gezogen.
2.1 Gegenstand der demographischen Forschung
Um einen detaillierten Blick auf die demographische Entwicklung in Deutschland werfen zu können, bedarf es der Darlegung des Gegenstandsbereichs dieser wissenschaftlichen Disziplin. Zusätzlich wird ein kleiner Überblick über die Geschichte der Demographie geliefert. Abschließend wird der „demographische Ubergang" skizziert um aufzuzeigen, dass bereits Mitte der 1940er Jahre im Kontext der Formulierung des demographischen Übergangs auf das Phänomen des demographischen Wandels aufmerksam gemacht wurde.
2.1.1 Demographie
Der Begriff „Demographie"5 stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Volk beschreiben", wobei das Wort „demos" für „Volk" und „graphein" für „schreiben/beschreiben" steht (Hauser 1982: 17).
Demographie „ist die empirische Analyse und akademische Lehre von Bevölkerungen, von ihren Strukturen und Veränderungen sowie von deren Ursachen und Folgen" (Mackensen 1998: 11). Eine „Bevölkerung bezeichnet [...] die Gesamtheit der Personen innerhalb eines bestimmten (regional abgegrenzten) Bereichs" (Bolte 1969: 115). Primär hat die Demographie ein Interesse an Prozessen, „die den Wandel von Populationen bestimmen: Geburten, Todesfälle, Wanderungen" (Mueller 1993: 1).
In der Demographie wird zwischen der Darstellung von Bevölkerungsprozessen und Bevölkerungsstrukturen differenziert. Die Bevölkerungsprozesse beschreiben die Bevölkerungsbewegungen wie Geburten, Sterbefälle oder Wanderungen (Migration). Hierunter wird noch zwischen der „natiirlichen" Bevölkerungsbewegung (Geburten, Sterbefälle) und der „räumlichen" Bevölkerungsbewegung (Zu- und Abwanderungen) unterschieden (Klohn 2006: 8). Neben den Bevölkerungsprozessen gibt es die Bevölkerungsstruktur. Hier wird die Bevölkerung nach demographischen Merkmalen gegliedert. „Natiirliche Kriterien" sind Alter, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit. „Soziale oder wirtschaftliche Kriterien" sind die Gliederung nach Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beruf, Einkommen usw. (Ebd.). Zwischen den Bevölkerungsprozessen und der Bevölkerungsstruktur besteht eine wechselseitige Abhängigkeit, da „die demographischen Ereignisse Umfang und Zusammensetzung einer Bevölkerung fortlaufend verändern" (Schimany 2003: 29). Mithilfe von Kennzahlen wird beschrieben, „wie sich eine Bevölkerung in ihrem Umfang und Strukturen durch bestimmte demographische Ereignisse verändert" (Micheel 2005: 44), weswegen die Demographie auch als statistisch fundierte Bevölkerungslehre verstanden wird (Esenwein-Rothe 1982: 1). Kurz gesagt: Die Bevölkerungswissenschaft interessiert sich für alles, was sich in Zahlen erfassen und messen lässt (INQA 2005: 13).
Die Demographie wird als interdisziplinäres Forschungs- und Studiengebiet verstanden (Höpflinger 1997: 11ff.). Faktisch lassen sich die demographischen Entwicklungen oft nur durch den äquivalenten Einbezug von Geschichte (historische Demographie), Statistik (Bevölkerungsstatistik), Ökonomie (Bevölkerungsökonomie), Politik (Bevölkerungspolitik) und Soziologie (Bevölkerungssoziologie) richtig erfassen und verstehen. Mackensen spricht deswegen von einer „Multidisziplin" bzw. von einem ganzen „Biotop der Bevölkerungswissenschaften" (Mackensen 1998: 156f.). Die Demographie ist meist auf die Ergebnisse der anderen Wissenschaften angewiesen, vor allem auf die biologischen Wissenschaften und die Sozialwissenschaften, „da die entscheidenden demographischen Ereignisse Geburt und Tod biologische Ereignisse sind, deren Veränderungen sowohl durch biologische wie soziale Faktoren bestimmt wird [...]"(Roeske 1969: 315).
Die Bevölkerungswissenschaft ist eine staatsnahe, politikberatende und politisierende Disziplin. Daten über die Entwicklung und Struktur einer Population gehören zum grundlegenden Informationsbereich für viele Bereiche, z.B. für den Staat, die Wirtschaft oder die Gesellschaft. Für das wirtschaftliche Geschehen sind demographische Gegebenheiten von Bedeutung, weil sie Grundinformationen über die Menschen als Arbeitskräfte, Einkommensbezieher und Konsumenten liefern (Grobecker/Krack-Rohberg 2008: 11).
Demographen beschreiben, analysieren und prognostizieren die Entwicklungen von Bevölkerungen. Deshalb werden sie bisweilen auch als Bevölkerungswissenschaftler bezeichnet. Ein Ziel der Demographen ist es, regelmäßige Muster und Gesetzmäßigkeiten im Zustand und in der Entwicklung der Bevölkerung zu finden. Sind diese Muster gefunden, kann eine Prognose über die zukünftige Entwicklung angestellt werden.
2.1.1.1 Geschichte der Demographie
Die Anfänge der Demographie liegen sehr weit zurück. Die älteste Überlieferung einer Volkszählung stammt aus den Jahren 2225 v. Chr. aus China, wo nach einer Überschwemmungskatastrophe eine Registrierung der Bevölkerung stattfand (Schimany 2003: 30).
Johann Peter Süßmilch (1707 — 1767) und Thomas Robert Malthus (1766 — 1834) gehören zu den Gründervätern der Bevölkerungswissenschaft. Süßmilch (Statistiker, Demograph) intensivierte damals die Einrichtung und Führung der Geburts-, Heirats- und Sterberegister im damaligen Preußen. Sein Hauptwerk „Die Göttliche Ordnung in den Veriinderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, Tod und Fortpflanzung desselben erwiesen" von 1741 machte ihn zum „Begriinder der wissenschaftlichen Bevölkerungsstatistik in Deutschland, Bahnbrecher für die Auffassung der Statistik als Wissenschaft" und zum bedeutenden „Vorläufer der medizinischen und der mathematischen Statistik" (vom Brocke 1998: 37). Süßmilch vertrat die Meinung, dass die zunehmende Bevölkerung „gottgewollt und zugleich sicheres Zeichen des Glücks und der Wohlfahrt des Volkes" (Ebd.) sei. Er errechnete die erste Bevölkerungsprognose und sagte eine Obergrenze von 7 Milliarden Menschen auf der Erde voraus. Malthus6 (britischer Ökonom) bediente sich an der Arbeit Süßmilchs, interpretierte sie aber „auf diametral entgegen gesetzte Weise"7 (vom Brocke 2008: 1) Sein pessimistisches „Bevölkerungsgesetz" stellte die Lehre Süßmilchs infrage, indem er die Auffassung vertrat, dass die Bevölkerung stets über den Nahrungsspielraum anwächst und nur durch Kriege, Seuchen, Hungersnot oder präventive Maßnahmen, wie z.B. sexuelle Enthaltsamkeit, begrenzt werden kann (vom Brocke 1998: 39/49). Um die Theorie von Malthus entbrannte eine hitzige Diskussion, die bis heute anhält. Die Theorie von Malthus war, laut vom Brocke, nicht so wichtig, sondern eher die Rezeptionsgeschichte der Folgezeit und Birg bezeichnet die Theorie von Malthus sogar als falsch (Birg 2006: 12).
Die Bevölkerungswissenschaft als Fachwissenschaft entstand in Deutschland erst im 19. Jahrhundert im Rahmen der Gründung der ersten Statistischen Ämter (1801 Bayern, 1805 Preußen usw.) und durch die staatswissenschaftlich-statistischen Universitätsseminare (vom Brocke 2008: 2). Ihren bisherigen Höhepunkt an nationaler Förderung erreichte die Bevölkerungswissenschaft im „Dritten Reich" mit dem Missbrauch dieser für die Gleichsetzung der Rassenhygiene, Eugenik und der damaligen nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik. Dies führte zu einer Selbstisolierung der deutschen Bevölkerungswissenschaft, von der sich weiter entwickelten Forschung im Ausland sowie dem Verlust vieler Bevölkerungswissenschaftler aufgrund Verfolgung, Vertreibung und Emigration. Die Bevölkerungswissenschaft wurde in dieser Zeit politisch instrumentalisiert und bekam eine nie zuvor da gewesene staatliche Anerkennung (Schimany 2003: 45), umso tiefer war danach ihr Fall. Von diesem Niedergang hat sich die Bevölkerungswissenschaft bis heute nicht erholt. Nach 1945 fristete die Demographie lange Zeit ein Schattendasein, was vor allem an der Nichtverarbeitung, der Verdrängung und dem Verschweigen der nationalsozialistischen Vergangenheit Mitte des 20. Jahrhunderts lag.
Die Nachkriegsjahre waren geprägt von privaten Initiativen und Forschungsbilanzen angesehener Fachvertreter. Beispielsweise gründete Hans Harmsen (1899 — 1989) 1952 die „Deutsche Gesellschaft flr Bevölkerungswissenschaft" und als weitere Anregung dienten die Bevölkerungslehren von Ungern-Sternberg/Schubnell8 und Mackenroth9 (vom Brocke 1998: 15). 1973 wurde dann das dem Bundesministerium des Inneren unterstehende „Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung" (BIB) in Wiesbaden gegründet. Das BIB erforscht bevölkerungsrelevante Aspekte, stellt ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse der Bundesregierung zur Verfügung und berät sie in nationalen und internationalen Bereichen (Rosen 1998: 37). 1996 wurde das „Max-Planck-Institut fir demographische Forschung" in Rostock gegründet, welches als Zentrum internationaler bevölkerungswissenschaftlicher Forschung fungiert (vom Brocke 1998: 1). In Deutschland besteht bezüglich der wissenschaftlichen Institutionalisierung noch Nachholbedarf bspw. im Vergleich zu Frankreich mit seinen mehr als 50 Lehrstühlen für Demographie, dem nur fünf deutsche Lehrstühle gegenüber stehen.10 Durch die bescheidene Verankerung der Demographie an den deutschen Hochschulen ist die Demographie „erst auf dem Weg zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin" (Birg 1989: 53).
Über die demographische Forschung in der DDR ist nur wenig Literatur vorhanden, obwohl der erste Lehrstuhl für Demographie in der damaligen DDR entstanden ist (1969 in Berlin-Karlshorst an der „Hochschule für Ökonomie").
2.1.2 Der erste und der zweite Demographische Übergang
Die Theorie des demographischen Übergangs (engl. „demographic Transition") bezeichnet „jenen Wandel der Bevölkerungsstruktur, der sich im Zuge der Industriealisierung und Modernisierung einer Gesellschaft erfahrungsgemaB einstellt" (Schmid 1984: 13). Kennzeichnend hierbei ist der Wandel von hohen zu niedrigen Geburten- und Sterberaten. Die Theorie des demographischen Übergangs geht auf den französischen Demographen Adolphe Landry (1934) zurück, wurde später von Warren S. Thompson (1929) sowie Frank W. Notestein (1962) weiterentwickelt (Hradil 2006: 38) und ist damit für viele Demographen sogar das „bedeutendste und allgemeinste Stuck der Bevolkerungstheorie" (Mackensen 1972: 76). Die Theorie des „ersten demographischen Ubergangs" stützt sich auf Beobachtungen, die im Laufe der Industrialisierung in einigen Staaten Europas gemacht wurden.11 Es stellte sich heraus, dass Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten auftraten. Der erste demographische Übergang erfolgte mit dem Wandel von einer Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft, in Deutschland um 1900. Dieser Übergang ist der Ausgangspunkt für den heutigen Alterungsprozess.
Aus der heutigen Sicht hat die die demographische Transition fünf Phasen. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt (nach Cromm 1988: 171f.).
Prätransformative- oder Vorindustrielle Phase: In dieser Phase übersteigt die Geburtenrate die Sterberate leicht und die Bevölkerung wächst sehr langsam. Frühtransformative- oder Einleitungsphase: Die Streberate beginnt allmählich zu sinken, dass bedeutet die Lebenserwartung steigt. Die Geburtenrate bleibt gleichmäßig hoch und die Bevölkerung wächst.
Mitteltransformative- oder Umschwungphase: Das Bevölkerungswachstum erreicht seinen Höhepunkt. Die Sterblichkeit sinkt weiter und nun beginnt auch die Geburtenrate zu sinken.
Spättransformative- oder Einlenkungsphase: Der Rückgang der Sterberate schwächt ab und die Lebenserwartung steigt daher nur noch langsam. Die Geburtenrate sinkt weiter und die Bevölkerung wächst langsamer als bisher. Posttransformative- oder industrielle Phase: Die Geburten- und Sterberaten bleiben stabil auf einem niedrigen Niveau. Die Menschen kriegen nur noch wenige Kinder und leben recht lange. Das Bevölkerungswachstum bleibt ebenso gering und kann sogar unter Null fallen.
Ergänzt wurde dieses Modell von dem Niederländer Dirk J. Van den Kaa und dem Belgier Ron Lesthaeghe um den „zweiten demographischen Ubergang". Gemäß diesem Modell sinkt nach der Posttransformativen Phase des „ersten demographischen Übergangs" die Geburtenrate nochmals und gerät dauerhaft unter die Sterberate (Hradil 2006: 39). Hierdurch kommt es zu einer Bevölkerungsschrumpfung, die durch fortwährende Zuwanderung mehr oder weniger kompensiert wird. Der „zweite demographische Ubergang", auch als „zweiter Geburtenrückgang" bezeichnet, ist auf einen schnellen Geburtenrückgang zwischen 1965 und 1975 zurückzuführen und auf einen Individualisierungstrend in der Gesellschaft in Folge der Modernisierung (Dobritz et al. 2008: 8). Die Sterblichkeit der älteren Menschen hat in dieser Zeit ein so niedriges Niveau erreicht, dass ihnen hierdurch die Möglichkeit gegeben wurde, zusätzliche Lebensjahre zu gewinnen (Ebd.: 10).
In der Zeit zwischen den beiden demographischen Übergängen ist die Geburtenhäufigkeit relativ stabil, trotz der beiden Weltkriege und erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen (Walle/Eggen/Lipinski 2006: 35).
Abb. 1: Modell des ersten und zweiten Demographischen Übergangs.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Immerfall 1994: 42
Kritik kommt bei dem Gesichtspunkt auf, dass „weder Aussagen iiber die Beziehung zwischen Modernisierungsgrad und Stadium des Bevölkerungsvorganges, noch über die Dauer der transformativen Phasen" (Cromm 1988: 172) gemacht werden. Das Modell kann zwar in wenigen Sätzen beschrieben werden, gibt jedoch keine Begründung. Weiterhin wird nicht berücksichtigt, dass das Modell nicht auf jedes Land übertragbar ist (regionale Besonderheiten, Differenzen zwischen den Gesellschaften). „Streng genommen handelt es sich somit nicht um eine Theorie, weil der zu erklärende Sachverhalt theoretisch nicht fundiert wird, sondern um eine generalisierende Beschreibung eines historischen Vorgangs, deren heuristischer Wert für die Klassifizierung und Typologisierung von Bevölkerungsvorgängen jedoch unbestritten ist." (Schimany 2003: 83) Die Annahmen des demographischen Übergangs sind somit „nur eine empirische Verallgemeinerung der demographischen Geschichte der (vornehmlich) westlichen Welt ..." (Hauser 1982: 235).
2.2 Die Komponenten des demographischen Wandels
Die demographische Entwicklung wird von den Komponenten Geburtenrate (Fertilität), dem Wanderungssaldo (Migration) und der Lebenserwartung (Mortalität) beeinflusst. Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten prägt die Altersstruktur einer Bevölkerung. Nimmt man die Summe des Wanderungssaldos, d.h. die Differenz zwischen Fort- und Zuzügen, und die Summe des Geburten- oder Sterbeüberschusses, ergibt dies dann die Entwicklung der Bevölkerungszahl. Die demographischen Faktoren werden dabei von ökonomischen, politischen, ökologischen, sozioökonomischen usw. Determinanten beeinflusst (Höpflinger 1997: 17f.).
In den folgenden Kapiteln werden die demographischen Komponenten Fertilität, Migration und Mortalität vorgestellt und ein geschichtlicher Überblick über deren Entwicklung geliefert um die bisherige und künftige Entwicklung besser verdeutlichen zu können, denn diese ist weitestgehend durch die demographischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte vorgezeichnet. Neben diesen Komponenten wird zusätzlich auf die Altersstruktur eingegangen, da diese für die weitere Entwicklung der Bevölkerung ausschlaggebend ist (Schwarz/Kannenwischer 2005: 50).
2.2.1 Fertilität
Den größten Einfluss auf die Bevölkerungszahl hat die Fertilität. Das Wort Fertilität12 kommt vom lateinischen fertilis und bedeutet fruchtbar, ergiebig, befruchtend (Reader´s Digest 2002 (Band 5): 338). Hillmann definiert Fertilität als „Fortpflanzungsintensität einer Bevölkerung" (Hillmann 2007: 247). In der Demographie bezeichnet Fruchtbarkeit die Zahl der Lebendgeburten je Frau und nicht, wie im biologischen Sinne, die potenzielle Fähigkeit sich fortzupflanzen (Hoßmann et al. 2009: 14). Die Fertilität wird durch die Geburtenhäufigkeit und durch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter determiniert (Schwarz/Kannenwischer 2005: 52/53). Als demographische Indikatoren dienen die allgemeine und altersspezifische Geburtenrate sowie die Gesamtfertilitätsrate (zusammengefasste Geburtenziffer). Die Geburtenbilanz misst die Differenz zwischen der Anzahl der Lebendgeborenen und der Anzahl der Sterbefälle in einem bestimmten Zeitraum. Ist die Differenz positiv liegt ein Geburtenüberschuss vor, ist sie negativ ein Geburtendefizit.
In der Demographie interessiert vor allem die Frage, „inwieweit sich [...] Frauengenerationen durch die Geburt von Kindern und unter Berücksichtigung des Sterberisikos in der von ihnen durchlebten Zeit reproduziert haben." (Schwarz 1991: 149) Die Zahl der Geburten13 hängt essentiell von der durchschnittlichen Kinderzahl ab, „die Frauen im Laufe ihres Lebens zur Welt bringen." (Manz 2007: 1) Gemessen wird dies anhand der „zusammengefassten Geburtenziffer"14 (englisch: Total fertility rate (TFR)) für einzelne Kalenderjahre. „Sie ist die Summe der altersspezifischen Geburtenziffern aller Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahre [Internationaler Standard] in einem Kalenderjahr." (Micheel 2005: 45) Die TFR gibt an, „wie viele Kinder je Frau geboren würden, wenn für ihr Ganzes Leben die altersspezifischen Geburtenziffern des jeweils betrachteten Jahres gelten wurden und es keine Sterblichkeit gabe" (Dobritz et al. 2008: 77) Sie zeigt neuere Trends im Geburtsverhalten zeitnah, lässt sich räumlich gut vergleichen und lässt kurzfristige Schwankungen, die sich im Laufe eines Krieges, von Wirtschaftskrisen oder politischen Umbrüchen ergeben, deutlich hervortreten. In modernen Gesellschaften ist eine durchschnittliche Kinderzahl von 2,115 Kindern pro Frau erforderlich, um die Elterngeneration vollständig zu ersetzen (Bestandserhaltungsniveau). Derzeit liegt die TFR laut Statistischem Bundesamt in Deutschland bei 1,37 Kindern je Frau (2007), das bedeutet jede Kindergeneration ist ca. um ein Drittel kleiner als ihre Elterngeneration. Laut Statistischen Bundesamt wurden in Deutschland 2007 684.862 Kinder geboren.16
Die Geburtenrate von ausländischen Kindern die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen war in den 1970er Jahren fast doppelt so hoch wie die der deutschen Kinder (Wahl 2003: 7). Mittlerweile liegen die Zahlen wieder näher beieinander.
2.2.1.1 Geschichte der Fertilität
Zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ereigneten sich zwei Geburtenrückgänge (zurückzuführen auf die beiden demographischen Übergänge). Diese führten zu dem heutigen niedrigen Geburtenniveau von 1,37 Kindern pro Frau. Der zweite Geburtenrackgang wird auch als „Europe's second Demographic Transition" (Dobritz et al. 2008: 37) bezeichnet, da er europaweit zu verzeichnen war. Bekam eine deutsche Frau 1850 noch im Durchschnitt mehr als 5 Kinder, waren es 1960 durchschnittlich „nur" noch 2,5 (Ehmer 2004: 42).
Die Geburtenrate blieb bis etwa 1875 relativ konstant hoch, was hauptsächlich daran lag, dass noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht einmal mehr als die Hälfte aller Geborenen das Erwachsenenalter erreichte (Ebd.). Erst danach, bedingt durch den Rückgang der Kinder- und Säuglingssterblichkeit, erhöhten sich die Kinderzahlen. Anfangs langsam beginnend, ab 1905 etwas stärker (Hradil 2006: 48). Die beiden Weltkriege hatten einen beträchtlichen Geburtenrückgang zur Folge, aber mit der Nachkriegszeit17 sprangen die Geburtenzahlen wieder in die Höhe (siehe Abb. 9). Hervorgerufen durch das „Wirtschaftswunder" und einer optimistischen Grundstimmung kam es in der Zeit zwischen 1952 und 1965 zum sog. „Baby-Boom" (Hradil 2006: 49), der von Statistikern als die geburtenstarken Jahrgänge bezeichnet wird. Die TFR stieg daraufhin bis Mitte der 1960er Jahre auf 2,5 Kinder je Frau (Pötzsch 2007: 16) und die Geburtenzahlen erreichten im Jahr 1964 ihren Höhepunkt mit 1.065.437 Lebendgeborenen.18 Mit der Einführung der „Antibabypille" und einem gesellschaftlichen Wandel endete diese Entwicklung. Die TFR verringerte sich drastisch und es kam zwischen 1965 und 1978 zum sog. „Pillenknick" („zweiter demographischer Ubergang") (Dobritz et al. 2008: 24). In dieser Zeit sank die TFR von 2,4 auf 1,4 (siehe Abb. 6), das heißt unter das für die Bestandserhaltung notwendige Niveau. An dieser niedrigen Geburtenrate hat sich bis heute nichts Wesentliches mehr geändert. Demographen nennen das Absinken der Fertilität unter den Wert von 1,5 „Lowest Fertility" (Kaufmann 2007: 109). Ab diesem Wert wird es aufgrund eines demographischen Verstärkereffekts schwierig den regressiven Trend umzukehren.
Bis zum Anfang der 1970er Jahre verlief die Entwicklung der TFR in der DDR und der BRD in etwa gleich (siehe Abb. 6). Aber bedingt durch die pronatalische Familienpolitik (bezahlte Freistellung von Müttern in der Erwerbsarbeit; Verbesserung der Kinderbetreuung usw.), stieg in der DDR die TFR bis 1980 auf 1,94 Kinder/Frau, während sich in der BRD die TFR bei ca. 1,4 Kindern pro Frau einpendelte (StBA 2006b: 28). Bis zur Wende 1989 sank auch in der DDR die TFR wieder leicht. Danach hat sich das Gebärverhalten der ostdeutschen Frauen nachhaltig verändert und ging von damals 1,57 auf 0,77 (1993) zurück (Ehmer 2004: 45). Begründet wurde diese Entwicklung durch die unsichere wirtschaftliche Lage und den Wegfall von bis dahin gewährten Vergünstigungen für junge Familien (Ragnitz 2008: 5). Birg fügt zusätzlich die „neue Freiheit" an (Birg 2001: 48). Mitte der 1990er Jahre kam es wieder zu einem Anstieg der Geburtenhäufigkeit in den neuen Ländern und zwar auf 1,31 Kinder pro Frau im Jahre 2004 (StBA 2006b: 28). Einige Gründe für den Rückgang der Geburten sind der gesellschaftliche Wertewandel, die Emanzipation der Frau, die gesellschaftliche Akzeptanz von Kinderlosigkeit, die schlechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, verbesserte Bildungschancen für Frauen und die Einführung der Antibabypille (Geißler 2002: 57f.; Münz 2007: 5; Hradil 2006: 51).
2.2.2 Migration
Wanderungen sind in der Zukunft die einzige Quelle demographischen Wachstums, aber gleichwohl eine sehr instabile Komponente der Bevölkerungsentwicklung, da sie schwer vorhersehbar ist.
Der Begriff Migration19 kommt vom lateinischen Wort migrare bzw. migratio und bedeutet wandern, wegziehen, Wanderung ( Reader´s Digest 2002 (Band 12): 39). Migration ist eine auf Dauer angelegte räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes im engeren oder weiteren geographischen Raum (Beijer 1969: 1261) und erfolgt i.d.R. dann, wenn „eine Gesellschaft [ein Staat] die Erwartungen ihrer Mitglieder nicht erfüllen kann." (Kröhnert 2007: 1) Migrationsbewegungen verändern die Bevölkerungszahl wie auch die Bevölkerungsstruktur (Höpflinger 1997: 97). Sie können eine „Ausgleichs- und Erglnzungsfunktion" haben, die einen „Abbau regionaler überschussbevölkerung oder die Auffüllung regionaler Leerrlume durch Verlagerung" (Köllmann/Marschalck 1972: 13) herbeiführen kann. Grundsätzlich beschreibt die Migration eine Form der Mobilität, diese wird in räumliche Mobilität (Wanderungen/Migration) und soziale Mobilität (Positionsverschiebungen in einem sozialen System) unterteilt (Schwarz/Kannenwischer 2005: 85/86). Wichtig ist im Rahmen des demographischen Wachstums nur die räumliche Mobilität, mit den drei Typen der Migration: Einwanderung, Auswanderung, Binnenwanderung.
Man unterscheidet internationale Migration bzw. Außenwanderungen über die Grenzen eines Landes und Binnenwanderungen über die Grenzen von Teilgebieten eines Landes. Wanderungsentscheidungen haben immer auf zwei Gebiete, Staaten oder Gesellschaften einen Bezug, nämlich der Zu- und Abwanderungsregion. Dies führte zur Entstehung der sog. „Push-Pull-Hypothese" (Li becke/Ströhlein 2002: 17), ein Ansatz zur theoretischen Erklärung und Beschreibung von Migrationsbewegungen. Diese Theorie geht davon aus, „dass bestimmte AbstoBungsfaktoren (Push) einer Herkunftsregion [z.B. Arbeitslosigkeit, Krieg, usw.] in Kombination mit Anziehungsfaktoren (Pull) einer Zielregion [z.B. Arbeit, Frieden, usw.] fir Wanderungsentscheidungen verantwortlich sind" (Hoßmann et al. 2009: 29). In erster Linie sind bei der Migration strukturelle/ökonomische Faktoren verantwortlich, da Länder mit einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung i.d.R. einen positiven Wanderungssaldo aufweisen können. Der Wanderungssaldo hat einen großen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung. Er bezeichnet die Differenz zwischen den Zuzügen nach und den Fortzügen aus Deutschland, auch Außenwanderungssaldo genannt.
Erhebungsgrundlage sind die An- und Abmeldeformulare der jeweiligen Meldeämter und die amtliche Zuzugs- und Fortzugsstatistik.
Wie bereits erwähnt, ist die Migration verglichen mit den anderen demographischen Faktoren eine Komponente mit größeren Unsicherheiten und ist somit erheblichen Schwankungen unterworfen, da sie von politischen, demographischen, ökologischen, ökonomischen usw. Rahmenbedingungen im Inland und im jeweiligen Herkunftsland der Zuwanderer abhängt. Konkrete künftige Entwicklungen in der Migration und ihre Auswirkungen sind somit schwer vorherzusagen. Betrachtet man aber die Zu- und Fortzüge nach bzw. aus Deutschland getrennt, bleibt festzuhalten, dass die Zuzüge großen Schwankungen unterworfen sind und die Fortzüge im Zeitverlauf dagegen stabil geblieben sind. Grundsätzlich ist die zuziehende Bevölkerung jünger als die fortziehende und es kommt dadurch zu einem Verjüngungseffekt der Außenwanderung (Priebe 2006: 23).
Nach internationaler Übereinkunft sind folgende Personengruppen von der Wanderungsstatistik ausgenommen: die in fremden Ländern anerkannten und akkreditierten Journalisten, ausländische Studenten, im diplomatischen Dienst tätige Personen anderer Länder (Esenwein-Rothe 1982: 155). Von der Außenwanderung abzugrenzen sind (tägliche) Pendelwanderungen (zur Arbeit, zur Schule usw.), saisonale Wanderungen (Saisonarbeit) und die Ortsveränderung (z.B. Umzüge in eine näher gelegene Umgebung/Stadt oder Umzug in der gleichen Gemeinde) (Ebd.: 157).
Auf die Binnenwanderung wird nur kurz eingegangen, denn sie hat zwar ebenso wie die Außenwanderung einen Einfluss auf die Bevölkerungs- bzw. Altersstruktur, aber nur in regionaler Hinsicht. Das Ziel dieser Arbeit ist die Gesamtsituation Deutschlands darzustellen und nicht regionale Situation.
Die Binnenwanderung unterscheidet sich von der Außenwanderung dadurch, dass keine Staatsgrenzen übertreten werden (Faßmann 2007: 1) und dass sich damit die Bevölkerungszahl in Deutschland nicht verändert (StBA 2008c: 15). Die Binnenwanderung verläuft geographisch und demographisch entlang klarer Linien, von Nord nach Süd und von Ost nach West und in den letzten Jahren war eine Suburbanisierung (Stadt-Umland-Wanderung) zu beobachten. Der Bevölkerungsrückgang war bisher in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland (1989 bis heute), weswegen es in Ostdeutschland zu einer demographischen Alterung kam, die darin begründet ist, dass hauptsächlich die junge Bevölkerung den Osten verlässt.
Laut dem Migrationsbericht von 2007 war der Außenwanderungssaldo für das Jahr 2007 in Deutschland positiv und lag bei 43.912, während 636.854 Menschen abwanderten zogen 680.766 Menschen zu (BAMF 2007: 16).
2.2.2.1 Geschichte der Migration
Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert war Deutschland ein Auswanderungsland (Ehmer 2004: 27), aber diese Entwicklung hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich verändert. Mittlerweile hat sich Deutschland zu einem Einwanderungsland entwickelt, zu einem Land, „dessen Bevölkerung erheblich durch internationale Wanderungen und deren Folgen geprägt ist" (Korcz/Schlömer 2008: 153).
Die deutsche Einwanderungsgeschichte begann in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs (Hradil 2006: 56). In der Zeit von 1945 bis 1949 (Nachkriegswanderungen) sind ca. 12 Mio. Vertriebene und Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Deutschland gekommen (8 Mio. nach Westdeutschland, 4 Mio. nach Ostdeutschland) (Ebd.). Mit dem Bau der Berliner Mauer (1961) endete die meist arbeitsbedingte Ost-West-Wanderung zwischen der DDR und der BRD. Der daraus folgende Rückgang der ostdeutschen Arbeitskräfte erforderte eine massive Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte (Gastarbeiter), vornehmlich aus den Mittelmeerländern, um die expandierende Wirtschaft Westdeutschlands befriedigen zu können. Die Anwerbung erfolgte mit dem Ziel, dass der Aufenthalt der Gastarbeiter zeitlich begrenzt sein sollte. Die DDR warb ebenfalls ab den 1960er Jahren sog. Vertragsarbeiter an, vorwiegend aus Polen, Mosambik, Ungarn und Vietnam. Aufgrund des Ölpreisschocks und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise Anfang der 1970er Jahre kam es in der Bundesrepublik 1973 zu einem sog. Anwerbestopp für die „Gastarbeiter" (BMGS 2003: 54, siehe Abb. 7). Trotz dieses Anwerbestopps blieben viele Gastarbeiter und aus ihnen wurden De-facto-Einwanderer. In dieser Zeit verließen mehr Menschen die Bundesrepublik als zugewandert sind, obwohl es zu zahlreichen Familiennachzügen der Gastarbeiter kam (Dobritz et al. 2008: 13). Die politischen Umbrüche Ende der 1980er Jahre führten zu einem deutlichen Anstieg der Zuwanderung nach Deutschland (siehe Abb. 7), überwiegend aus Osteuropa ((Spät-) Aussiedler) (BMGS 2003: 54) und 1992 wurde der Höhepunkt der Zuwanderung verzeichnet mit mehr als 1,2 Mio. Immigranten und rund 300.000 deutschstämmigen Personen (Wanderungssaldo von ca. 800.000) (Dobritz et al. 2008 : 56). Zwischen den 1980er und frühen 1990er Jahren kamen vermehrt Flüchtlinge und Asylbewerber nach Deutschland. Dies lag zum Einen an den Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien und zahlreichen politischen Flüchtlingen (Hradil 2006: 57). Seit 2000 ist in Deutschland ein Ubergang zur sog. „aktiven" Migrationspolitik zu verzeichnen. Mit der Einführung des neuen Staatsbürgerschaftsrechts (2000), der Greencard (2000) oder durch das neue Zuwanderungsgesetz von 2005 mit seiner Novelle von 2007 sank in den darauf folgenden Jahren die Zahl der Zuzüge kontinuierlich.
Insgesamt sind laut Statistischem Bundesamt zwischen 1991 und 2007 ca. 15,8 Mio. Menschen nach Deutschland zugezogen Im gleichen Zeitraum sind indes rund 11,6 Mio. Menschen fortgezogen (BAMF 2007: 15). Das ergibt einen positiven Wanderungssaldo für diese Zeit von ca. 4,2 Mio. Personen. Laut Statistischem Bundesamt war der Außenwanderungssaldo der letzten 50 Jahre überwiegend positiv, wenn auch schwankend, und lag im Durchschnitt zwischen 150.000 und 300.000 Personen (StBA 2006b: 51).
2.2.3 Mortalität
Die Mortalität hat ebenso einen großen Einfluss auf die künftige Bevölkerungsentwicklung. Mortalität oder Sterblichkeit20 kommt vom lateinischen mortalis und bedeutet das Sterben (Reader´s Digest 2002 (Band 12): 172). Unter Mortalität versteht man die Zahl der Sterbefälle während eines Zeitraumes innerhalb der Bevölkerung. Sie wird zum einen von der Altersstruktur einer Bevölkerung und zum anderen durch die Lebenserwartung determiniert (Höpflinger 1997: 10f.). Die Mortalität wird von medizinischen, biologischen und sozioökonomischen Determinanten und von der individuellen Lebensweise bestimmt. Sie wird durch verschiedene demographische Kennziffern gemessen. Beispielsweise durch die (rohe) Sterberate, das Medianalter (hierauf wird noch gesondert in Kapitel 2.2.4 eingegangen) und die Lebenserwartung. Auf die Sterberate wird hier nicht explizit eingegangen, da sie nicht von Belang ist.
Eine zentrale Komponente für den demographischen Wandel ist die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ist „die durchschnittliche Zahl der zu erwartenden Lebensjahre einer Person" unter der Annahme, dass die Sterblichkeitsverhältnisse konstant bleiben (Hoßmann et al. 2009: 23). Sie wird mittels der Sterbetafel21 geschätzt, in die die aktuellen Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Altersjahre, im jeweiligen Alter zu sterben, eingehen. Unterschieden werden die Lebenserwartung bei Geburt (für Neugeborene) sowie die fernere Lebenserwartung (für Menschen ab einem bestimmten Alter). Die Lebenserwartung bei Geburt, also die durchschnittliche Lebenserwartung, wird durch die Anzahl der Jahre beeinflusst, die Neugeborene durchschnittlich leben würden, wenn die Einflussfaktoren konstant blieben. Die fernere Lebenserwartung ist die durchschnittliche Zahl der in einem bestimmten Alter noch zu erwartenden Lebensjahre (meist für 60-jährige) (Ebd.). Die Lebenserwartung ist aber nur ein Schätzwert, denn sie verändert sich mit der Zeit, da die Einflussfaktoren meist nicht konstant bleiben. Generell ist die Lebenserwartung bei Frauen höher als bei Männern. Gründe dafür sind von unterschiedlicher Natur. Die höhere Lebenserwartung bei Frauen ist „biologisch-, verhaltens- und umwelt- bzw. gesellschaftsbedingt" (Birg 2006: 99). Mittlerweile holen die Männer in der Lebenserwartung auf und die Differenz zwischen Männern und Frauen verringert sich.
Aktuell liegt die Lebenserwartung für neugeborene Jungen bei knapp 77 Jahren und für neugeborene Mädchen bei knapp über 82 Jahren (siehe Abb. 8). Die ferne Lebenserwartung liegt derzeit für 60-jährige Männer bei rund 21 Jahren und bei 60-jährigen Frauen bei ca. 25 Jahren (Dobritz et al. 2008: 47). Im Jahr 2007 sind 827.155 Menschen in Deutschland gestorben.22
2.2.3.1 Geschichte der Mortalität
Bevölkerungswissenschaftliches Forschen wurde mit der Analyse der Sterblichkeit eröffnet (Höhn, 2000: 751). Die Sterbetafel ist das älteste demographische Modell und wurde erstmals 1665 von John Graunt23 mittels empirischer Befunde über die Bevölkerungsentwicklung von London errechnet.
Ende des 18. Jahrhunderts begann die Sterblichkeit in Deutschland aufgrund ständiger Verbesserungen im Bereich Ernährung, Hygiene und der medizinischen Versorgung langsam zu sinken (Hradil 2006: 43). Während der beiden Weltkriege schwankte die Sterblichkeitsrate erheblich. Nach dem Zweiten Weltkrieg sank auch die Sterblichkeit im höheren Alter, hauptsächlich durch weitere Fortschritte in der Medizin und einer verbesserten finanziellen Versorgung der älteren Menschen (Höhn 1997: 78f). 1945 sind noch ca. 1 Mio. Menschen in Gesamtdeutschland (DDR und BRD zusammen) gestorben, 1960 waren es nur noch rund 880.000, 1985 930.000, 1992 dann rund 885.000 (StBA 2008d). Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Sterblichkeit in Deutschland in allen Altersgruppen leicht rückläufig (Dobritz et al. 2008: 47).
Die Lebenserwartung ist seit ca. 130 Jahren in Deutschland kontinuierlich angestiegen (StBA 2006b: 36, siehe Abb. 8). Die durchschnittliche Lebenserwartung für Mädchen und Jungen hat sich seit 1850 mit 37 Jahren auf 78 Jahre im Jahre 2000 mehr als verdoppelt, (während die Säuglingssterblichkeit im gleichen Zeitraum von 23% auf 0,4% zurückging) (Schimany 2003: 119). Die Sterbetafel von 1924 und 1926 wies erstmals eine durchschnittliche Lebenserwartung von über 50 Jahren für beide Geschlechter auf (Jungen: 56, Mädchen: 58,8) und 1960 lag sie bei Jungen bereits bei fast 67 Jahren, bei Mädchen bei knapp über 72 Jahren. Anfangs der 1990er Jahre betrug die durchschnittliche Lebenserwartung bei Jungen bei 72,5 und bei Mädchen bei 79 Jahren, ist stetig weiter gestiegen und liegt heute bei 77 (Jungen) und 82 (Mädchen) (StBA 2006b: 38).
Auch die fernere Lebenserwartung ist ebenfalls stark angestiegen, betrug sie bei 60-jährigen Männern 1871 immerhin schon 12, 1 Jahre und bei Frauen 12, 7 Jahre, ergab sie 2002/2004 bereits 20 Jahre für Männer und 24,1 Jahre für Frauen (Ebd.: 37). Hierdurch wird deutlich, dass bereits 1871, also vor fast 140 Jahren, sowohl Männer als auch Frauen ein sehr hohes Alter erreichen konnten.
In der DDR verlief die Entwicklung der Lebenserwartung bis Mitte der 1970er Jahre im Vergleich zur Bundesrepublik in etwa gleich (StBA 2006b: 39). Ab 1977 erlahmte der Anstieg der Lebenserwartung und stieg bis Ende der 1980er Jahre wesentlich langsamer an als in der BRD. Zu Beginn der 1990er Jahre war die Lebenserwartung bei Geburt von Jungen um 3,2 Jahre und bei Mädchen um 2,3 Jahre niedriger als in den alten Bundesländern. Es wird angenommen, dass der Angleichungsprozess zwischen West- und Ostdeutschland bis zum Jahr 2010 abgeschlossen ist (BMGS 2003: 53).
Bezüglich der Differenz in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen kam es bereits zu einer Annäherung. Diese Annäherung ist seit 1980 in der BRD zu beobachten (siehe Abb. 8). 1970 betrug die Differenz 6,4 Jahre und 2004 waren es nur noch 5,6 Jahre, also bereits 0,8 Jahre weniger (StBA 2006b: 41).
Gründe für den Anstieg der Lebenserwartung und den Rückgang der Sterblichkeit sind der ständige medizinische Fortschritt, die Anhebung des Lebensstandards (verbesserte Ernährung, bessere Wohnverhältnisse usw.), verbesserte Hygiene, die besseren Arbeitsbedingungen usw. (Ehmer 2004: 38ff.). Viele Wissenschaftler sind sich allerdings nicht einig über die vielfältigen Gründe, die zu einer Zunahme der Lebenserwartung führten, sie sind sich aber darüber einig, dass eine Verflechtung von Ursachen dazu geführt hat (Imhof 1994: 63). Heutzutage leben die Menschen länger, sterben dafür aber an anderen Krankheiten als damals. Früher starb man an Infektionskrankheiten (z.B. Tuberkulose), heute zählen Herz-Kreislauferkrankungen oder Krebs zu den häufigsten Todesursachen (Kröhnert/Münz 2008: 1). Der hauptsächliche Grund für die gestiegene Lebenserwartung ist aber der Rückgang der Kinder- und Säuglingssterblichkeit und das weniger Menschen vorzeitig sterben (Höpflinger 1997: 145).
[...]
1 ,vorwegzunehmen ist der Hinweis, dass in der Literatur die Begriffe „Demographie" und „Demografie" nebeneinander verwendet werden. Im Folgenden wird der Begriff „Demographie" verwendet.
2 Interview mit Meinhard Miegel („Die Welt" vom 26.10.2007, S. 10).
3 Anfang 1992 wurde die Enquete-Kommission „Demographischer Wandel — Herausforderungen unserer alter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik" ins Leben gerufen. Die Kommission sollte im Auftrag der Bundesregierung die Bevölkerungsentwicklung aufbereiten und bewerten, welche Folgen sich daraus ergeben,
4 „Frankfurter Rundschau" vom 13.01.1999, 55. Jahrgang, Nr.:10/2 zitiert nach Frevel 2004: 7.
5 Die Begriffe „Demographie" und „Bevölkerungswissenschaft" werden synonym verwendet.
6 Hauptwerk von Malthus: „An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorect and other Writers", 1798.
7 Die Bevölkerung vermehrt sich in geometrischer Progression, die Nahrungsmittelmenge dagegen nur in arithmetischer Reihe.
8 „Grundriss der Bevölkerungswissenschaft (Demographie)", 1950.
9 „Bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung", 1953.
10 An den Universitäten Bamberg, Bielefeld, Berlin (Humboldt-Universität) und Rostock (zwei Lehrstühle).
11 In Frankreich wurden diese Beobachtungen im 19. Jahrhundert zuerst gemacht. Es folgten Großbritannien, Deutschland, Österreich-Ungarn und im frühen 20. Jahrhundert dann Süd- und Osteuropa.
12 Die Begriffe „Fruchtbarkeit" und „Fertilität" werden synonym verwendet.
13 Gemeint sind nur lebend geborene Kinder.
14 Die Begriffe „Gesamtfruchtbarkeitsrate" und „Fertilitätsrate" werden synonym verwendet und später mit TFR abgekürzt.
15 Diese bestandserhaltende Geburtenziffer muss etwas oberhalb von 2 liegen, weil regelmäßig mehr Jungen als Mädchen geboren werden.
16 https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/online;jsessionid= CEC4F3FAD7C94224B88052DD41CD58D2.tcggen2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&lev elid=1239895673992&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnu ngsstruktur&auswahlziel=werteabruf&werteabruf=Werteabruf (Zugriff am 23.02.2009).
17 Gilt ab hier nur für die Bundesrepublik 1945 — 1989.
18 https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/ online;jsessionid=F90828B525E6CB8DB85FC95E9B0671FE.tcggen2?operation=abruftabelleBearbeiten&le velindex=2&levelid=1239875550167&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlver zeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&werteabruf=Werteabruf (Zugriff am 15.02.2009).
19 Die Begriffe „Migration" und „Wanderung" werden synonym verwendet.
20 Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Mortalität mit Sterblichkeit gleichgesetzt.
21 Die Sterbetafel ist ein Modell, mit dem sich die Sterblichkeitsverhältnisse einer Population zahlenmäßig darstellen lassen (Hoßmann et al. 2009: 34).
22 https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/online;jsessionid= 514BDA2A1D00B207B790DAD3DE525129.tcggen1?operation=previous&levelindex=3&levelid=1239886 754558&step=3 (Zugriff am 16.04.2009).
23 Hauptwerk von John Graunt: „Bills of Mortality", 1665.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem demographischen Wandel?
Es bezeichnet die Entwicklung einer alternden und gleichzeitig schrumpfenden Bevölkerung, bedingt durch niedrige Geburtenraten und steigende Lebenserwartung.
Welche Folgen hat der Wandel für den Arbeitsmarkt?
Das Arbeitskräftepotenzial sinkt, während das Durchschnittsalter der Belegschaften steigt, was Anpassungen in der Personalplanung erfordert.
Was bedeutet „Rente mit 67“ in diesem Kontext?
Es ist eine politische Maßnahme, um die Lebensarbeitszeit zu verlängern und die sozialen Sicherungssysteme angesichts der Alterung zu stabilisieren.
Welche Instrumente zur Förderung älterer Arbeitnehmer gibt es?
Die Arbeit nennt Kombilöhne, Eingliederungszuschüsse und spezifische Qualifizierungsmaßnahmen für ältere Beschäftigte.
Warum sind Unternehmen in der Pflicht?
Unternehmen müssen Strategien entwickeln, um die Beschäftigungsfähigkeit ihrer älter werdenden Mitarbeiter langfristig zu erhalten.
- Quote paper
- Diplom-Sozialwirt Sebastian Krell (Author), 2009, Demographischer Wandel und ältere Arbeitnehmer in Deutschland , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133732