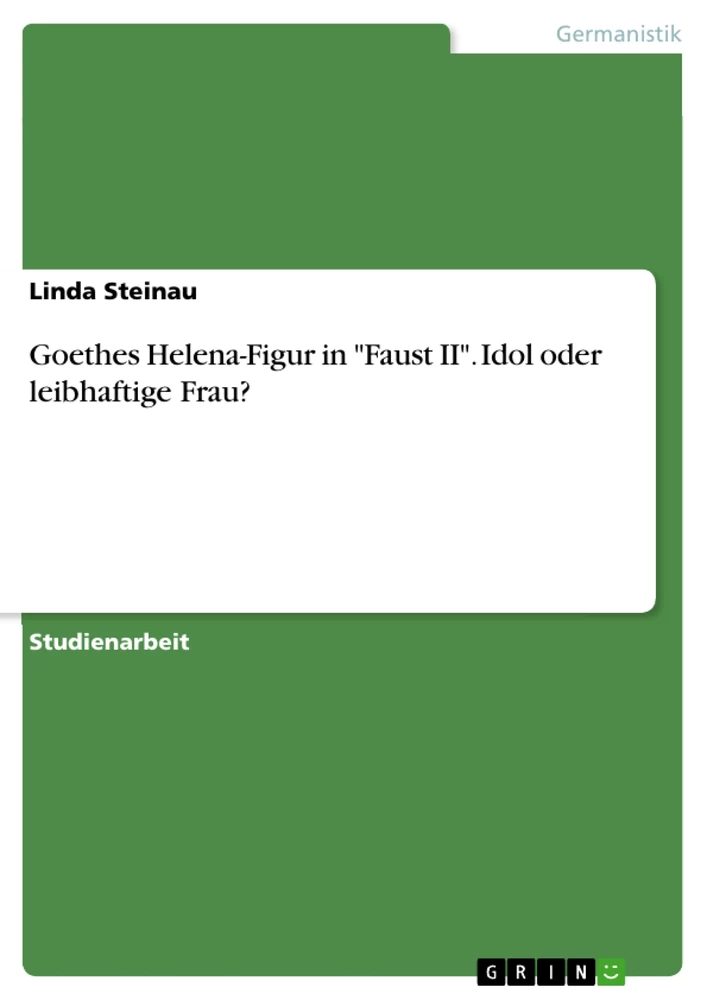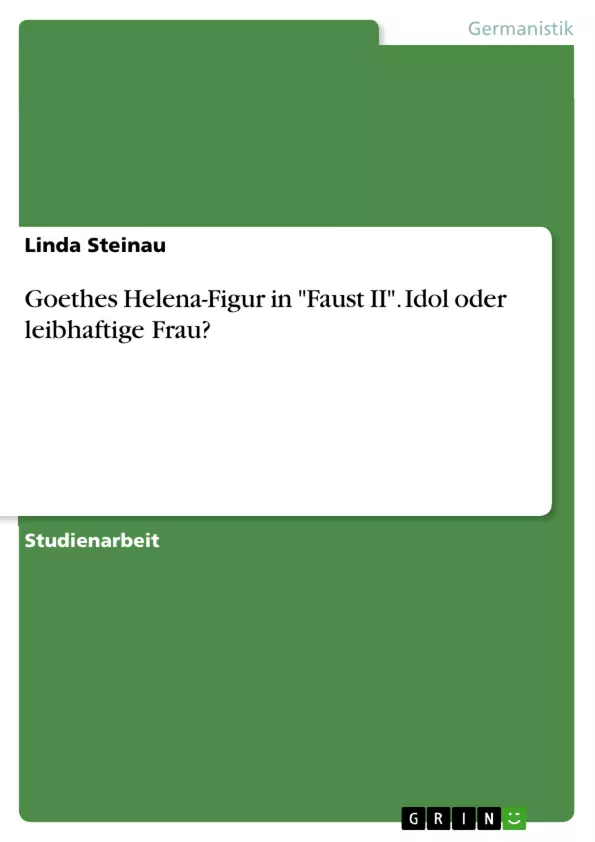Gelingt es Helena, sich von der Figur, welche die Mythen besingen, frei zu machen und zu einer menschlichen, leibhaftigen Person zu werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Hierfür beschränke ich mich hauptsächlich auf den dritten Akt von Faust II und ziehe nur einzelne Passagen aus Faust I heran. Helena wird zunächst als idolhafte Gestalt betrachtet, dann als Nachahmung der griechischen Ästhetik, die auch ethische Werte impliziert. Im zweiten Teil der Arbeit folgt eine Auseinandersetzung mit den Spannungsmomenten zwischen ihrer Rolle als Inbegriff der Schönheit, einer femme fatale und Projektionsfläche männlicher Phantasien einerseits und ihrer Gestaltung als psychologisch durchschaubare, lebendige Frau andererseits. Der letztgenannte Aspekt wird vor allem bei ihrer Schilderung als liebende Frau und Mutter deutlich. Wie die Darstellung ihrer Figur, so ist auch die Beziehung zu Faust vielfältig und Gegenstand der Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Helena als Idol und personifizierte Schönheit
- 2.1. Helenas erster Auftritt
- 2.2. „Ich schwinde hin und werde selbst mir ein Idol.“ (V. 8881)
- 2.3. Goethes Helena als Inbegriff griechischer Ästhetik
- 2.3.1. Der Begriff der Pflicht
- 2.3.2. Der Begriff der Würde
- III) Spannungsmomente der Helena-Figur
- 3.1. Helena mit Biografie
- 3.2. Helena und Faust als Liebespaar
- 3.3. Helena als Mutter
- IV) Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Helena-Figur in Goethes Faust II. Ziel ist es, die Ambivalenz ihrer Rolle als Idol und leibhaftige Frau zu analysieren und die Spannungsmomente aufzuzeigen, die sich aus dieser Doppelrolle ergeben. Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf den dritten Akt von Faust II.
- Helena als Inbegriff griechischer Schönheit und Idol
- Die Ambivalenz von Helenas Schönheit: Ideal vs. Wirklichkeit
- Spannung zwischen idealisierter und menschlicher Darstellung Helenas
- Helenas Beziehung zu Faust
- Helenas Entwicklung als liebende Frau und Mutter
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach Helenas Wandel von der mythischen Idealgestalt zur leibhaftigen Frau in Goethes Faust II. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf den dritten Akt von Faust II konzentriert, und kündigt die weiteren Kapitel an, die Helenas Rolle als Idol, die Spannungsmomente ihrer Figur und ihre Beziehung zu Faust untersuchen werden.
II) Helena als Idol und personifizierte Schönheit: Dieses Kapitel analysiert Helenas Darstellung als Idol und personifizierte Schönheit, beginnend mit ihrem ersten Auftritt in Faust I und ihrer weiteren Entwicklung in Faust II. Es untersucht die Wahrnehmung Helenas als unerreichbares Ideal weiblicher Schönheit, als Projektionsfläche männlicher Begierde und als Inbegriff griechischer Ästhetik, wobei auch ethische Implikationen dieser Ästhetik betrachtet werden. Die Diskussion der verschiedenen Interpretationen von Helenas Schönheit und ihrer Rolle als Idol bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust II, Helena, Idol, Schönheit, griechische Ästhetik, Ambivalenz, Spannungsmomente, Liebespaar, Mutter, Männliche Phantasie, Ideal vs. Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Goethe's Faust II - Helena Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Helena-Figur in Goethes Faust II. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz ihrer Rolle als Idol und leibhaftige Frau sowie den daraus resultierenden Spannungsmomenten. Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf den dritten Akt von Faust II.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Helena als Inbegriff griechischer Schönheit und Idol; die Ambivalenz von Helenas Schönheit (Ideal vs. Wirklichkeit); die Spannung zwischen idealisierter und menschlicher Darstellung Helenas; Helenas Beziehung zu Faust; und Helenas Entwicklung als liebende Frau und Mutter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: I) Einleitung; II) Helena als Idol und personifizierte Schönheit (inkl. Unterkapitel zu Helenas erstem Auftritt, ihrer Selbstwahrnehmung als Idol und ihrer Darstellung als Inbegriff griechischer Ästhetik mit den Aspekten Pflicht und Würde); III) Spannungsmomente der Helena-Figur (inkl. Unterkapitel zu Helenas Biografie, ihrer Beziehung zu Faust und ihrer Rolle als Mutter); IV) Schluss.
Wie wird Helena in der Arbeit dargestellt?
Helena wird als ambivalente Figur dargestellt: einerseits als unerreichbares Ideal weiblicher Schönheit und Idol, andererseits als leibhaftige Frau mit einer komplexen Biografie und Beziehungen. Die Arbeit untersucht die Wahrnehmung Helenas als Projektionsfläche männlicher Begierde und die ethischen Implikationen ihrer idealisierten Darstellung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Ambivalenz von Helenas Rolle als Idol und leibhaftige Frau und die Aufdeckung der daraus resultierenden Spannungsmomente. Die Arbeit untersucht Helenas Wandel von der mythischen Idealgestalt zur leibhaftigen Frau in Goethes Faust II.
Auf welchen Akt von Faust II konzentriert sich die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf den dritten Akt von Faust II.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Faust II, Helena, Idol, Schönheit, griechische Ästhetik, Ambivalenz, Spannungsmomente, Liebespaar, Mutter, Männliche Phantasie, Ideal vs. Wirklichkeit.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf den dritten Akt von Faust II konzentriert und die Rolle Helenas als Idol, die Spannungsmomente ihrer Figur und ihre Beziehung zu Faust untersucht.
- Citar trabajo
- Linda Steinau (Autor), 2012, Goethes Helena-Figur in "Faust II". Idol oder leibhaftige Frau?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1337436