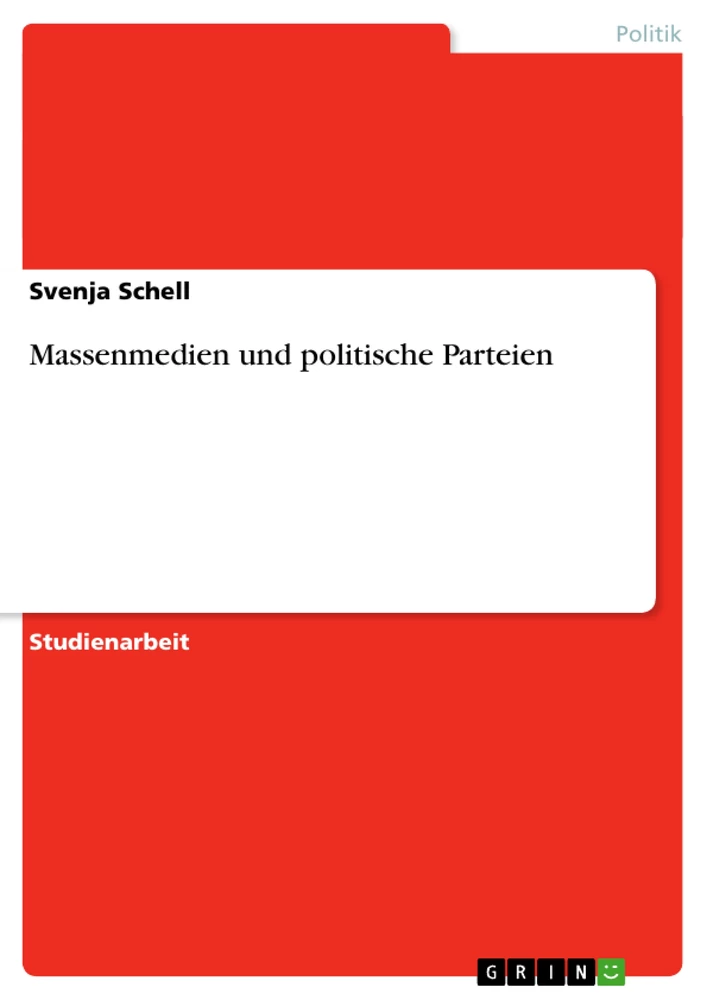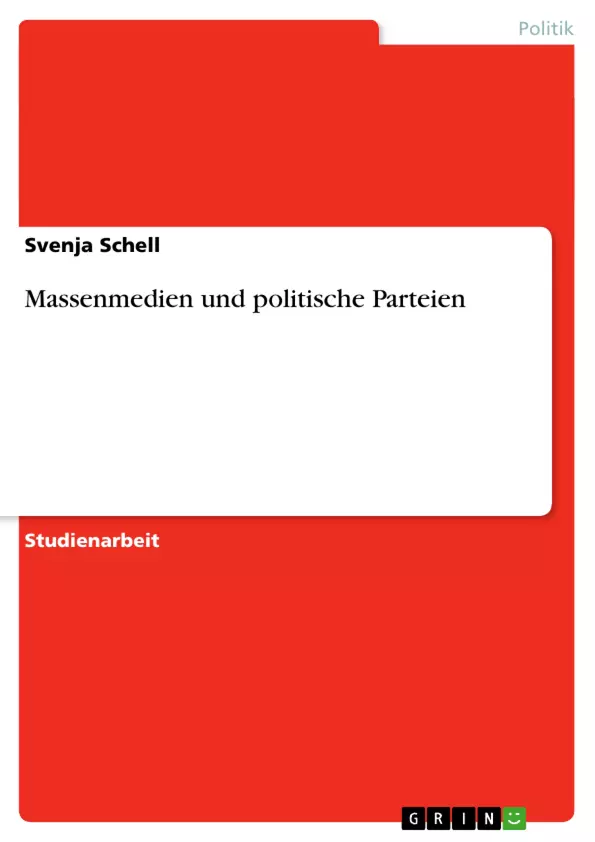Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der politischen Bedeutung der Medien in
der sogenannten Informationsgesellschaft, die neuerdings auch als „Mediengesellschaft“
bezeichnet wird. Es sollen dabei nicht nur die klassischen Medien - Hörfunk,
Fernsehen und Printmedien - thematisiert, sondern auch das Internet als neuartiges,
für jeden frei zugängliches Kommunikations- und Publikationsmittel mit einbezogen
werden. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Betrachtung der Relevanz der Massenmedien
für die Arbeit politischer Parteien und die hier vor sich gegangenen Veränderungen
der letzten Jahre und Jahrzehnte sowie deren Ursachen.
In Teil 2 der Arbeit geht es um die von vielen Wissenschaftlern prognostizierte, fortschreitende
Entwicklung der alten Parteiendemokratie in eine sogenannte Mediendemokratie.
Daran anschließend werden die Massenmedien und ihre politischen
Funktionen sowie ihr Einfluss auf die politische und hier vor allem auf die interne und
externe Parteienkommunikation beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem
Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Parteien bzw. des Parteiensystems in der
Mediendemokratie sowie mit den durch diesen Wandel hervorgerufenen Veränderungen
der parteilichen Kommunikation. Im fünften Kapitel werden einige Beispiele
für medienorientierte Parteiarbeit erläutert.
Als Grundlage für die Arbeit dient der Sammelband „Parteien in der Mediendemokratie“
von Ulrich von Alemann und Stefan Marschall, der 2002 beim Westdeutschen
Verlag erschien und eine Reihe von Beiträgen verschiedener Autoren zum Thema
„Parteien und Massenmedien“ enthält. Alle weiteren verwendeten Quellen sind im
anliegenden Literaturverzeichnis und in den Fußnoten aufgeführt.
Inhalt
1. Einführung
2. Parteiendemokratie und Mediendemokratie
2.1 Parteiendemokratie im Veränderungsprozess
2.2 Die politische Relevanz der Medien
2.3 Mediendemokratie – Medien als „vierte Gewalt“ im politischen System
3. Massenmedien und politische Kommunikation
3.1 Politische Funktionen der Medien
3.2 Öffentliche Meinung und Öffentlichkeit
3.3 Politische Kommunikation
3.3.1 Organisation der Parteienkommunikation
4. Strukturwandel von Öffentlichkeit und Parteien in der Mediendemokratie
4.1 Parteikommunikation im Strukturwandel der Öffentlichkeit
4.2 Strukturwandel von Parteien und Parteiensystem
5. Beispiele medienorientierter Parteiarbeit
5.1 Parteitage
5.2 Internet und politische Kommunikation
5.3 Wahlkampfkommunikation
6. Abschließende Bemerkung
Literaturverzeichnis
1. Einführung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der politischen Bedeutung der Medien in der sogenannten Informationsgesellschaft, die neuerdings auch als „Mediengesell-schaft“ bezeichnet wird. Es sollen dabei nicht nur die klassischen Medien - Hörfunk, Fernsehen und Printmedien - thematisiert, sondern auch das Internet als neuartiges, für jeden frei zugängliches Kommunikations- und Publikationsmittel mit einbezogen werden. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Betrachtung der Relevanz der Mas-senmedien für die Arbeit politischer Parteien und die hier vor sich gegangenen Ver-änderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte sowie deren Ursachen.
In Teil 2 der Arbeit geht es um die von vielen Wissenschaftlern prognostizierte, fort-schreitende Entwicklung der alten Parteiendemokratie in eine sogenannte Medien-demokratie. Daran anschließend werden die Massenmedien und ihre politischen Funktionen sowie ihr Einfluss auf die politische und hier vor allem auf die interne und externe Parteienkommunikation beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Parteien bzw. des Parteiensystems in der Mediendemokratie sowie mit den durch diesen Wandel hervorgerufenen Verände-rungen der parteilichen Kommunikation. Im fünften Kapitel werden einige Beispiele für medienorientierte Parteiarbeit erläutert.
Als Grundlage für die Arbeit dient der Sammelband „Parteien in der Mediendemokra-tie“ von Ulrich von Alemann und Stefan Marschall, der 2002 beim Westdeutschen Verlag erschien und eine Reihe von Beiträgen verschiedener Autoren zum Thema „Parteien und Massenmedien“ enthält. Alle weiteren verwendeten Quellen sind im anliegenden Literaturverzeichnis und in den Fußnoten aufgeführt.
2. Parteiendemokratie und Mediendemokratie
Im Artikel 21 (1) des Grundgesetzes heißt es „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Auf welche Weise aber tun sie dies? Wodurch wird es ihnen ermöglicht, die rund 61,2 Millionen1 Wahlberechtigten zu erreichen und ih-nen ihre Ziele und Inhalte näher zu bringen? Und wer - außer den politischen Partei-en - hat die Möglichkeit, Einfluss auf das Wahlverhalten der Bürger auszuüben?
Die Beantwortung solcher Fragen führt unweigerlich zu den Massenmedien, deren Arbeit im politischen Kontext eng mit der Arbeit der Parteien verwoben ist. Die zu-nehmende Bedeutung von Öffentlichkeit und Medien in der politischen Kommunikati-on stärkt die Machtposition der Medien, was, wird Macht als begrenzte Ressource unterstellt, zu Lasten anderer Akteure geschehen müsste. 2 Naheliegend wäre hier, so Alemann und Marschall, die Parteien, die traditionellen Schlüsselorganisationen repräsentativer Systeme als Leidtragende der Umverteilung der Macht auszuma-chen. Diese Annahme wird auch durch die immer wieder auftauchende Begrifflichkeit der „neuen Mediendemokratie“, welche die alte Parteiendemokratie ersetzt, unter-stützt. Alemann und Marschall gehen jedoch nicht davon aus, dass es sich hier um zwei sich ausschließende Konzepte handelt. Sie sprechen vielmehr von einer kom-plexen Verbindung zwischen Parteien und Medien, da beide als Vermittler politischer Inhalte in gewisser Weise voneinander abhängig sind und ihre Tätigkeiten nur mit Unterstützung des jeweils anderen sinnvoll ausüben können. Sie stehen sozusagen in einem „symbiotischen“ Verhältnis.
2.1 Parteiendemokratie im Veränderungsprozess
Der Begriff der „Parteiendemokratie“, der sich über die Jahre in den Sozialwissen-schaften etabliert hat, betont vor allem die zentrale Rolle der Parteien als Hauptak-teure im politischen Geschehen: Alemann und Marschall beschreiben Parteien als die bestimmenden Organisationen der Politik, die staatliches Handeln legitimieren. Sie sind verantwortlich für die Ausbildung politischen Personals und fungieren als zentrale Organisationen politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung. Über sie kann das Volk politischen Einfluss ausüben und sich so selbst verwirklichen3. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich jedoch vermehrt Kritik an der Rolle der Par-teien entwickelt, die ihren Höhepunkt in den 90er Jahren fand und nach der die Par-teien ihr gesellschaftliches Fundament angeblich zwar verloren haben, trotzdem aber nach wie vor eine unverhältnismäßig bedeutende Rolle in der politischen Landschaft spielen. Dennoch sehen Alemann und Marschall die tatsächliche Bedeutung der Par-teien, vor allem in westlichen Demokratien, nicht nachhaltig infrage gestellt4, wenn-gleich sie einem stetigen Veränderungsprozess unterliegt. Und diese Veränderung ist auch in der sich wandelnden Stellung der Medien begründet.
2.2 Die politische Relevanz der Medien
Dass die Medien großes politisches Gewicht haben, ergibt sich schon allein daraus, dass Informationen fast ausschließlich über sie verbreitet werden. Insofern sind so-wohl Volk als auch Politik auf die Medien als Vermittlungsorgane angewiesen. Sie erfüllen, so Alemann und Marschall, jedoch nicht nur die Funktion von Kommunikati-onskanälen, sondern sind zugleich eigenständige Akteure im politischen Geschehen, die selbstbestimmt Macht ausüben und sich nicht ohne Weiteres von politischen Inte-ressen instrumentalisieren lassen.5 Eine Abhängigkeit besteht heutzutage eher von ökonomischen, als von politischen Faktoren. Über die Öffentlichkeit können durch die Medien Machträume politischer Akteure machterhaltend oder –begrenzend gestaltet werden. Besonders im Prinzip demokratischer Repräsentation mit den Zielkategorien der Kontrolle, der gesellschaftlichen Willensbildung und der Transparenz sehen Ale-mann und Marschall mit Bezug auf Kevenhörster (1998) die Notwendigkeit von Öf-fentlichkeit verankert6 und somit die Bedeutung derer, die an der Gestaltung von Form und Inhalt politischer Kommunikation mitwirken bestätigt.
2.3 Mediendemokratie – Medien als „vierte Gewalt“ im politischen System
Medien konstituieren laut Alemann und Marschall eine demokratische Prozessstruk-tur und sind daher auch aus normativer Sicht unverzichtbare Akteure im politischen Geschehen geworden, was in dem häufig verwendeten Ausdruck der „vierten Ge-walt“ deutlich wird. Dieser stellt die Medien als gleichwertige Komponente neben die drei klassischen Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative.
Der Begriff der „Mediendemokratie“ impliziert neben der Bedeutsamkeit der Medien für Politik und Demokratie auch die Unterstellung, dass öffentliche Kommunikation für die Politik eine zunehmende Wichtigkeit erhält. Dies kann als Folge einer struktu-rellen Veränderung der Öffentlichkeit begriffen werden. Alemann und Marschall beru-fen sich auf Ottfired Jarren (2001) und nennen als entscheidende Entwicklungen für die zunehmende politische Macht von Öffentlichkeit und Medien u. a. folgende7:
- die fortgesetzte Ausweitung der publizistischen Medien
- die Herausbildung neuer Medienformen (z. B. Internet)
- die „Medialisierung“ der gesamten Gesellschaft
- eine hohe gesellschaftliche Beachtung der medialen Tätigkeit
Besonders der letzte Punkt macht deutlich, dass die Relevanz der Medien in erster Linie auch dadurch zustande kommt, dass ihr diese von anderen, vor allem auch von den politischen Akteuren selbst, beigemessen wird.
Thomas Meyer spricht von einer „Kolonisierung der Politik durch die Medien“. Er geht von einem kompletten Wandel der klassischen Parteiendemokratie zur neuen Me-diendemokratie aus und sieht das politische Geschehen zunehmend von den media-len Inszenierungsregeln - der Unterhaltsamkeit, der Dramatisierung, der Personali-sierung und dem Drang zum Bild - dominiert8. Es geht ein Rollentausch vor sich: Während in der Parteiendemokratie die Medien das politische Geschehen beobach-teten, sind es nun die politischen Akteure, die das Mediensystem beobachten, um sich dessen Spielregeln unterordnen und so ein vermeintlich größeres Publikum an-sprechen zu können. Meyer äußert die Befürchtung, dass aufgrund dieser weitge-henden Überlagerung beider Systeme, der Informationswert zugunsten des Unterhal-tungswerts verloren geht und so ein grundlegendes Problem für die Demokratie ent-steht. Zwar ist eine demokratische Politik auf Öffentlichkeit und somit auch auf Mas-senmedien angewiesen, Meyer bezweifelt aber, dass die Eigenlogik des Politischen sich gegen die Regelsysteme der Medien behaupten kann und für die Urteilsbildung der Bevölkerung in ausreichendem Maße erkennbar ist. Als eine der Folgen der zu-nehmenden Mediatisierung nennt er das sogenannte „Politainment“, womit die Selbstmediatisierung der Politik gemeint ist: die Politik unterwirft sich den Regeln der Medien, um eine möglichst große Kontrolle über die Öffentlichkeit zu erlangen.
3. Massenmedien und politische Kommunikation
Ein Eckpfeiler demokratischer Verfassungsstaaten ist die Pressefreiheit. Das Bun-desverfassungsgericht bestätigte in seinem „Spiegel-Urteil“9 die Rolle der Medien folgendermaßen: „Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfas-send informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang. [...] In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung. [...] In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung.“
Pressefreiheit, so führt D. Delhaes aus, umfasst grundsätzlich jede Art der Publikati-on, wenn dadurch nicht andere Rechte eingeschränkt werden.10
3.1 Politische Funktionen der Medien
Zur Verbreitung von Meinungen und zur Überzeugung Andersdenkender bedarf es Kommunikation. Professionelle Kommunikation findet über die Massenmedien statt, die das Potential haben, alle Mitglieder einer Gesellschaft zu erreichen und damit für das politische System von großer strategischer Bedeutung sind11. „Als Hauptquelle gesellschaftlicher Informationen und damit wichtiger Faktor der Meinungsbildung kommt den Massenmedien als ein Steuerungsinstrument komplexer Gesellschaften empirisch wie normativ große Bedeutung zu.“12
Medien haben die Aufgabe zu informieren und zu artikulieren, aber auch Kritik und Kontrolle sollten von ihnen ausgehen. Ihre ursprünglichste Funktion ist laut Delhaes, der sich hier auf Wildermann und Kaltefleiter13 beruft, allerdings ihre Informations-funktion, wobei hier den Forderungen nach Vollständigkeit, Objektivität und Verständlichkeit Folge geleistet werden sollte. Als problematisch bei der Erfüllung der Informationsfunktion sieht Delhaes die Tatsache, dass dem Unterhaltungswert der Informationen eine wachsende Bedeutung beigemessen wird. Wildermann und Kal-tefleiter nennen denn auch die Objektivität als wichtigstes Kriterium der Informations-funktion von Medien.14 Von der klassischen Politikwissenschaft wird die objektive Berichterstattung ohnehin unterstellt. Demnach wird dem Bürger durch die Vielfalt der ein zelnen Medien, denen allein zwar keine Objektivität zugesprochen wird, ein nahezu reales Bild der Welt nahe gebracht.
Kritik wird mitunter an der den Medien zugewiesenen Kritik- und Kontrollfunktion ge-übt, da hier laut W. Rudzio15 die demokratische Legitimation fehle. Diese Kritik sieht Delhaes als gerechtfertigt, wenn unterstellt wird, dass die Medien nicht nur Bericht erstatten, sondern auf die Geschehnisse, über die sie berichten, auch direkten Ein-fluss nehmen. Sie würden dann quasi das bestimmen, worüber sie berichten und hätten somit eine Machtposition, die in einer Demokratie der Legitimation bedarf. An-dere, z. B. Kevenhörster16, sehen das Problem dagegen eher in der Verteilung der Macht über immer mehr Medien auf immer weniger Medienbesitzer und auf diese Weise eine Gefährdung der Kritik- und Kontrollfunktion.
[...]
1 Quelle: Internet http://www.destatis.de/presse/deutsch/wahl2002/p2001211.htm , Angabe bezieht sich auf die Anzahl von Wahlberechtigten zur Bundestagswahl 2002
2 Alemann/Marschall S. 16
3 Leibholz (1967) in Alemann/Marschall S. 18
4 Alemann/Marschall S. 21
5 Alemann/Marschall S. 17
6 Alemann/Marschall S. 18
7 Alemann/Marschall S. 19
8 Meyer, in Aus Politik und Zeitgeschichte S. 7
9 „Spiegel-Affäre“: Verlag hatte 1962 gegen Durchsuchung und Besetzung der Redaktionsräume aufgrund eines kritischen Artikels zur Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr Verfassungsklage erhoben
10 Delhaes S. 51
11 Delhaes S. 52
12 Holtmann, Everhard (2000), in Delhaes Politik und Medien...
13 Wildermann, Rudolf/Kaltefleiter, Werner (1965): Funktionen der Massenmedien
14 Delhaes S. 53
15 Delhaes S. 54
16 Delhaes S. 55
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Parteiendemokratie und Mediendemokratie?
In der Parteiendemokratie sind Parteien die Hauptakteure; in der Mediendemokratie rückt die mediale Inszenierung ins Zentrum, wobei politische Akteure sich zunehmend den Regeln der Medien unterordnen.
Warum werden Medien oft als "vierte Gewalt" bezeichnet?
Weil sie eine Kontrollfunktion ausüben, zur öffentlichen Willensbildung beitragen und politische Prozesse transparent machen.
Welchen Einfluss hat das Internet auf die Parteiarbeit?
Das Internet dient als neuartiges, frei zugängliches Kommunikationsmittel, das die interne und externe Parteienkommunikation sowie den Wahlkampf grundlegend verändert hat.
Was bedeutet der Begriff "Politainment"?
Es beschreibt die Vermischung von Politik und Entertainment, bei der politische Inhalte unterhaltsam und dramatisiert aufbereitet werden, um ein größeres Publikum zu erreichen.
Besteht ein symbiotisches Verhältnis zwischen Medien und Parteien?
Ja, da beide voneinander abhängig sind: Parteien brauchen Medien zur Verbreitung ihrer Ziele, und Medien brauchen politische Inhalte für ihre Berichterstattung.
- Quote paper
- Svenja Schell (Author), 2004, Massenmedien und politische Parteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133756