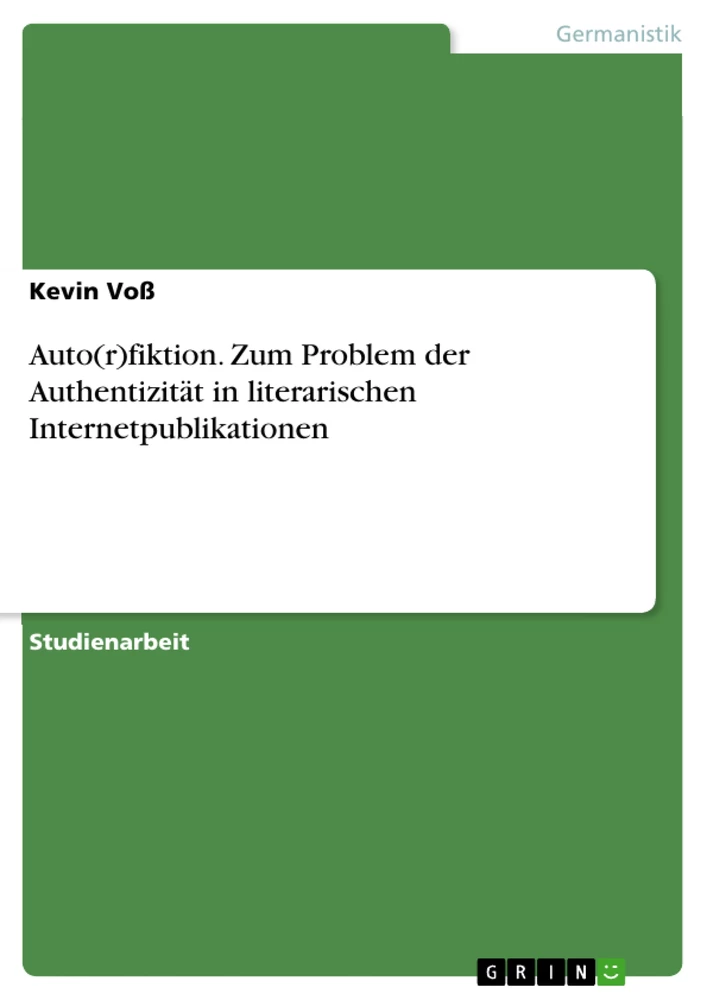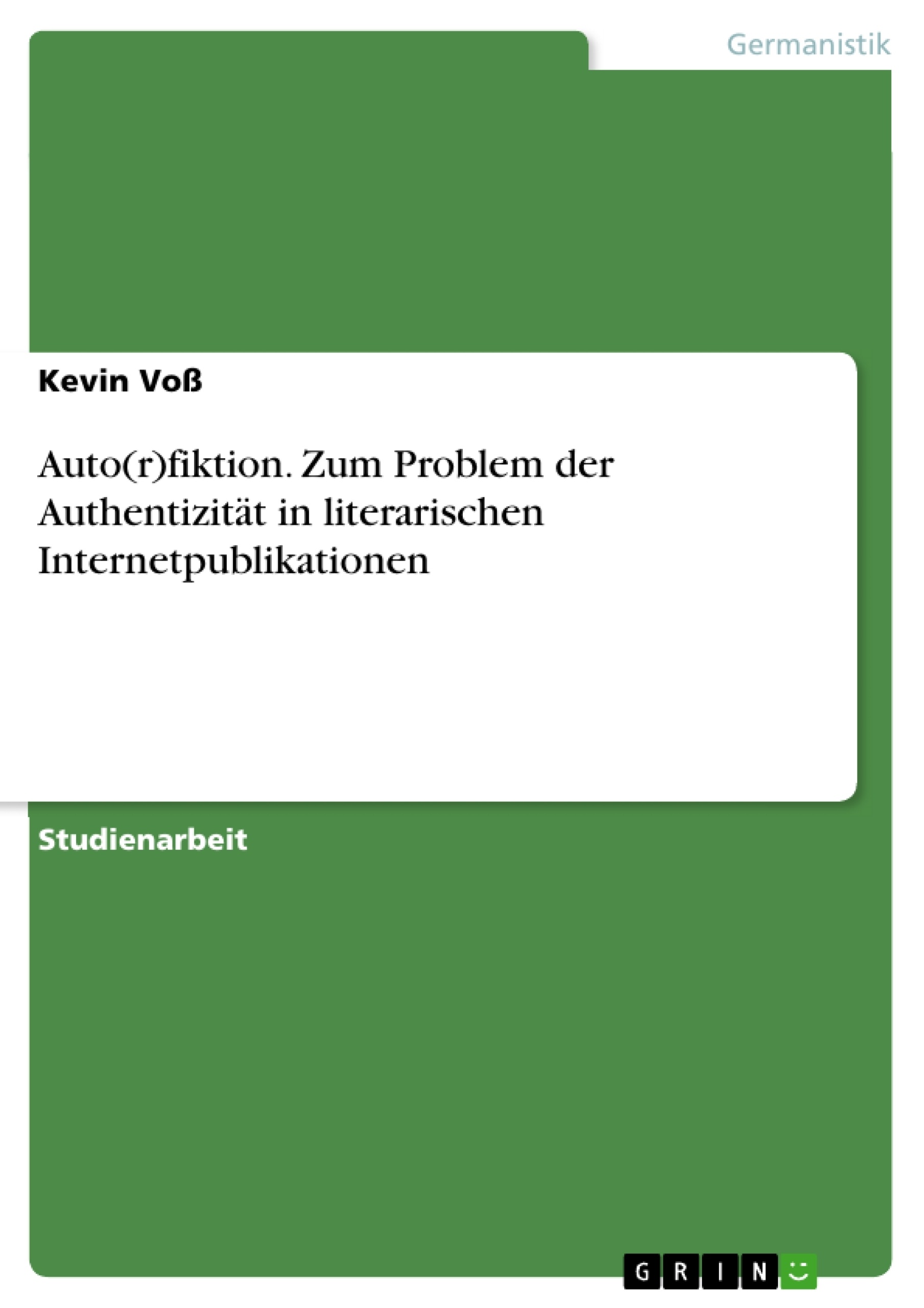Das Verständnis der Autorschaft hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Mit der Erfindung des Internets - insbesondere mit der kommerziellen und medialen Nutzung desselben - lassen sich Texte en masse digital publizieren. Eine Kommentarfunktion ist die moderne Kritik. Diese hat das Potential der Langlebigkeit. Nie zuvor war die Masse an zugänglichen Texten so groß. Nie zuvor war der Widerhall so zeitnah, persönlich und differenziert. Dadurch verändert sich die Sozialfigur eines Autors.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmungen
- 2.1 Autofiktion
- 2.2 Sozialfigur
- 3 Fakt und Fiktion in der digitalen Welt
- 3.1 Avatare und Accounts
- 3.2 Verifikation und Authentizität
- 3.3 Quellen- und Medienkompetenz
- 4 Sozialfiguren
- 4.1 Narziss
- 4.2 Fürstenbergs Personalpronomen
- 4.2.1 Das „Ich“ und die Autobiographie
- 4.2.2 Das „Wir“
- 4.3 Der Erzähler/die Erzählerin
- 5 Netzwelt
- 5.1 Digitale Autor*innen
- 5.2 Der öffentliche Raum
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Problem der Authentizität in literarischen Internetpublikationen. Die Arbeit analysiert, wie sich das Verständnis von Autorschaft im digitalen Zeitalter durch die Möglichkeiten der digitalen Veröffentlichung und des Feedbacks verändert hat. Dabei wird insbesondere der Dualismus von Fakt und Fiktion im Kontext von Autobiografien und Tagebüchern beleuchtet, die online publiziert werden.
- Die Auswirkungen des Internets auf das Verständnis von Autorschaft
- Der Wandel von analogen zu digitalen Publikationsformen und Feedbackmechanismen
- Die Rolle der Autofiktion in der digitalen Welt und ihre Relevanz für die Frage der Authentizität
- Der Einfluss von Sozialfiguren auf die Konstruktion von Identität in digitalen Publikationen
- Die Herausforderungen der Verifikation und Authentizitätsprüfung in der digitalen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt das Problem der Authentizität in literarischen Internetpublikationen dar und erläutert die Bedeutung der modernen Autorschaft in der digitalen Welt. Sie stellt zudem die Relevanz der Frage nach Fakt und Fiktion im Kontext von Autobiografien und Tagebüchern heraus.
- Kapitel 2: Begriffsbestimmungen - Dieses Kapitel definiert die Begriffe "Autofiktion" und "Sozialfigur". Autofiktion wird als eine Kombination aus Autobiographie und romanesken Strukturen definiert, wobei die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verschwimmen. Sozialfiguren werden als Figuren definiert, die in digitalen Texten eine Rolle spielen und die Wahrnehmung des Autors/der Autorin und des Textes beeinflussen.
- Kapitel 3: Fakt und Fiktion in der digitalen Welt - Dieses Kapitel untersucht den Dualismus von Fakt und Fiktion im digitalen Raum. Es werden die Herausforderungen der Verifikation und Authentizitätsprüfung in der digitalen Welt beleuchtet und die Bedeutung von Quellen- und Medienkompetenz für Rezipienten und Autoren hervorgehoben.
- Kapitel 4: Sozialfiguren - Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Sozialfiguren, die in digitalen Texten vorkommen, und untersucht, wie sie die Konstruktion von Identität und Authentizität beeinflussen. Beispiele sind der "Narziss" und die "Fürstenbergs Personalpronomen".
- Kapitel 5: Netzwelt - Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der digitalen Autor*innen und dem öffentlichen Raum im Internet. Es erörtert die Merkmale und Anforderungen an die moderne Autorschaft in der digitalen Welt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Autofiktion, Authentizität, Digitalisierung, Internet, soziale Medien, Sozialfigur, Fakt, Fiktion, Autorschaft, Verifikation, Quellen- und Medienkompetenz, öffentliche Raum, digitale Autor*innen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Autofiktion?
Autofiktion ist eine literarische Gattung, die Autobiographie mit fiktionalen Elementen verbindet. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen realen Fakten und erfundenen Erzählstrukturen.
Wie verändert das Internet die Rolle des Autors?
Durch digitale Publikationen und soziale Medien wird die Distanz zwischen Autor und Leser geringer. Die Kommentarfunktion ermöglicht direktes Feedback, wodurch der Autor zu einer interaktiven Sozialfigur wird.
Was ist das Problem der Authentizität im Netz?
In der digitalen Welt können Identitäten durch Avatare und Accounts konstruiert werden. Leser stehen vor der Herausforderung, den Wahrheitsgehalt von Online-Tagebüchern oder autobiografischen Texten zu verifizieren.
Was bedeutet der Begriff „Sozialfigur“ in diesem Kontext?
Sozialfiguren sind Rollenmodelle (wie der „Narziss“), die Autoren in der digitalen Kommunikation einnehmen. Sie prägen die Wahrnehmung der Identität und Authentizität des Schreibenden durch das Publikum.
Welche Kompetenzen benötigen Leser digitaler Literatur?
Besonders wichtig sind Quellen- und Medienkompetenz, um zwischen faktischen Informationen und fiktionalen Inszenierungen in Blogs und sozialen Netzwerken unterscheiden zu können.
- Citar trabajo
- Kevin Voß (Autor), 2022, Auto(r)fiktion. Zum Problem der Authentizität in literarischen Internetpublikationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1337603