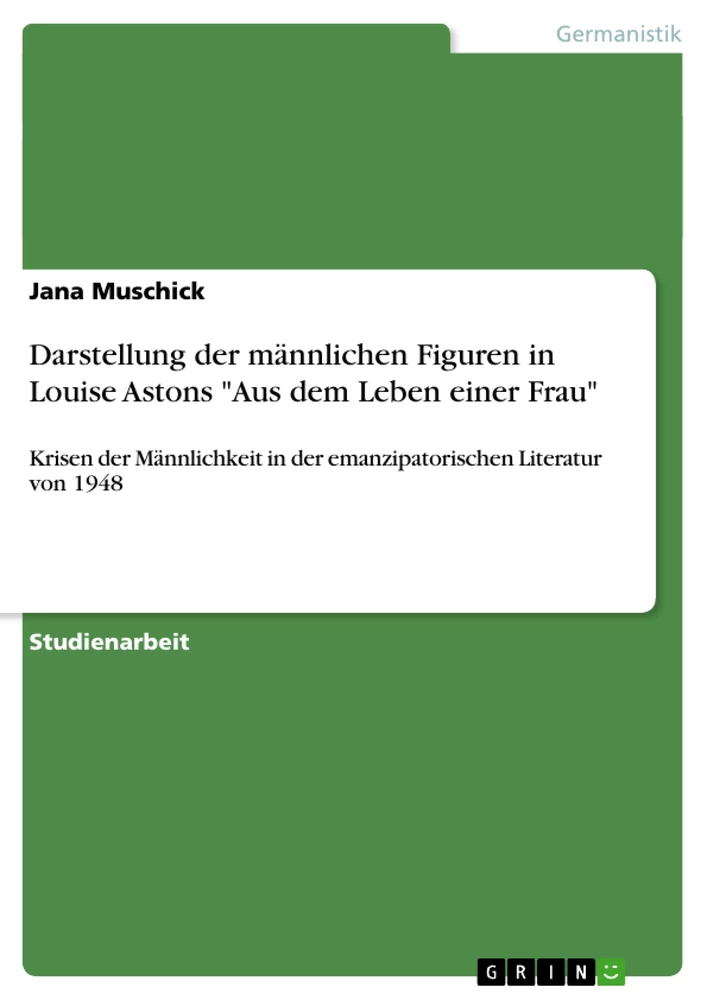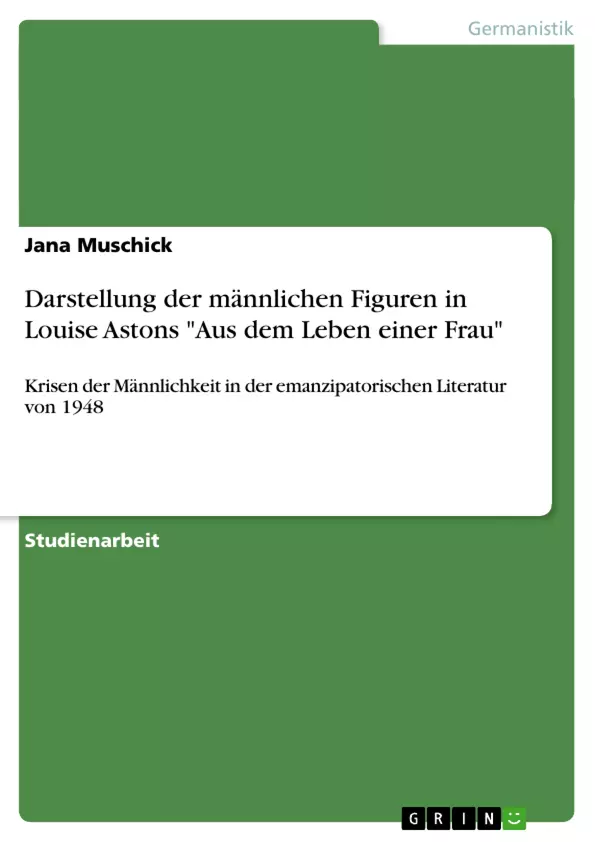Die Arbeit handelt von der Darstellung der männlichen Figuren in Louise Astons "Aus dem Leben einer Frau". Es werden vier Typen unterschieden, die als starre Konstrukte zur Hervorhebung der Emanzipation der Frau auf verschiedenen Ebenen Anwendung finden. Es handelt sich auch um den gängigen Terminus der "Krisen der Männlichkeit" seit der ersten Emanzipationswelle der Frauen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Der Vater – ein untergehender Patriarch
1.1) Väterlichkeit definiert durch eine eigene Geschichte
1.2) Herrscher der Häuslichkeit
1.3) Untergang von Machtausübung und Männlichkeit
1.4) Oburn – ungeliebter Ehemann und Tauschhändler
2. Männlichkeit markiert durch das Fremde
2.1) Männlichkeit definiert durch Tauschgeschäfte
2.2) Oburn – eine Autorität?
3. Zwei Seiten des Begehrens – Zwei Kämpfe um männliche Integrität
3.1) Der Intrigant
3.2) Der positive Held
3.3) Vergewaltigung als Machtkonflikt – Untergang alternativer Männlichkeit
4. Fazit: Johanna gegen erstarrte Konzepte von Männlichkeit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Louise Aston, geb. Hoche1, fiel schon zu Lebzeiten durch ihr „unangemessenes“ Verhalten auf. Sie wurde, erst als Frau, später dann als Autorin emanzipatorischer und revolutionärer Schriften (Romane, Essays und Lyrik) von männlicher Seite scharf kritisiert und sogar sabo-tiert.2 Die Urteile über ihre Person, haben dazu geführt, dass sie noch vor der Veröffentli-chung einer ersten Zeile aus ihrer selbst gewählten Wahlheimat Berlin verwiesen wurde. Man(n) warf ihr folgendes vor, nämlich dass sie: „Ideen geäußert, und ins Leben rufen wolle, welche für die bürgerliche Ruhe und Ordnung gefährlich seien“.3
Astons Publikationszeit erstreckte sich auf einen schmalen Zeitraum von zwei Jahren von 1849 bis 18504. Die Aufmerksamkeit auf ihr Werk zur Publikationszeit war eher aus kriti-schen Quellen zu entnehmen, da ihr erster Roman Aus dem Leben einer Frau5 stark biogra-phisch gefärbt erschien und man in diesem Werk einen möglichen Anreiz zur Nachahmung sah. Deshalb stand man dem Roman sehr skeptisch gegenüber. Überhaupt wurde Astons „Einsatz für Frauen und Arbeiter sowie ihre Beteiligung an den 48er Barrikadenkämpfen als bloße Sensationslust oder überspannte Renommiersucht mißdeutet“.6 Die Aktionen der Auto-rin wurden also eher als Narzissmus verspottet, als das man ihren literarischen Bemerkungen größere Aufmerksamkeit entgegen gebracht hätte. Astons Werk wurde nicht in einen litera-risch-klassischen Kanon aufgenommen, weswegen die Publikationslage analytischer Schriften über ihre Arbeiten eher rar ist.
Das Genre ihres Werkes ist der Tendenzliteratur des Vormärz zuzuordnen. Sie schrieb in der Gattung des trivialen Romans. Karlheinz Fingerhut bemerkt dazu: „Über Handlungsspannung und Illusionsbildung sollen einem Publikum, das Trivialliteratur zu lesen gewohnt ist, neue politische Sichtweisen nahegebracht werden.“7 Die Autorin benutzte den trivialen Stil, um einen Leserkreis zu erreichen, der nicht in Ämtern oder Universitäten saß. Es ging ihr viel-mehr um die Vermittlung ihrer Gedanken und den Anspruch, ein politisches Bewusstsein zu schaffen oder zu fördern. Besonders die Rezeption männlicher Kanonkonstrukteure muss als Ursache für die „triviale“ Wirkung, die Louise Astons Texten zugesprochen wird, erkannt werden. Der innovative Versuch einer Darstellung der Emanzipation einer Frau und ihr Kampf gegen ein besitz- und triebgesteuertes Patriarchat wird oftmals marginalisiert oder gänzlich verkannt.
Für die Literaturwissenschaft ist es sehr irritierend, dass die Lebensart der Autorin in der schmalen Werkinterpretation oft eine dominantere Rolle einzunehmen scheint, als die Be-trachtung ihrer Texte für sich. Diese Auffälligkeit kann in mangelhaften „analytischen“ Tex-ten von Ruth-Esther Geiger (1981)8 oder Anna Blos (1928)9 deutlich erkannt werden. Auch ältere lexikalische Beiträge zeugen von diesem „Interpretationsproblem“.10
Die Masse an Interpretationen von Louise Astons Werk und ihres Romans Aus dem Leben einer Frau hat sich bis zum Jahr 2007 kaum gesteigert. Unter den Rezeptionen befindet sich die herausragende Arbeit von Renate Möhrmann: „Die andere Frau“11.
In dieser Arbeit wird ein Aspekt betrachtet, den es in der Forschung zu Astonschen Texte noch nicht gab. Der Fokus der Analyse richtet sich auf die Konstruktionen der männlichen Figuren in Aus dem Leben einer Frau. Deshalb ist diese Analyse in folgende Abschnitte un-terteilt: Als erstes soll der Vater und dessen Verhaltensmuster analysiert werden. Die Frage nach dem letzten Akt einer greisen Männlichkeit wird versucht, zu beantworten. Darauf folgt die Beleuchtung des Ehegatten Oburn, der ein Meister des Tausches ist – auch was seine Frau angeht. Wieweit er damit Erfolg hat und inwiefern er als autoritäre und hegemoniale Männ-lichkeit funktioniert, soll erklärt werden. Die letzten Männlichkeiten werden der Prinz C** und Eduard von Stein sein, die einander als Konzepte verschiedener Männlichkeiten gegenü-ber gestellt werden sollen. Das abschließende Fazit führt die analysierten Männlichkeiten noch einmal zusammen und soll zeigen, inwieweit diese schematisch skizzierten Männertypen wichtig für die Protagonisten Johanna waren, um sie aus ihrem Objektstatus in den individuel-leren Subjektstatus einer freien Frau zu führen.
1.) Der Vater – ein untergehender Patriarch
Der Roman Aus dem Leben einer Frau ist ein Figurenroman. Die dargestellten Protagonisten – vier Männer und eine Frau – werden schematisiert dargestellt. Mann kann die Protagonisten in verschiedene Verhaltensmustern unterteilen. Barbara Wimmer sagt dazu: „Erscheinungs-bild und Charakter stimmen völlig überein“12. So erscheint der Vater als unbarmherziger Vollstrecker des Schicksals seiner Tochter und als Patriarch. Ihr späterer Ehemann ist von der Sucht nach Besitzt und Luxus gesteuert. Der später auftauchende Prinz ist ein narzistischer Egomane und der Retter von Johanna, Eduard von Stein, stellt die sensible Alternative zu unabänderlicher männlicher Verfügungsgewalt dar. Johanna selbst wird so zum Spielball der Männer, nimmt ihre eigene Position aber nicht immer willenlos hin.
Der Charakter der Figuren sowie ihre Art zu reden und zu handeln, bleibt bei Männern (Eduard als Ausnahme) im gesamten Handlungsverlauf bestehen – bei ihnen existieren keine Brüche oder Entwicklungen. Und bis auf Eduard von Stein reflektiert auch keine der Figuren ihre Handlung. Alle Männer arbeiten stringent auf ihr Ziel hin – sei es aus Gründen des se-xuellen Triebes oder der materiellen Besitzsucht. Stringent gehen sie ihren Weg und nehmen dafür jede Art von moralischen Verstöße in Kauf.
Aus dem Leben einer Frau ist in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil wird die Familie der Pro-tagonistin von Seite 1 bis Seite 18 zum einzigen Handlungsraum. Die Handlung findet im Elternhaus der Hauptfigur statt – sie und ihr Vater stehen hier im Mittelpunkt. Im Dialog be-sitzt der Vater die größten Redeanteile. Johanna ist mit der Verheiratung an einen reichen Industriellen nicht einverstanden und will das Familienoberhaupt von der Richtigkeit ihrer Entscheidung überzeugen – ihr Vater akzeptiert aber eigenständige Entscheidungen der Toch-ter nicht und es kommt zum Konflikt. Durch die Art der Darstellung des Vaters und seiner Beziehung zu der Tochter wird seine Vormachtstellung deutlich. Die Protagonistin wird hier zum ersten Mal im Roman durch einen Mann in ihren „weiblichen“ Aufgabenbereich – näm-lich den der Ehe, eingeführt.
1.1) Väterlichkeit definiert durch eine eigene Geschichte
Im ersten Kapitel sitzen Vater und Tochter in einer Art Tableau bei einander. Der Patriarch „thront“ auf seinem Stuhl in der Mitte des Raumes und Johanna kniet zu seinen Füßen: Vor diesem Greise [Anm.: dem Vater] knieete ein liebliches Mädchen von siebzehn Jahren. (vgl. S. 3). Schon durch die Stellung der Figuren kann eine Veranschaulichung von patriarchali-scher Macht erkannt werden. Der Vater sitzt „über“ der Tochter; sie liegt ihm „zu Füßen“. Dadurch wird die männliche Gewalt als Familienoberhaupt symbolisiert. Das Tableau befin-det sich in einem spartanisch eingerichteten Raum, da es der Familie an finanziellen Mitteln fehlt: Ein blankgebohnter Nußbaumtisch, drei geflochtene kleine Rohrsessel, ein Spielgel in Duodezform bildeten mit dem Sopha das ganze Meublement. (S. 4) Doch die einfache Idylle ist nur Oberfläche und dient zum starken Kontrast des Konflikts. Johanna ist die benachteilig-te Verteidigerin ihrer Rechte und ihr Vater ist der unnachgiebige Vollstrecker.
Die Pfarrhauswohnung erscheint wie eine abgeschlossene Sphäre. Die Darstellung des Vaters bedient eine Interpretation Männlichkeitskonzeptes von Erhart: „Während Weiblichkeit nach 1800 zumeist auf immanente Geschlechtseigenschaften zurückgeführt wird, erwirbt man sich Männlichkeit durch die angeeignete Form einer männlichen Geschichte“13. Tatsächlich ver-sucht der Vater den Befehl einer Hochzeit an seine Tochter durch die Erzählung „seiner“ Le-bensgeschichte zu verstärken. Ausgiebig erzählt er, dass er eine Liebesheirat vollzogen hat und dadurch sich und seine Frau in großes Unglück stürzte: ‚Deine Mutter ist edel und lie-benswürdig; - dennoch waren wir Beide elend; deine Mutter, weil sie alle gewohnten An-nehmlichkeiten des Lebens entbehren mußte; ich, weil ich nicht im Stande war, sie ihr zu ver-schaffen‘. (S. 11) Die Figur des Vaters ist durch das Erzählen der Geschichte charakterisiert. Der Vater fühlt sich als Versager, weil er seiner Frau und sich selbst nicht den Reichtum erar-beiten konnte, den er sich für ein befriedigendes Leben erhofft hatte. Nun will er dieses Ver-sagen durch die Verheiratung seiner Tochter ausgleichen. Durch das Weiterreichen seiner Lebenserfahrungen an Johanna, übergibt er ihr gleichzeitig das schwere Erbe, aus einem ein-fachen Leben ein „besseres“ zu machen. Als Vater und Richter widerfährt ihm hier allerdings eine zweifache Nichterfüllung der an ihn gestellten Ansprüche. Er hält sein eigenes Leben für wertlos, weil er es in keine finanziell besser gestellte Position bringen konnte. Das ist der erste Punkt seiner Nichterfüllung, die er nun seinem Kind aufbürdet. Der zweite ist, dass er meint, seiner Tochter diese Schmach ersparen zu müssen und dass er nicht den Fehler erkennt, sie einem ungeliebten Mann zu überlassen, sondern auch einem Leben, dass ihr selbst nichts be-deutet: ‚Ich lasse mich nicht verhandeln gegen schnödes Gold‘ (S. 12). Der männlichen Figur entfällt hier die Erinnerung, dass er als Mann stets wählen durfte, auch wenn er dies nur nach seinen Möglichkeiten tun konnte. Diese Freiheit ist es, die er seiner Tochter nicht zugesteht.
1.2) Herrscher der Häuslichkeit
„Die im 18. Und 19. Jahrhundert durchgreifende Trennung einer öffentlichen und einer priva-ten Sphäre sowie die [...] Differenzierung in ‚expressiv-weiblich‘ und ‚instrumentell-männliche‘ Rollen setzen das Vorhandensein polarisierter Geschlechtscharaktere voraus.“14 Die Rollen der Figuren Vater und Tochter demonstrieren die polaren Geschlechtstypisierun-gen. Der Vater ist das Instrument, dass die junge Frau dazu zwingt, etwas ungewolltes zu tun. Johannas Wünsche spielen für ihn keine Rolle. Interessant ist, dass die „instrumentell-männliche“ Rolle nicht den Bereich der Öffentlichkeit für sich beansprucht. Der Vater scheint zum Mobiliar zu gehören: Auf einem altmodischen mit großblumigen Kattun überzogenen Sopha saß ein Greis mit finstern, unheimlichen Zügen. (S. 2f.) Der alte Mann sitzt in der Mitte der Wohnung – er beansprucht den zentralen Punkt des Raumes für sich und kann hier in seiner beherrschenden patriarchalischen Rolle wirken. Da der Vater nicht mehr als Teil des öf-fentlichen Raumes funktioniert, wird ihm auch ein Teil seiner männlichen Funktion versagt. Seine Position als Mann der Öffentlichkeit ist passé. Seine Identität kann „nur“ als Vater legi-timiert werden. Diese Rolle übermittelt er auch seiner widerspenstigen Tochter: ‚ Bist du nicht mein Geschöpf? Ist nicht mein Wille Dir Gesetz? Du mußt ihm gehorchen; denn ich bin Herr über Dich!‘. (S. 13) Der Vater akzeptiert den Widerspruch seines „Geschöpfes“ nicht – er spricht hier nicht nur das Urteil über seine Tochter, er führt es auch aus. Die Ausübung ist das letzte Mittel des „Praktizierens“ von Macht für den Vater. Erhart sagt dazu, und zitiert nach Juliet Mitchell: „Nicht ‚Männer‘ sind die ‚Inhaber der Macht‘ [...], sondern ‚Väter‘: jene In-stanz also, die [...] Söhne wie Töchter in die symbolische Ordnung einführt und sie dafür mit einer jeweils unterschiedlichen Geschlechtsidentität gleichsam imprägniert“15. Der Vater führt Johanna nach seiner Fasson in eine „symbolische Ordnung“ ein. Diese Aufgabe auszuführen ist für ihn die letzte Möglichkeit als Mann zu funktionieren und über „Untergebene“ Macht auszuüben. Als Johanna seine Entscheidung anzweifelt, benutzt er über den „wörtlichen“ Be-fehl hinaus Gewalt: An dem braunlockigen Haar riß er die Tochter wild hin und her, und stieß sie dann mit den Füßen von sich, in maßlosem Zorn ausrufend: ‚Ungerathene! Ich fluche Dir!‘ (S. 14).
[...]
1 Vgl. In: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 52. Leipzig 1906. S. 294. Und in: Blos, Anna: Frauen der deut-schen Revolution 1848. Zehn Lebensbilder und ein Vorwort. Dresden 1928. S. 25.
2 Fingerhut, Karlheinz (Hg.): Nachwort. In: Louise Aston: Ein Lesebuch. Gedichte, Romane, Schriften in Aus-wahl (1846-1849). Stuttgart Hans-Dieter Heinz Akademischer Verlag, 1983. S. 148f.
3 Zitiert nach Möhrmann, Renate: Das groteske Finale. Louise Astons Ausweisung. In. Möhrmann, Renate (Hg.): Die andere Frau. Emanzipationsansätze deutscher Schriftstellerinnen im Vorfeld der Achtundvierziger-Revolution. Stuttgart Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, 1977. S. 145. Möhrmann zitierte nach Aston, Louise: Meine Emanzipation – Verweisung und Rechtfertigung. Brüssel 1846. S. 18.
4 S. Allgemeine dtsch. Biographie 1906. S. 295.
5 Aston, Louise: Aus dem Leben einer Frau. Fingerhut, Karlheinz (Hg.). Stuttgart Akademischer Verlag, 1982. Anm.: Im Folgenden wird aus dem behandelten Werk zitiert und die Seitenzahl des kursiv gesetzten Zitates folgt nach dem Zitar in Klammern ohne weitere Kürzel.
6 Möhrmann 1977. S. 144.
7 Fingerhut. Karlheinz: Das Porletariat im bürgerlichen Unterhaltungsroman: Über Louise Aston (1814-1871). In: Die Horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, 30/1 1985. S. 40.
8 Geiger, Ruth-Esther: Louise Aston 1818-1871. In: Schultz, Hans Jürgen: Frauen. Portraits aus zwei Jahrhun-derten. Stuttgart 1981.
9 Blos 1828.
10 Bsp.: „Jedenfalls bleibt die ‚Luise Aston‘ als eine seltsame Erscheinung interessant“. In: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 52. Leipzig 1906, S. 294-296.
11 Möhrmann 1977.
12 Wimmer, Barbara: Die Vormärzschriftstellerin Louise Aston. Selbst- und Zeiterfahrungen. Frankfurt a. M. 1993, Europäische Hochschulschriften: Rühe 1, Deutsche Sprache und Literatur, 1424. S. 16.
13 Walter Erhart: Familienmänner. Über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit. München Wilhelm Fink Verlag, 2001. S. 9.
14 Erhart 2001. S. 43.
15 Ebd. S. 44. Erhart zitiert heir nach Mitchell, Juliet: Psychoanalyse und Feminismus. 1974. S. 467.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt Louise Astons Werk „Aus dem Leben einer Frau“?
Der Roman thematisiert die Emanzipation einer Frau und ihren Kampf gegen ein besitzorientiertes Patriarchat im Kontext des Vormärz.
Welche männlichen Typen werden in der Analyse unterschieden?
Es werden vier Typen analysiert: der untergehende Patriarch (Vater), der Tauschhändler (Ehemann Oburn), der Intrigant (Prinz C**) und der positive Held (Eduard von Stein).
Wie wird der Vater in der Erzählung dargestellt?
Er wird als unbarmherziger Patriarch skizziert, der seine Macht über die Tochter ausübt, um sein eigenes wirtschaftliches Versagen durch ihre Heirat zu kompensieren.
Was ist das Besondere an der Figur Eduard von Stein?
Eduard stellt die sensible Alternative zur männlichen Verfügungsgewalt dar und unterstützt Johanna auf ihrem Weg zur freien Subjektivität.
Warum wurde Louise Aston zu Lebzeiten scharf kritisiert?
Aufgrund ihres emanzipatorischen Verhaltens und ihrer revolutionären Schriften galt sie als Gefahr für die bürgerliche Ordnung und wurde sogar aus Berlin verwiesen.
- Quote paper
- Jana Muschick (Author), 2007, Darstellung der männlichen Figuren in Louise Astons "Aus dem Leben einer Frau", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133784