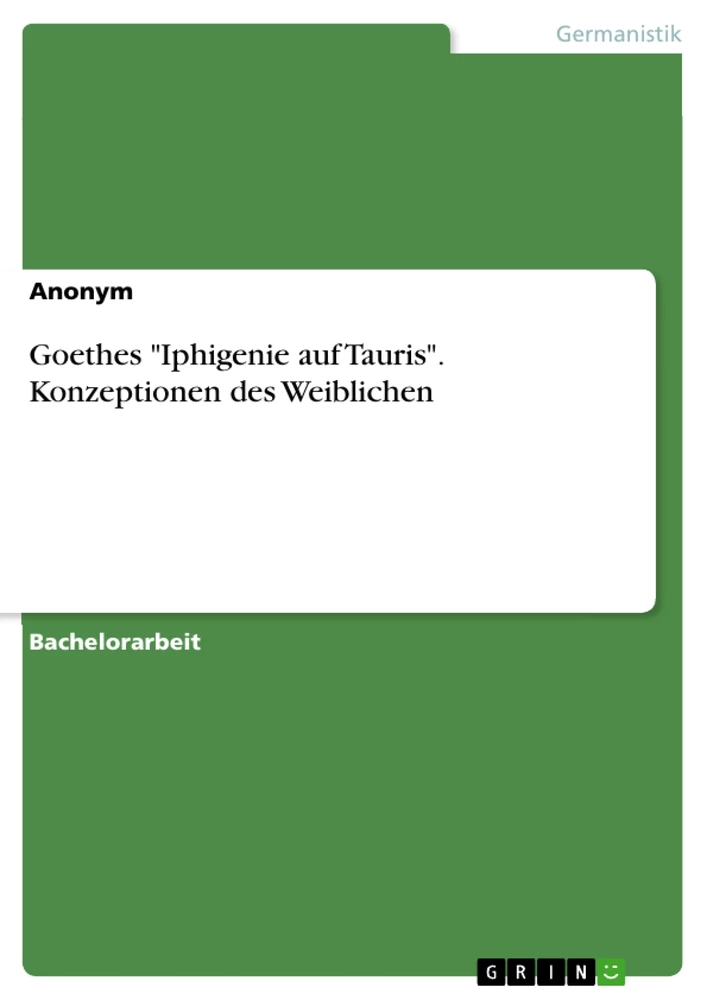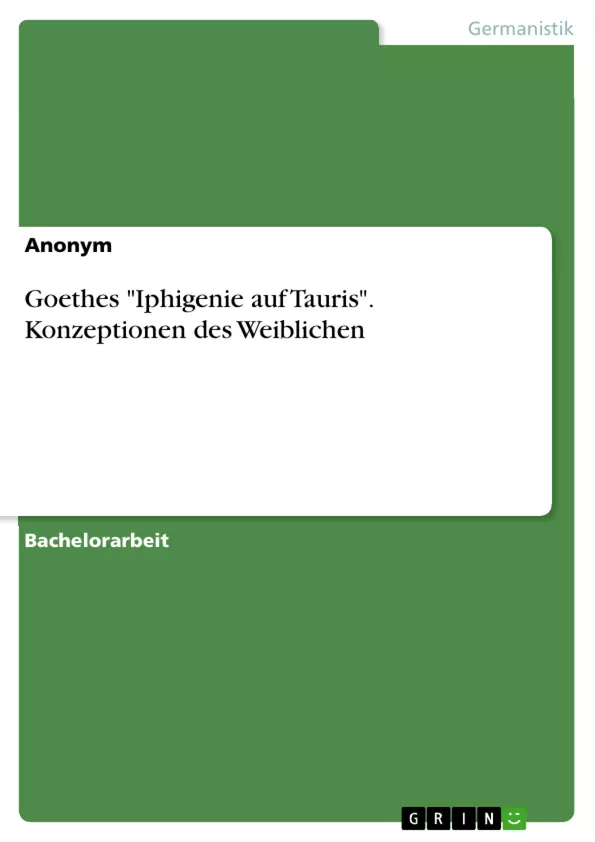Diese Bachelorarbeit untersucht, inwiefern Goethe in seinem Werk "Iphigenie auf Tauris" Geschlechterkonzeptionen entwirft. Dabei werden folgende Leitfragen diskutiert: Wie wird die Rolle der Frau und ihre Weiblichkeit im Drama dargestellt? Inwieweit lassen sich geschlechterspezifische Motive feststellen? Von weitergehendem Interesse ist in Bezug auf das Forschungskonzept der Intersektionalität die Frage, inwieweit die Herkunft der Protagonistin mit der Geschlechterdifferenz zusammenhängt.
Die Arbeit beginnt mit einer Erklärung der theoretischen Grundlagen. Dabei werden themenspezifische Theorien der Gender Studies sowie der Postcolonial Studies beleuchtet. Anhand der genannten Theorien werden die verschiedenen Deutungsansätze gestützt bzw. kritisch hinterfragt. Nach der theoretisch-methodischen Verortung wird als nächstes auf den Entstehungskontext der Tragödie eingegangen, da sich das Werk insgesamt durch einen weiten mythologischen Hintergrund kennzeichnet. Im Anschluss daran widmet sich die Autorin den Gattungsmerkmalen der Tragödie, um der in der Forschung als Repräsentation des klassischen Weltbildes erachteten Auffassung nachzugehen. Goethe selbst charakterisierte sein Werk in einem Briefwechsel mit Schiller sogar als „verteufelt human“.
Das nächste Kapitel widmet sich der Analyse der Frauenkonzeptionen. Neben den Rollen als Schwester, Tochter und Verehrte, gilt es, den Motivkomplex rund um Iphigenie als „weiße“ Ikone zu verstehen. Die sich stets wiederholenden Motive der Jungfräulichkeit, Reinheit, Moral und der Humanität sind hier zentral. Bezüglich des Deutungsschwerpunkts der Iphigenie als Schwester, wird ein allgemeiner Rahmen um das Frauenbild Goethes gezeichnet, wobei diese Arbeit in erster Linie auf seine Biografie eingeht. Um den Analyseteil abzurunden, wird in Bezug auf die unterschiedlichen weiblichen Rollen, die Iphigenie einnimmt, zusätzlich differenziert, wie diese Rollen zueinanderstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 2. GENDER STUDIES UND POSTCOLONIAL STUDIES.
- 3. ENTSTEHUNGSKONTEXT.
- 3.1. MYTHOLOGISCHER HINTERGRUND: IPHIGENIE AUF TAURIS UND IPHIGENIE BEI DEN TAURERN.
- 3.2 GATTUNGSMERKMALE DER TRAGÖDIE
- 4. DIE FRAUENKONZEPTION: ANALYSE UND DEUTUNG
- 4.1 DIE FIGUREN UND IHRE KONSTELLATION....
- 4.2 DEUTUNGSANSÄTZE DER IPHIGENIE.
- 4.2.1 Iphigenie als Schwester.
- 4.2.2 Iphigenie als Jungfrau.
- 4.2.3 Iphigenie als Priesterin
- 4.2.4 Iphigenie als „, weiße\" Ikone.
- 4.3 IPHIGENIES ROLLENKONFLIKTE
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Goethes „Iphigenie auf Tauris“ im Hinblick auf seine Konzeptionen des Weiblichen. Die zentrale Frage ist, wie die Rolle der Frau und ihre Weiblichkeit im Drama dargestellt werden und inwiefern geschlechterspezifische Motive erkennbar sind. Weiterhin wird der Einfluss der Intersektionalität – das Zusammenspiel verschiedener Dimensionen sozialer Ungleichheit – untersucht, insbesondere im Hinblick auf Iphigenies Herkunft als Griechin im Vergleich zu den Taurern.
- Geschlechterrollen und die Darstellung der Weiblichkeit in Goethes „Iphigenie auf Tauris“
- Die Rolle der Intersektionalität im Drama, insbesondere in Bezug auf Herkunft und Geschlecht
- Analyse der geschlechterspezifischen Motive in der Tragödie
- Untersuchung der Konzeption des „Weißen“ in Goethes Werk im Lichte der postkolonialen Literaturwissenschaft
- Einordnung der „Iphigenie auf Tauris“ in den Kontext der Gender Studies und der Postcolonial Studies
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Einordnung, die Gender Studies und Postcolonial Studies beleuchtet. Dabei werden die relevanten Theorien zur Analyse von Geschlechterrollen und postkolonialen Machtstrukturen vorgestellt. Die Arbeit führt anschließend in den Entstehungskontext des Werks ein, beleuchtet den mythologischen Hintergrund und die gattungsspezifischen Merkmale der Tragödie.
Das Kernstück der Arbeit liegt in der Analyse der Frauenkonzeptionen in „Iphigenie auf Tauris“. Hierbei werden verschiedene Deutungsansätze für die Figur der Iphigenie beleuchtet – insbesondere die Rolle der Schwester, die Jungfräulichkeit und die Priesterin. Die Arbeit untersucht zudem die vielschichtigen Rollenkonflikte, denen Iphigenie als Frau, Griechin und Priesterin begegnet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Gender Studies, Postcolonial Studies, Intersektionalität, Weiblichkeit, Geschlechterkonzeptionen, "Iphigenie auf Tauris", "weiße" Ikone, Kolonialismus, Ethnische Überlegenheit.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Goethes "Iphigenie auf Tauris". Konzeptionen des Weiblichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1338061