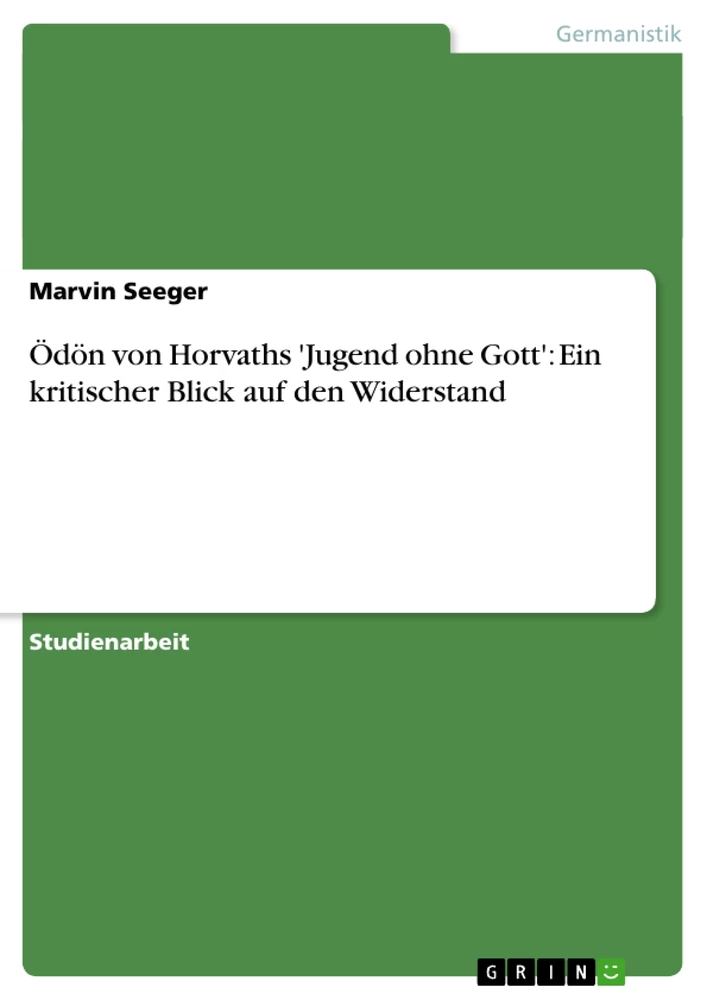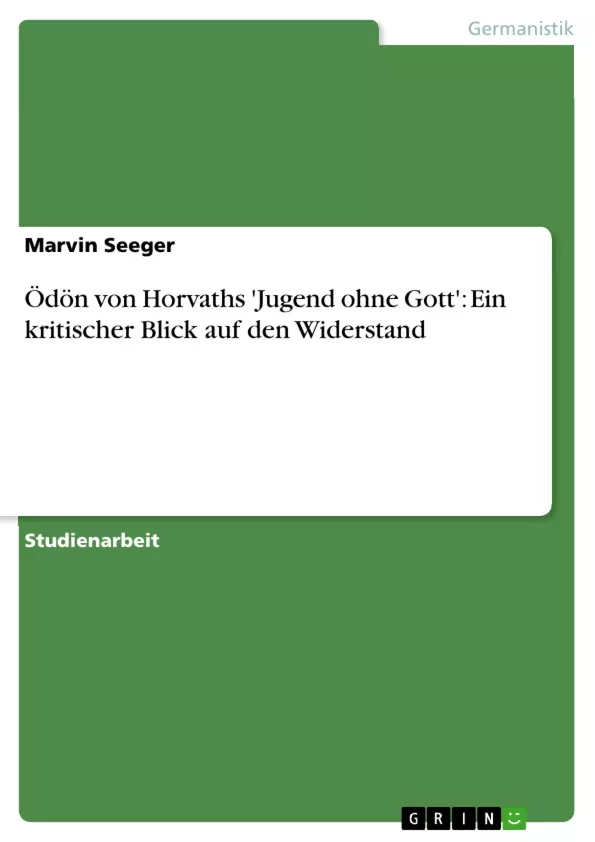Diese Hausarbeit widmet sich dem Thema des Widerstandes im Roman Jugend ohne Gott von Ödön von Horvath, welcher 1937 erschien. Ich werde klären, in wie weit der Roman zur antifaschistischen Literatur gezählt werden kann und dabei näher auf die Form des Widerstandes eingehen. Anhand meiner Untersuchungen versuche ich festzustellen, was Horvath dazu bewegt hat ausgerechnet einen persönlich moralischen Protest zum Thema zu machen in einer Zeit, in der andere Autoren offensiv und in aller Deutlichkeit gegen den Nationalsozialismus schrieben. Dazu werfe ich zunächst unter 2.) einen Blick auf Horvath als Künstler und Exilanten, mit besonderer Berücksichtigung der damaligen Entstehungsbedingungen von JoG (fortläufige Bezeichnung des Werkes), bevor ich allgemein auf den Werkaufbau und die Textstruktur zu sprechen komme.
Anschließend werde ich die Form des Widerstandes interpretieren und in den zeitlichen Diskurs einordnen unter zu Hilfenahme der von Horvath verwendeten Stilmittel. Dabei soll anhand der geistigen Wandlung des Erzählers, aber auch die Kritik an der beschriebenen Gesellschaft sowie die vorkommenden Typen des Protestes deutlich zum Vorschein kommen. Abschließend zeige ich die sich daraus ergebenen Möglichkeiten für eine hypothetische Entwicklung des Widerstandes auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einfiihrung
- Einleitung
- Exkurs: weitere Aspekte des Werkes
- Ödön von Horvåth Entstehungsgeschichte von Jugend ohne Gott
- Ödön von Horvåth — Werdegang eines heimatlosen Dramatikers —
- Exkurs zur Exilschreibsituation .
- Ödön von Horvåth— Schaffen im Exil
- Textstruktur
- Allgemeines zu JOG
- Die 4 Handlungsabschnitte
- Überschriften- und Kapitel-Funktion.
- Theaterelemente in JOG .
- Der Widerstand in JOG
- Der leidvolle Weg zur kritischen Auseinandersetzung.
- Der stille Widerstand......................
- Wie die Stille bröckelt
- Fazit
- Quellenangaben
- Primärliteratur .
- Sekundärliteratur —
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Roman „Jugend ohne Gott" von Ödön von Horvath, erschienen 1937, mit dem Ziel, die Form des Widerstandes im Werk zu untersuchen und zu klären, inwieweit der Roman zur antifaschistischen Literatur gezählt werden kann. Die Arbeit betrachtet Horvaths Motivation, einen persönlichen moralischen Protest in den Mittelpunkt zu stellen, und vergleicht ihn mit anderen Autoren, die offen gegen den Nationalsozialismus schrieben. Neben der Analyse der Textstruktur und des Werkautbaus werden die Entstehungsbedingungen des Romans im Exil und die geistige Wandlung des Erzählers beleuchtet.
- Die Form des Widerstandes im Roman
- Die geistige Wandlung des Erzählers
- Die Kritik an der beschriebenen Gesellschaft
- Die verschiedenen Formen des Protests
- Die Möglichkeiten für eine hypothetische Entwicklung des Widerstandes
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten Kapitel des Romans „Jugend ohne Gott" führen den Leser in die Welt einer faschistisch geprägten Schule ein. Der Lehrer, der Protagonist des Romans, ist ein kritischer Beobachter der Geschehnisse, doch zunächst gefangen in einer opportunistischen Passivität. Er verachtet die Schüler für ihre fehlende Selbstständigkeit und ihre Anpassung an den Zeitgeist, doch gleichzeitig ist er selbst von der Angst vor dem Regime gefesselt. Die Schüler werden als amorphe Masse dargestellt, die die ihnen vorgegebene Doktrin unhinterfragt übernimmt. Der Lehrer sieht keinen Ausweg aus der Resignation und findet nur im Zynismus eine Art Trost.
Im weiteren Verlauf des Romans beginnt der Lehrer, seine Haltung zu hinterfragen. Die Begegnung mit dem Pfarrer und die damit verbundene Auseinandersetzung mit dem Gottesbegriff führen ihn zu einer neuen Sichtweise auf die Welt. Er erkennt die Schuld, die er durch seine Passivität auf sich lädt, und beginnt, sich von seiner opportunistischen Haltung zu lösen. Die Jugend, die anfänglich als charakterlos und uneigenständig dargestellt wird, beginnt, sich in einzelnen Figuren zu individualisieren. Die Schüler N, T und Eva treten aus der Masse hervor und zeigen ihre eigenen Charakterzüge.
Die Kriminalgeschichte, die im zweiten Handlungsabschnitt ihren Anfang nimmt, dient als Katalysator für die weitere Entwicklung des Lehrers. Die Ermordung des Schülers N und die anschließende Suche nach dem Täter führen den Lehrer dazu, sich aktiv in die Geschehnisse einzumischen. Seine Wahrnehmung seiner Umgebung verändert sich, er wird sensibel für die Ungerechtigkeiten des Systems. Die zweite Gottesvision stärkt seinen Glauben an die Wahrheit und beflügelt ihn, sich gegen die bestehenden Zustände zu wehren. Die Moral des Lehrers wird neu entfacht, er findet Mut, sich für Gerechtigkeit einzusetzen.
Der Lehrer entwickelt einen stillen Widerstand, der sich nicht in offenen Aktionen gegen das Regime äußert, sondern in einer inneren Distanzierung von der faschistischen Ideologie. Er wird zum Außenseiter, der sich für die Wahrheit einsetzt und sich nicht länger von der Angst vor dem Regime leiten lässt. Der Roman endet mit der Flucht des Lehrers nach Afrika, einem Ort, an dem er seinen humanistischen Wertvorstellungen nachleben kann. Der Lehrer hat sich seine Freiheit erkämpft und wird zum Missionar der Wahrheit, der den Widerstand im Exil fortsetzen kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Widerstand, die antifaschistische Literatur, die geistige Wandlung, den moralischen Protest, die Kritik an der Gesellschaft, die Jugend ohne Gott, den Zeitgeist und die verschiedenen Formen des Protests. Der Roman analysiert die Auswirkungen des Faschismus auf die Gesellschaft und die individuellen Lebensentwürfe. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Protagonisten und seiner Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit in einer von Angst und Unterdrückung geprägten Welt.
- Arbeit zitieren
- Marvin Seeger (Autor:in), 2008, Ödön von Horvaths 'Jugend ohne Gott': Ein kritischer Blick auf den Widerstand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133811